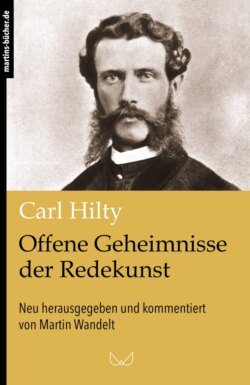Читать книгу Offene Geheimnisse der Redekunst - Carl Hilty - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Befangenheit
ОглавлениеViele dieser Unarten haben ihren gemeinschaftlichen Ursprung in der Befangenheit des Redners, in dem »Sich-Genieren«, das für manche Personen überhaupt das wesentlichste Hindernis des Sich-Aussprechens bildet. Wir wollen nicht leugnen, dass dies ein wirkliches Hindernis ist, das je nach der Natur der einzelnen Menschen sich zuweilen zu einem schwer überwindlichen steigern kann. Unüberwindlich aber ist es in keinem Falle, und es sind das sogar nicht immer die besten Redner, die es am schnellsten und leichtesten überwinden. Wir finden im Gegenteil oft Leute, die schon in den Schulen eine völlige Unbefangenheit bei dem öffentlichen Vortrag zeigen. Nach gewöhnlicher Erfahrung werden daraus selten gründliche Menschen und gute Redner. Denn die Natur hat vor alles Große den Schweiß, die Anstrengung gesetzt und dem ohne Anstrengung Erworbenen die rechte Reife versagt. Es ist auch ein instinktives Gefühl eines jeden, dass man einem jugendlichen allzu dreisten Redner gegenüber eher kühl sich verhält, während eine gewisse, nicht absolut hinderliche Befangenheit, als ein Zeichen der Bescheidenheit, leicht das Wohlwollen des Zuhörers erweckt.20
Das allmähliche Überwinden der Befangenheit geschieht teils durch Übung, Gewöhnung an das anfangs Ungewohnte, teils auch durch vernünftige Reflexion. Eine solche wandte bekanntlich schon Sokrates gegenüber seinem talentvollsten Schüler Alkibiades an, der ihm diese seine Scheu vor dem öffentlichen Reden klagte, womit damals ein völliger Ausschluss von allen Staatsgeschäften verbunden war. Sokrates fragte ihn, ob er sich geniere, mit einem Schuster zu reden. »Nein!« war die Antwort. – Aber vielleicht mit einem Schneider? – »Auch das nicht.« – Oder mit einem sonstigen Gewerbetreibenden? – »Nicht im geringsten.« – Nun, dann solle er sich immer denken, die gesamte Zuhörerschaft bestehe aus lauter solchen einzelnen Leuten. Sokrates hätte vielleicht beifügen können: Und er solle sich direkt angewöhnen, das Wort an einen bestimmten seiner Zuhörer zu richten. Auf solchen Reflexionen beruhen die wesentlichsten Hilfsmittel gegen die Befangenheit.
Das Hauptsächlichste derselben ist jedoch diejenige Geistesrichtung, von der überhaupt das Gelingen unserer Taten in der Welt zumeist abhängt, wonach man nicht für sich, zu eigenem Nutzen, namentlich nicht zu eigener Ehre und Selbsterhöhung redet, sondern immer nur für Andere, um der Sache willen, sogar mit möglichster Vermeidung jedes Nebengedankens an die eigene Person. Denn die Befangenheit stammt zum größten Teil aus dem Gedanken: »Wie werde ich’s machen? Werde ich gut reden, nicht stecken bleiben, bei niemand anstoßen, jedermann befriedigen?« Es sind die Nebengedanken, die beständigen Selbstbetrachtungen, die unsicher machen, die Doppelreflexion in der Rede, mit der jemand nicht einmal ein guter Schauspieler, geschweige denn ein rechter Redner wird.21
Sowie der Mensch im Leben gar nicht an sich selbst denkt, fühlt er sich sofort kräftiger, unbefangener und unabhängiger der Welt gegenüber. Aber die liebe Eitelkeit, der Wunsch, bewundert zu werden, der bei den Rednern zuweilen vorkommt, steht da eben ein wenig im Wege. Das ist ja überhaupt der lästigste aller unserer kleinen Tyrannen und Feinde der menschlichen Entwicklung.22
Man kann aber der Befangenheit auch äußerlich ein wenig zu Hilfe kommen.
Eine solche natürliche Hilfe ist zunächst eine mäßige (nicht absolute) Kurzsichtigkeit. – Sieht man niemanden, nur eine dunkle Masse vor sich, so spricht man leicht zu gleichgültig und zu mechanisch, ohne rechtes Interesse und ohne das belebende Gefühl, verstanden zu werden, wovon später die Rede sein wird. Sieht man dagegen deutlich sehr viele Gesichter, so wirkt dies durch die unvermeidliche Bewegung und Verschiedenheit derselben leicht zerstreuend. Der günstigste Fall für den Redner, den er, soweit möglich, auch künstlich herbeiführen muss, ist daher der, wenn er die erste Reihe seiner Zuhörer deutlich sieht und das Wort in Gedanken an dieselbe richtet. Bei öfter sich wiederholenden Reden, z. B. akademischen Vorlesungen, ist es daher bekanntermaßen sehr angenehm, wenn die Zuhörer nicht zu entfernt und wenn immer die nämlichen auf der ersten Bank sitzen; an diese gewöhnt sich das Auge, sie werden dem Redner allmählich familiär und erleichtern ihm sehr die Aufgabe. Bei Gelegenheitsreden kann das natürlich nicht immer eingerichtet werden, doch sorgt man in England z. B. dafür, dass die nächsten Freunde des Redners mit ihm auf der nämlichen Plattform erscheinen, so dass er ein sympathisches Publikum unmittelbar um sich hat.
Für einen jungen Redner, z. B. einen Pfarrer, der seine erste Predigt, oder einen Juristen, der sein erstes Plädoyer hält, ist es sehr vorteilhaft, wenn er in der ersten Reihe seiner Zuhörer nicht zu viel unbekannte und vielleicht gleichgültige, noch weniger aber bekannte und kritisch gestimmte23 Leute sieht, sondern solche, mit denen er gerne und unbefangen über den nämlichen Gegenstand reden würde und deren lebhaftes Interesse an ihm und an der Sache er voraussetzen darf. Dagegen kann selbst ein geübter Redner durch Leute aus dem Konzept gebracht werden, die ihn etwa verächtlich fixieren oder mit großen Fernrohren beschauen oder etwa gar gähnen oder miteinander sprechen.24
Damit der Redner sich möglichst »à son aise« [wohl] fühle, muss ihm auch, wenn tunlich, das Lokal und die Situation bekannt sein, in der er zu sprechen hat. Bei größeren Reden ist dies schon deshalb notwendig, weil man z. B. in manchen Kirchen gegen gewisse Wände oder Säulen sprechen muss, damit der Ton nicht zu sehr verhalle und der Redner unnötig und vorzeitig sich ermüde. Aber auch abgesehen davon wird ein Redner leicht, im Anfang wenigstens, etwas befangen, wenn ihm das Lokal ganz neu, der Standpunkt zu niedrig oder zu hoch, das Licht zu grell oder zu schwach ist, oder wenn er die Notwendigkeit, leiser oder lauter zu sprechen, erst im Laufe der Rede erfahren muss und anfänglich nicht verstanden wird.25
Das sind gewissermaßen die negativen Hilfsmittel gegen die Befangenheit. Es gibt aber auch noch ein sehr großes positives: ein aufmerksames und wohlwollend gestimmtes Publikum. Das belebt jeden Redner und nimmt ihm die anfänglich vielleicht vorhandene Schüchternheit. Daher besteht die Hauptaufgabe des Redners, der sich bei seiner Arbeit wohlfühlen will, darin, sein Publikum bald aufmerksam und wohlwollend zu stimmen und sodann beständig in dieser Stimmung zu erhalten.
Dazu gibt es verschiedene Mittel, abgesehen von dem Gegenstand der Rede, der natürlich, wo es geschehen kann, richtig für die gegebene Zuhörerschaft zu wählen ist. Der Hauptgesichtspunkt ist sehr einfach: Vermeide, langweilig zu werden. »Tous les genres«, sagt ein berühmter Schriftsteller vom Stil, »sont bons, hors le genre ennuyeux.« [Alle Arten sind gut, mit Ausnahme der langweiligen.] In, wenn möglich, noch höherem Grade gilt dies von dem mündlichen Vortrage. Näher ausgeführt heißt es: Man muss suchen, den Zuhörer selbsttätig zu machen und zu erhalten. Er muss nicht passiv hören, sondern fortdauernd mit eigenen Gedanken der Rede folgen; entweder also bei sich sagen: »Richtig, das ist so, das habe ich auch schon so gedacht«, oder: »Wahr, möglich; das will ich mir für künftig merken«, oder er mag auch opponieren, nur sich beteiligen. Der Zuhörer ist ja gleichsam das Instrument, auf dem der Redner spielt, und je zweckentsprechender das Instrument ist, desto besser kann die Rede werden.
Der höchste Erfolg eines Redners ist es, wenn diese Selbsttätigkeit des Hörers den Grad erreicht, bei dem er sich selbst vergisst, um zuletzt in gehobener Stimmung, leuchtenden Blickes, davonzugehen, weil er seinen eigenen besseren Menschen gefunden hat.26