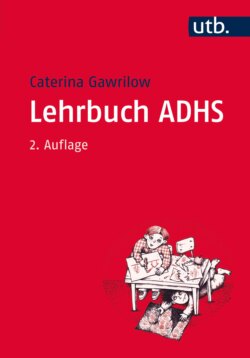Читать книгу Lehrbuch ADHS - Caterina Gawrilow - Страница 11
Оглавление3 Komorbide Störungen
Komorbide Störungen, also Störungen die im Sinne einer Doppel- bzw. Mehrfachdiagnose neben der ADHS zusätzlich vorliegen, sind bei ADHS-Betroffenen eher eine Regel als eine Ausnahme. Nachgewiesenermaßen ist es oft schwieriger, bei den ADHS-Betroffenen mit dominanter Hyperaktivität und Impulsivität solche komorbiden Störungen zu diagnostizieren: Bei hyperaktiven und impulsiven Kindern mit ADHS werden komorbide Störungen also häufig übersehen. Dass Menschen mit ADHS hochgradig impulsiv sind, führt weiterhin dazu, dass zusätzliche (komorbide) externalisierende bzw. extraversive Störungen und Verhaltensweisen zu erwarten sind: Die Betroffenen handeln unüberlegt, aggressiv und oppositionell.
Aber auch internalisierende bzw. intraversive Störungen und Verhaltensweisen sind häufig. Dazu gehören z. B. affektive Störungen, wie depressive und Angststörungen. Des Weiteren zeigen Kinder mit ADHS mit Eintritt in die Grundschule auch oft Lern- und Leistungsstörungen. Sobald komorbide Störungen im Spiel sind, wird eine ADHS-Diagnose erschwert, da der Diagnostiker erkennen muss, ob tatsächlich eine komorbide Störung vorliegt oder eine Differentialdiagnose erstellt werden muss (→ Kapitel 4). Alle komorbiden Störungen stellen für die Entwicklung der Betroffenen einen zusätzlichen Risikofaktor dar. Dies bedeutet, dass der Verlauf der ADHS für Patienten mit zusätzlichen komorbiden Erkrankungen zumeist schwerwiegender und beeinträchtigender ist als für Patienten ohne komorbide Erkrankungen.
Bauermeister und Kollegen (2007) sind in einer empirischen Untersuchung der Frage nachgegangen, ob auch bei der ADHS eine „Illusion des Klinikers“ vorliegt. Diese Illusion beschreibt die Tatsache, dass sich klinische Studien meist auf Stichproben beziehen, deren Patienten chronische und schwerwiegende Verläufe der Störung bzw. Erkrankung zeigen. Aus diesem Grund haben Bauermeister und Kollegen in einer umfassenden Studie zur Komorbidität der ADHS nicht nur klinische sondern auch Stichproben aus dem Feld miteinbezogen. Das Ergebnis zeigt, dass die Muster komorbider Störungen der ADHS in beiden Stichproben recht ähnlich sind – auch wenn sich die jeweiligen Prävalenzen unterschieden (Tab. 3.1 und Tab. 3.2).
Komorbide Störungen sind bei der ADHS die Regel: Insgesamt weisen ca. 2 / 3 der Kinder mit ADHS neben den Kernsymptomen für die ADHS noch weitere Störungen auf. Sobald komorbide Störungen im Spiel sind, wird eine ADHS-Diagnose erheblich erschwert.
Tab. 3.1: Häufigkeit komorbider Störungen der ADHS
| Quelle | Häufigkeit der komorbiden Störungen |
| Bird et al. (1994) | 94,8 % der Kinder mit ADHS haben eine oder mehrere komorbide Erkrankungen. |
| Willcutt et al. (1999) | 76 % der Kinder mit ADHS haben mindestens eine komorbide Erkrankung |
| Szatmari et al. (1989) | 44 % der Kinder mit ADHS haben eine weitere Störung. 43 % der Kinder mit ADHS haben zwei oder mehrere komorbide Störungen. |
| Kadesjö / Gillberg (2000) | 87 % der Kinder mit ADHS haben eine weitere Störung. 67 % der Kinder mit ADHS haben zwei oder mehrere komorbide Störungen. |
| Wilens et al. (2002) | 79 % der Schulkinder (und 74 % der Vorschulkinder) mit ADHS haben mindestens eine komorbide Erkrankung. |
| Bauermeister et al. (2007) | 30 % (34 %) der Kinder mit ADHS haben eine weitere Störung. 24 % (39 %) der Kinder mit ADHS haben zwei oder mehrere komorbide Erkrankungen (Gemeinde-Stichprobe, in Klammern: klinische Stichprobe). |
| Ghanizadeh et al. (2008) | 90 % der Kinder mit ADHS haben eine oder mehrere komorbide Erkrankungen. |
3.1 Externalisierende Störungen
Kinder mit ADHS zeigen oft aggressives und dissoziales Verhalten als komorbide Symptome. Besonders häufig kann bei Kindern mit ADHS auch die oppositionelle Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert werden. Typisch für diese Kinder ist, dass sie oft streiten – z. B. mit den Eltern oder Lehrern – und nicht gehorchen. Weiterhin treten häufig Ärgerperioden auf: Das Kind schreit und ist schwer zu beruhigen. Die oppositionelle Störung des Sozialverhaltens kann man auch daran erkennen, dass die Kinder gerne andere ärgern und sich leicht durch andere ärgern lassen. Zudem machen sie oft andere für die eigenen Fehler verantwortlich.
Die ICD-10 wird dieser auffallenden Koppelung der ADHS mit oppositionellen Verhaltensweisen durch die mögliche Diagnose „hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens“ gerecht (→ Kapitel 2 und 11). Diese Diagnose drückt an sich die Überlappung beider Symptombereiche aus. Tritt eine solche Störung des Sozialverhaltens als komorbide Störung besonders früh ein, ist es umso wichtiger, mittels geeigneter Therapiemaßnahmen einzugreifen: Diese Kinder zeigen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung weiterer Störungen wie einer Substanzabhängigkeit oder einer antisozialen Persönlichkeit (Döpfner 2003). Insgesamt ist es also für die Therapieplanung von großer Bedeutung, ein Profil eventuell vorhandener komorbider Störungen zu erstellen.
Tab. 3.2: Häufigkeit bestimmter komorbider Störungen bei der ADHS
| Quelle | Häufigkeiten bestimmter komorbider Störungen in % |
| Bauermeister et al. (2007) | Störung des Sozialverhaltens: 13.18 (10.22)*Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten: 38.89 (61.19)Angststörungen: 24.43 (33.51)Depressive Störungen: 9.27 (22.73)(Gemeinde-Stichprobe, in Klammern: klinische Stichprobe) |
| Ghanizadeh et al. (2008) | Depressive Störungen: 7.4Angststörungen: 28.4Spezifische Phobien: 16.0Sozialphobie: 1.2Verhaltensstörungen: 60.5Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem Verhalten: 59.3Störung des Sozialverhaltens: 13.6Enuresis: 11.1Enkopresis: 1.2Tic-Störungen: 21.0Substanzmissbrauch (Zigaretten, Opium): 1.2Nägelkauen: 38.3 |
* Anmerkung: Werte in Klammern entstammen einer klinischen Stichprobe (Bauermeister et al. 2007)
Antisoziale Verhaltensstörungen und die ADHS: Überlappung und Differenzierung auf neuropsychologischer Ebene
Antisoziale Verhaltensauffälligkeiten (wie z. B. die oppositionelle Störung des Sozialverhaltens) überlappen sich häufig mit der ADHS und treten gemeinsam, also komorbid, auf. Bislang gibt es wenig Forschung zur Frage, welche exekutiven Funktionsmuster (→ Kapitel 8) die beiden Störungen voneinander differenzieren. In einer aktuellen Studie fanden Hobson und Kollegen (2011) beim Vergleich von Kindern mit reinen sozialen Verhaltensstörungen, Kindern mit ADHS und zusätzlichen sozialen Verhaltensstörungen und Kontrollkindern ohne Störungen heraus, dass soziale Verhaltensstörungen mit „heißen“ exekutiven Funktionen, also mit Funktionen, die belohnungsbasiert sind, im Zusammenhang stehen. Diese Gruppe von Kindern zeigt in experimentellen Aufgaben Reaktionen, die stark auf Belohnungen fokussieren. Weiterhin sind soziale Verhaltensstörungen auch mit bestimmten Mustern „kalter“ kognitiver exekutiven Funktionen assoziiert, die unabhängig von der ADHS zu sein scheinen. Weitere Forschung und vor allem empirische Studien, die zusätzlich noch eine reine ADHS-Gruppe einschließen, sind jedoch notwendig.
3.2 Internalisierende Störungen
Kinder mit ADHS können auch unter zusätzlichen internalisierenden Störungen leiden. Zu diesen Störungen gehören beispielsweise affektive Störungen (z. B. Depressionen) mit einer Häufigkeit von 10–40 % und Angststörungen mit 20–25 % unter den ADHS-Kindern.
3.3 Lern- und Leistungsstörungen
Kinder mit ADHS zeigen häufiger als Kinder ohne ADHS Störungen wie Legasthenie, d. h. eine massive und lang andauernde Störung des Erwerbs der Schriftsprache. Die Betroffenen haben Probleme mit der Umsetzung der gesprochenen zur geschriebenen Sprache und umgekehrt. Auch die Dyskalkulie, d. h. eine Entwicklungsverzögerung des mathematischen Denkens bei Kindern und Jugendlichen (und auch Erwachsenen), ist eine häufige komorbide Störung von Kindern mit ADHS.
Auch ohne das Vorliegen einer diagnostizierten Teilleistungsstörung können exekutive Funktionsdefizite und Arbeitsgedächtnisdefizite bei Kindern mit ADHS zu Schwierigkeiten führen, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden (→ Kapitel 8).
Peter, 12 Jahre, ADHS mit komorbider LRS
Peter ist jetzt 12 Jahre alt und besucht die 6. Klasse einer Hauptschule. Bereits im Kindergarten fiel Peter als lebhaftes und umtriebiges Kind auf – Peters Familie und vor allem sein Großvater ordneten dieses Verhalten jedoch nie als problematisch ein, schließlich war Peters Vater als Kind auch ein richtiger „Wildfang“. Mit der Einschulung begannen dann die Probleme: Peter hatte große Schwierigkeiten, Lesen und Schreiben zu erlernen und sich überhaupt auf den Unterricht zu konzentrieren. Permanent war er in Bewegung, störte dabei oft die Mitschüler und Mitschülerinnen und den Unterrichtsablauf, was schnell dazu führte, dass Peters Eltern Kontakt mit dem lokalen Sozialpädiatrischen Zentrum aufnahmen, welches die Diagnosen ADHS und LRS stellte. Peters Eltern entschieden sich zunächst gegen eine medikamentöse Therapie; Peter nahm regelmäßig an Konzentrations- und Lese-Rechtschreibtrainings teil. Die Probleme in der Schule blieben aber bestehen, obwohl vor allem Peters Klassenlehrerin sich engagierte, gute Lösungen zu finden. Nach diversen klärenden Gesprächen mit der Klassenlehrerin und den Eltern der Mitschüler (unter anderem hatte die Klassenlehrerin eine befreundete Schulpsychologin zu einem Elternabend eingeladen, die über das Thema „ADHS in der Schule“ referierte), lief es in der Schule für Peter und die Klasse wieder besser: Seine Klassenlehrerin wusste nun, welche Strategien sie in welcher Situation anwenden konnte, um Peter (und auch die anderen Kinder) zu motivieren. Mit einer Realschulempfehlung ging Peter aus der Grundschule – das erste Schuljahr an der weiterführenden Schule entwickelte sich jedoch schnell zur Katastrophe. Für die Eltern und auch den behandelnden Arzt war nun klar, dass eine Medikation unbedingt erwogen werden sollte, weshalb Peter zur exakten Titrierung der MPH-Dosierung für einige Wochen stationär aufgenommen wurde. Danach waren die Probleme an der Schule nicht gelöst: Nach wie vor gab es Ärger mit den Lehrern und Mitschülern. Zur Unkonzentriertheit und den Lese-Rechtschreibproblemen, die dank der Medikation, sofern Peter seine Tabletten eingenommen hatte, besser wurden, kamen nun soziale Probleme hinzu. Der einzige Freund, den Peter in seiner neuen Schulklasse gefunden hatte, war Jan, der gerade sitzengeblieben und aufgrunddessen der zweite Außenseiter der Klasse war. Außerdem kam Peter mit seinem neuen Klassenlehrer überhaupt nicht zurecht: Die beiden harmonisierten sich einfach gar nicht und Peter hatte immer das Gefühl, missverstanden zu werden. Irgendwann schaltete sich der Schulleiter ein und empfahl den Wechsel auf die nahegelegene Hauptschule – Peters Eltern und Peter selbst waren zu diesem Zeitpunkt so verzweifelt, dass sie dies tatsächlich als Chance sahen. Und wirklich: In seiner neuen Klasse an der Hauptschule blühte Peter auf. Jedoch bleibt bei den Eltern das schlechte Gefühl, dass Peter eigentlich einen besseren Schulabschluss erreichen könnte.
3.4 Störungen, die von Beginn an parallel zur ADHS vorliegen vs. Störungen, die sich im Laufe einer ADHS entwickeln können
Eine bedeutsame und praktisch (klinisch) relevante Differenzierung komorbider Störungen der ADHS ist der Zeitpunkt des Auftretens dieser Störungen. Es kann zwischen solchen Störungen unterschieden werden, die gleichzeitig mit der Primärdiagnose ADHS diagnostiziert werden oder die in Folge der Primärdiagnose ADHS entstehen.
Die oben berichteten und erläuterten komorbiden Störungen treten zumeist gleichzeitig mit der ADHS erstmals auf. Man kann also nicht davon ausgehen, dass die ADHS-Symptome bewirken, dass sich diese weiteren Störungen entwickeln. Daneben kann es jedoch auch dazu kommen, dass zunächst eine ADHS und im späteren Verlauf weitere Störungen auftreten. Dies spielt besonders bei der ADHS des Erwachsenenalters eine Rolle (→ Kapitel 10).
Erfolgt die ADHS-Diagnose beispielsweise nicht frühzeitig und wird die ADHS nicht behandelt, können Anpassungs- und Kompensationsprozesse an die ADHS zu einer Ausprägung weiterer Störungen führen.
Diese Unterscheidung ist von großer Bedeutung: Sind die weiteren Symptome im Sinne einer komorbiden Störung zu verstehen, dann ist eine separate Diagnostik und Behandlung dieser komorbiden Störung wichtig. Gehen die komorbiden Symptome jedoch mit der ADHS einher, so ist eine primäre Behandlung der ADHS wichtig und sollte im Fokus stehen. Wird hier die (primäre) ADHS behandelt, verschwinden in den meisten Fällen mit der Zeit auch die komorbid auftretenden Symptome.
3.5 Komorbide Störungen im Erwachsenenalter
Folgende komorbide Störungen können bei Erwachsenen mit ADHS auftreten:
Substanzmissbrauch oder Substanzabhängigkeit,
Persönlichkeitsstörungen (z. B. dissoziale, impulsive oder emotional-instabile Persönlichkeitsstörungen),
Affektive Störungen (z. B. bipolare Störung),
Angststörungen,
Tic-Störungen,
Teilleistungsstörungen (z. B. Legasthenie, Dyskalkulie),
Schlafstörungen.
Tatsächlich ist bei Erwachsenen mit ADHS die Prävalenzrate für Alkohol- und Drogenmissbrauch drei- bis vierfach höher als im Vergleich zu Erwachsenen ohne ADHS. Auch dissoziale Persönlichkeitsstörungen treten vermehrt auf. Patienten mit komorbiden Störungen des Sozialverhaltens bzw. dissozialen Persönlichkeitsstörungen haben ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Suchterkrankungen. Studien zur Prävalenz affektiver Störungen ergeben heterogene Ergebnisse (Krause / Krause 2005; Konrad / Günther 2007; Milberger et al. 1995). In Bezug auf das Auftreten von Angsterkrankungen scheint eine erhöhte Prävalenz zu bestehen. Weiterhin ist die subjektive Schlafqualität häufig vermindert (s. Exkurs zum Schlafverhalten bei Erwachsenen und bei Kindern mit ADHS → im Kapitel 10).
Exekutive Funktionen bei Erwachsenen mit ADHS und mit oder ohne komorbiden Störungen (Rohlf et al. 2012)
In einer eigenen Studie haben wir untersucht, ob exekutive Funktionsdefizite (→ Kapitel 8) von erwachsenen Patienten mit ADHS auf die ADHS oder auf komorbide Störungen zurückzuführen sind. Dazu haben wir folgende Gruppen verglichen: 18 Erwachsene mit ADHS-Mischtypus und weiteren komorbiden Störungen (ADHS+), 19 Erwachsene mit ADHS-Mischtypus ohne weitere komorbide Störungen (ADHS-) und 32 Erwachsene ohne ADHS. Die Ergebnisse zeigen signifikante Unterschiede zwischen Erwachsenen mit und ohne ADHS in den exekutiven Funktionen Shifting (d. h. Wechsel zwischen Aufgaben) und Arbeitsgedächtnis. Dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen ADHS+ und ADHS- gab, spricht dafür, dass die ADHS und nicht die jeweilige komorbide Störung für die Defizite in den exekutiven Funktionsaufgaben verantwortlich ist. Zudem entspricht die Verteilung der komorbiden Störungen in der Gruppe ADHS+ den zu erwartenden Komorbiditäten im Erwachsenenalter: Sechs Patienten litten unter Depressionen, vier Patienten unter Angststörungen, sieben Patienten zeigten Substanzmissbrauch (z. B. Alkoholabhängigkeit oder Cannabisabhängigkeit) und zehn Patienten hatten die Zusatzdiagnose Persönlichkeitsstörung (z. B. antisoziale, schizoide Persönlichkeitsstörung).
Die ADHS ist ein Störungsbild, welches häufig durch das Auftreten weiterer Störungen gekennzeichnet ist. Aktuelle Studien zeigen, dass bestimmte Profile exekutiver Funktionen typisch bzw. charakteristisch für die ADHS sind.
Freitag / Retz (2007): ADHS und komorbide Erkrankungen: Neurobiologische Grundlagen und diagnostisch-therapeutische Praxis bei Kindern und Erwachsenen.
Vertiefungsfragen
7. Warum sind komorbide Störungen bei der ADHS im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter problematisch?
8. Kann pauschal festgestellt werden, dass Kinder mit ADHS häufig komorbid an spezifischen Störungstypen leiden?
9. Welche verschiedenen Charakteristika komorbider Störungen sind bei Kindern einer klinischen Stichprobe oder einer Feldstichprobe zu erwarten?