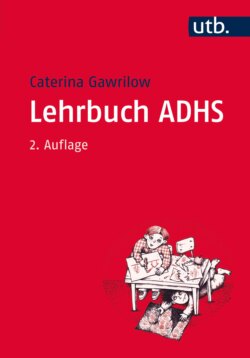Читать книгу Lehrbuch ADHS - Caterina Gawrilow - Страница 12
Оглавление4 Abgrenzung der ADHS von anderen Störungen und von einer alterstypischen Entwicklung
Neben komorbiden Störungen, also Störungen, die tatsächlich zusätzlich zu einer ADHS vorliegen, muss die ADHS von anderen Störungen abgegrenzt werden, zu denen sie eine große Ähnlichkeit hat. Weiterhin muss bei einer Diagnose vor allem bei jüngeren Kindern immer bedacht werden, dass es sich statt um eine ADHS auch um eine alterstypische Entwicklung handeln kann. Zudem muss Aufmerksamkeit als eine Fähigkeit angesehen werden, die bei jedem Menschen hin und wieder eingeschränkt sein kann. Nur wenn diese Einschränkungen chronisch, über längere Zeiträume hinweg, konsistent in verschiedenen Lebensbereichen auftreten und dabei psychisches Leiden verursachen (→ Kapitel 2), ist eine ADHS-Diagnose gerechtfertigt.
4.1 Abgrenzung der ADHS von anderen Störungen
4.1.1 Differentialdiagnosen im Kindesalter
Im Kindesalter muss die ADHS abgegrenzt werden von:
tiefgreifenden Entwicklungsstörungen,
Störungen des Sozialverhaltens, die sich in lang anhaltenden und ausgeprägten Formen der Dissozialität zeigen,
Anfallskrankheiten, also Epilepsien,
Anpassungsreaktionen auf außerordentlich belastende familiäre Verhältnisse oder schulische Überforderung,
emotionalen Störungen wie die agitierte Depression, bei welcher die Kinder depressive Verstimmungen durch aggressives und hyperaktives Ausagieren ausdrücken,
emotionalen Störungen wie Depressionen und Angststörungen.
Mit der Einführung des DSM-5 sind Autismus-Spektrum-Störungen kein Ausschlusskriterium mehr für eine ADHS Diagnose.
4.1.2 Differentialdiagnosen im Erwachsenenalter
Die ADHS im Erwachsenenalter muss vor allen Dingen von den folgenden Störungen und Erkrankungen differentialdiagnostisch abgegrenzt werden:
internistische und neurologische Grunderkrankungen (z. B. Schilddrüsenerkrankungen),
Medikamentöse Behandlungen, die als Ursache der Beschwerden angesehen werden können (z. B. mit Antihistaminika, Theophyllin),
Gebrauch psychotroper Substanzen.
Im Erwachsenenalter ist es ganz und gar nicht untypisch, dass Patienten aufgrund einer anderen Störung als der ADHS behandelt werden – obwohl sie in Wirklichkeit ADHS haben. Folgende Störungen müssen somit in Betracht gezogen werden. Diese können ebenfalls von differentialdiagnostischer Bedeutung sein (oder als zusätzliche komorbide Störungen vorkommen):
Substanzmissbrauch, -abhängigkeit,
Persönlichkeitsstörungen (z. B. dissoziale, impulsive bzw. emotional-instabile Persönlichkeitsstörungen),
Affektive Störungen (z. B. bipolare Störung),
Angststörungen,
Tic-Störungen,
Teilleistungsstörungen (z. B. Legasthenie, Dyskalkulie),
Schlafstörungen.
Was ist eigentlich Aufmerksamkeit und was sind Aufmerksamkeitsdefizite?
Die ADHS ist unter anderem eine Störung der Aufmerksamkeit – doch was ist Aufmerksamkeit eigentlich und haben nicht alle Menschen hin und wieder Schwierigkeiten ihre Konzentration und Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum hinweg (und sei es nur über die Dauer einer Vorlesung oder eines Vortrages) aufrecht zu erhalten?
“Everyone knows what attention is”, stellte William James (1890, 403) fest. In der weiterführenden Definition legte James Aspekte der Aufmerksamkeit dar, die noch heute in gängigen psychologischen Definitionen dieses Konstrukts eine große Rolle spielen: Aufmerksamkeit dient der Auswahl bzw. Selektion bestimmter Informationen mit dem Ziel, uns diese Informationen zugänglich zu machen. Dabei werden andere, interferierende Informationen ignoriert – die ausgewählten Informationen dienen uns als Grundlage für weitere Handlungen. Als Beispiel zur Erläuterung dieser Selektion und Handlungsrelevanz als Hauptfunktionen der Aufmerksamkeit wird häufig das Cocktailparty-Phänomen herangezogen: Stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine Cocktailparty. Wie bei solchen Partys üblich, sammeln sich Grüppchen von Besuchern an Tischen, im Raum, an der Bar und in jeder dieser Grüppchen findet eine Unterhaltung statt. Vermutlich läuft auch noch Musik, d. h. die Geräuschkulisse ist äußerst komplex. Mit großer Sicherheit werden Sie sich hauptsächlich auf die Gespräche in Ihrer Gruppe konzentrieren, um dem Gesprächsfaden folgen zu können. Erwähnt nun aber jemand in einer der anderen Grüppchen Ihren Namen, werden Sie (vorausgesetzt Sie können dies akustisch wahrnehmen) Ihre Aufmerksamkeit in den nächsten Minuten wahrscheinlich komplett zu dieser Gruppe richten, um zu erfahren, was dort über Sie gesprochen wird. Das nennt man das Cocktailparty-Phänomen, welches eindrücklich beschreibt, wie selektive Aufmerksamkeit funktioniert.
Aufmerksamkeit hat also die Funktion, Informationen auszuwählen, die dann handlungsrelevant werden – Sie hören Ihren Namen (wählen also diese Information aus) und entscheiden sich im Anschluss, nicht mehr dem Gespräch in Ihrer Gruppe, sondern dem Gespräch im Nachbargrüppchen zu folgen.
Dieser Prozess kann bewusst oder unbewusst ablaufen und hat bei allen Menschen begrenzte Kapazitäten. Vermutlich ist diese Schwelle, bis zu welcher aus Informationen die richtigen selektiert werden, die zum Handeln führen, bei Patienten mit ADHS geringer. Dies spiegelt sich auch in den Erkenntnissen zu exekutiven Funktionen und der ADHS wider (→ Kapitel 8). ADHS-Betroffene zeigen zum Beispiel große Defizite in Aufgaben der Erfassung von Reaktionshemmung. Sie haben also Schwierigkeiten damit, auf bestimmte Reize zu reagieren, aber die Reaktion auf andere Reize willentlich zu unterdrücken. Diese Aufgaben dienen zur Erfassung der Aufmerksamkeit, da auch hier die Anforderung besteht, relevante Informationen von nicht relevanten Informationen zu unterscheiden und die relevanten Informationen für die folgende Handlung zu nutzen. Auch Menschen ohne ADHS können Schwierigkeiten mit solchen Aufgaben haben, zum Beispiel dann, wenn sie unausgeschlafen und müde sind, gerade eine starke kognitive Belastung hinter sich haben (z. B. gerade eine anstrengende Klausur geschrieben haben) oder kein Interesse mehr an der Aufgabe haben, weil diese zu lange dauert.
Aufmerksamkeit ist generell eine begrenzte Ressource – Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS können schlechter als andere Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf diese Ressource zurückgreifen.
4.2 Abgrenzung der ADHS von einer alterstypischen Entwicklung
Bei der Diagnosestellung der ADHS wird gefordert, dass die Störung „in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenem Ausmaß“ vorhanden ist. Dies macht die Beurteilung durch einen Diagnostiker natürlich schwierig, weil einerseits nicht nur das Verhalten des Kindes an sich, sondern auch der Kontext dieser Verhaltensweisen erfasst und beobachtet werden muss. Dies bedeutet somit auch, dass in der Diagnostik ganz genau untersucht werden sollte, ob die störenden Verhaltensweisen, die das Kind zeigt, tatsächlich abweichend von einer alterstypischen Entwicklung sind.
Vor dem Eintritt in die Grundschule ist es aus diesem Grund besonders schwierig, eine ADHS-Diagnose zu stellen: Mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit können die störenden Verhaltensweisen mit dem Eintritt in die Grundschule, welcher in den meisten Ländern mit einem Alter von fünf bis sechs Jahren passiert, verschwinden. Jedoch sollten Kinder, die im Vorschulalter bereits sehr große ADHS-typische Schwierigkeiten zeigen, so früh wie möglich therapeutisch unterstützt werden. Dieses Dilemma – auf der einen Seite kann die ADHS im Vorschulalter eine alterstypische Reifung darstellen, die einfaches Abwarten erfordert und auf der anderen Seite sollten Kinder mit ADHS möglichst früh behandelt werden – kann nur durch eine umfangreiche und ausführliche Diagnostik aufgelöst werden (→ Kapitel 11). Im Rahmen dieser Diagnostik sollte das Verhalten des betroffenen Kindes mit dem Verhalten anderer Kinder in seiner Kindergartengruppe verglichen werden.
4.2.1 Der Einfluss des relativen Lebensalters
Aktuelle Analysen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, eine ADHS-Diagnose zu erhalten, vom relativen Lebensalter der Kinder abhängt. In umfassenden Analysen von Daten zur Einschulung, zum Alter und zu einer möglichen ADHS-Diagnose von Kindern wurde festgestellt, dass die Kinder, die in ihrer jeweiligen Klasse die jüngeren Kinder sind, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, ADHS diagnostiziert zu bekommen. Dies bedeutet also, dass Kinder, deren Lebensalter jünger ist als das ihrer Klassenkameraden, in diesem Gefüge stärker dahingehend mit Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität auffallen, dass sie letztlich eine diagnostische Untersuchung erhalten, welche die Diagnose ADHS bestätigt. Eine Analyse gibt Hinweise darauf, dass dies auf Initiative der jeweiligen Lehrer und nicht der Eltern geschieht. Wichtig ist jedoch, dass dieses Phänomen in den ersten drei Grundschuljahren am stärksten zu beobachten ist. Danach verschwindet der Einfluss des relativen Lebensalters auf die ADHS-Diagnose, was bedeutet, dass es nach dieser Zeit eher irrelevant ist, ob ein Schüler im Vergleich zu den anderen in der Schulklasse relativ jünger ist.
Studien zur Bedeutung des relativen Lebensalters auf ADHS- Diagnose
In den letzten Jahren haben sich vor allem Wirtschaftswissenschaftler mit der Frage des Einflusses des relativen Lebensalters von Kindern auf das Erstellen einer ADHS-Diagnose beschäftigt. Zwei beispielhafte Studien sollen hier berichtet werden. Die Studie von Elder (2010) bedient sich den Daten einer großen Paneluntersuchung. In der Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort (ECLS-K) des National Center for Education Statistics der USA wurden Eltern- und Lehrerratings zu ADHS-Symptomen, ADHS-Diagnosen und ADHS-Therapien mit MPH erhoben. In die Befragung wurden zu Beginn 18.644 Kindergartenkinder aus über 1.000 Kindergärten im letzten Jahr vor der Einschulung einbezogen. Die erste Befragung fand im Herbst des letzten Kindergartenjahres 1998–1999 statt; im Frühjahr 1999, im Herbst und Frühjahr des Schuljahres 1999–2000 (die meisten Kinder waren in der 1. Klasse), im Frühjahr 2002 (3. Klasse), 2004 (5. Klasse) und 2007 (8. Klasse) fanden weitere Befragungen statt. Zu jedem Zeitpunkt wurden Daten von den Kindern, Eltern und Lehrern erfasst. In dieser Studie wurde festgestellt, dass das relative Lebensalter von Kindern einen starken Einfluss darauf hat, ob Lehrer bei diesen Kindern ADHS-Symptome wahrnehmen oder nicht. Konkret bedeutet dies: Bei Kindern, die im Vergleich zu ihren Klassenkameraden jünger sind (also in einem jüngeren Alter eingeschult worden sind als die anderen Kinder in der Schulklasse) wird von den Lehrern häufiger als bei anderen Kindern ADHS-Verhalten festgestellt. Diesen Effekt gibt es nicht bezüglich der Elternratings: Die Einschätzung des ADHS-Verhaltens durch die Eltern ist also nicht vom relativen Lebensalter abhängig. In dieser Studie hat das relative Lebensalter einen langfristigen Effekt: Die jüngsten Kinder in den Klassen 5 und 8 nehmen doppelt so häufig wie ihre Klassenkameraden MPH zur Behandlung von ADHS ein. Die Ergebnisse dieser Analyse sind unabhängig vom sozioökonomischen und Migrationshintergrund der Kinder.
Evans, Morrill und Parente (2010) führten eine weitere Analyse durch, in die sie Daten verschiedener großer, amerikaweiter Untersuchungen einbezogen (National Health Interview Survey, Medical Expenditure Panel Survey, Daten einer privaten Krankenversicherung). In allen drei Stichproben stellten die Autoren fest, dass Kinder, deren 5. Geburtstag nach dem cut-off Termin für den Schuleingang ist (und die aus diesem Grund bei der Einschulung etwas älter sind als ihre Klassenkameraden) signifikant seltener mit ADHS diagnostiziert werden und auch seltener aufgrund einer ADHS behandelt werden. Der Einfluss des relativen Lebensalters auf eine ADHS-Diagnose konnte also nochmals bestätigt werden.
Die Studien zum Zusammenhang des relativen Lebensalters und der ADHS-Diagnose können jedoch keine Aussagen darüber machen, ob ein Kind, welches erst ein Jahr später eingeschult (also die Einschulung „zurückgestellt“) wird, eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine ADHS-Diagnose hat, als wenn es früher eingeschult wird. Eine bedeutende Schlussfolgerung lässt sich jedoch vor allem aus der Studie von Elder (2010) ziehen: Da anscheinend vor allem Lehrer geneigt sind, bei Kindern, die im Vergleich zu ihren Schulkameraden jünger sind, eine ADHS zu vermuten, sollte die ADHS-Diagnostik so differenziert wie möglich sein. Nicht nur eine Einschätzung der Lehrer, sondern auch der Eltern und „objektiver“ Beobachter ist notwendig (→ Kapitel 11).
Vertiefungsfragen
10. Was kennzeichnet typische und beeinträchtigte Aufmerksamkeitsprozesse?
11. Wie sollte ein Diagnostiker mit dem Dilemma umgehen, dass ADHS möglichst früh festgestellt und behandelt werden sollte – aber gleichzeitig auch Ausdruck einer alterstypischen Entwicklung sein könnte?
12. Welchen Einfluss hat das relative Lebensalter auf eine ADHS-Diagnose?