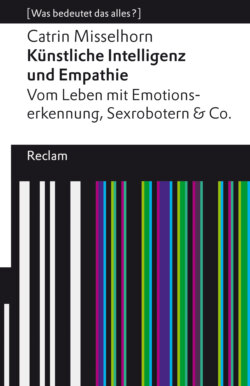Читать книгу Künstliche Intelligenz und Empathie. Vom Leben mit Emotionserkennung, Sexrobotern & Co - Catrin Misselhorn - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Was sind Emotionen?
ОглавлениеGehen wir von unserem Alltagsverständnis von Emotionen aus, so scheint es sich um episodische Reaktionen zu handeln, denen wir weitgehend passiv unterliegen, etwa wenn wir von Panik ergriffen, vor Freude überwältigt oder von Schuldgefühlen erdrückt werden. Mit episodisch ist gemeint, dass sich Anfang und Ende einer Emotion relativ eindeutig bestimmen lassen.
Außerdem umfassen Emotionen zumeist Formen körperlicher Erregung. Dazu gehören etwa erhöhter Puls, Erröten, Schweißbildung oder Tränenfluss. Im Unterschied zu anderen körperlichen Vorgängen wie etwa der Verdauung sind diese körperlichen Erregungszustände typischerweise mit einer bestimmten subjektiven Erlebnisqualität verbunden. Es fühlt sich auf eine bestimmte Art und Weise an, Freude zu empfinden, traurig oder wütend zu sein. Diese subjektive Erlebnisqualität wird in der philosophischen Debatte auch als phänomenales Bewusstsein bezeichnet und ist nicht zwangsläufig an das Auftreten körperlicher Erregung gebunden.
Außerdem beziehen sich Emotionen auf ein Objekt. Man kann fragen: Worüber ist Anne wütend? Wovor fürchtet sich Julian? Worüber freut sich Paul? Die Antworten könnten beispielsweise lauten: Anne ist wütend auf Franz, weil er ihren Stift absichtlich zerbrochen hat. Julian fürchtet sich vor dem Hund. Paul freut sich über das Buch, das Marie ihm zum Geburtstag geschenkt hat. Eine solche Bezugnahme auf ein Objekt wird in der philosophischen Emotionstheorie als Intentionalität bezeichnet.
Der Begriff der Intentionalität wird manchmal auch im Sinn von Absichtlichkeit verwendet. Doch damit hat der Objektbezug von Emotionen nichts zu tun. Der weitgehend passive Charakter von Emotionen schließt aus, dass wir sie absichtlich herbeiführen. Wir können nicht direkt beabsichtigen, uns zu freuen, wenngleich wir natürlich absichtlich nach Objekten suchen können, die Freude in uns auslösen.
Die Bezugsobjekte von Emotionen bezeichnet man als intentionale Objekte. Diese Objekte müssen nicht immer konkrete materielle Gegenstände sein: Man kann auch über die Klimakrise besorgt sein oder eine Idee bewundern. Wichtig ist jedoch, dass die Bezugsobjekte von Emotionen auf eine ganz bestimmte Art und Weise gegeben sind.
Nehmen wir an, Julia ist traurig darüber, dass Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft in der Vorrunde ausgeschieden ist. Das Objekt ihrer Emotion ist nicht nur das Ausscheiden der Nationalelf als solcher. So könnte ein Anhänger einer anderen Mannschaft über dasselbe Ereignis hoch erfreut sein. Sie erachtet es vielmehr auf eine ganz besondere Art und Weise als schlecht, nämlich im Sinn eines Verlusts. Ihre Traurigkeit beinhaltet also eine negative Bewertung des Objekts als Verlust. Andere negative Bewertungen wären etwa Peinlichkeit (dann würde sie Scham empfinden), Kläglichkeit (dann würde sie Verachtung empfinden) oder Anstößigkeit (dann würde sie Ärger empfinden).
Die Art des Bezugsobjekts und seines Gegebenseins ist wichtig, um verschiedene Emotionen voneinander unterscheiden zu können. Die subjektive Empfindungsqualität allein reicht dafür nicht aus. So lässt sich der Unterschied zwischen der Scham und der Trauer über das Ausscheiden der Fußballmannschaft nicht allein anhand der subjektiven Erlebnisqualität ausmachen. Der Bezug auf ein intentionales Objekt ist auch verantwortlich dafür, dass Emotionen begründet oder unbegründet sein können. So wäre Julians Furcht vor dem Hund unbegründet, wenn dieser nicht gefährlich, sondern ganz sanftmütig ist.
Weiterhin sind Emotionen mit bestimmten Ausdrucksformen verbunden. Sie manifestieren sich in Sprache, Haltung, Gestik und Mimik und bewirken häufig bestimmte Verhaltensweisen. So führt Furcht zu Angriff, Flucht oder Erstarrung. Emotionen lassen sich anhand dieser Merkmale gut von anderen affektiven Phänomenen abgrenzen.
Stimmungen haben ebenso wie Emotionen eine subjektive Erlebnisqualität. Es handelt sich jedoch nicht um episodische Reaktionen, und sie verfügen nicht über Bezugsobjekte. Sie gehen auch nicht mit bestimmten körperlichen Veränderungen, Ausdrucksformen oder Verhaltensweisen einher. Emotionen sind auch von körperlichen Empfindungen (wie einem Prickeln oder Ziehen) zu unterscheiden. Körperliche Empfindungen sind zwar episodisch, sie haben aber typischerweise kein Bezugsobjekt und sind nicht mit spezifischen körperlichen Veränderungen, Ausdrucksformen oder Verhaltensweisen verbunden, sondern zeichnen sich vor allem durch ihre Erlebnisqualität aus.
Charakterzüge wie Extrovertiertheit, Offenheit oder emotionale Verletzlichkeit stellen ebenfalls keine Emotionen dar. Sie weisen keine der für Emotionen charakteristischen Merkmale auf, auch wenn sie etwas damit zu tun haben mögen, zu welchen emotionalen Reaktionen jemand in bestimmten Situationen tendiert.
Emotionstheorien unterscheiden sich darin, welche Merkmale von Emotionen sie als vorrangig betrachten und wie sie deren Wechselspiel verstehen. So kommt es für den Behaviorismus besonders auf die Verhaltensreaktionen an. Demnach wäre beispielsweise Furcht gleichzusetzen mit der Tendenz zu Flucht, Erstarrung oder Kampf. Somatische Theorien hingegen halten Emotionen für Wahrnehmungen körperlicher Veränderungen. Der Philosoph und Psychologe William James, auf den dieser Ansatz zurückgeht, prägte hierfür Ende des 19. Jahrhunderts den Slogan: Wir weinen nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen.6
Kognitivistische Theorien konzentrieren sich auf die intentionalen Objekte von Emotionen. In der gegenwärtigen Psychologie ist der Ansatz verbreitet, Emotionen als Interpretation und Bewertung (engl. appraisal) einer Situation vor dem Hintergrund gewisser Ziele, Wünsche, Überzeugungen und Erfahrungen zu verstehen. Solche Bewertungen umfassen etwa die Relevanz für die eigene Person oder Gruppe, den Neuigkeitswert des Ereignisses, die hedonische Qualität (›angenehm‹ oder ›unangenehm‹), die Relevanz für die eigenen Bedürfnisse und die Wahrscheinlichkeit des Eintretens.
Emotionen lassen sich durch jeweils spezifische Bewertungsmuster voneinander abgrenzen, die verhältnismäßig stabil sind. Diese Bewertungsmuster unterscheiden sich in ihrer Komplexität und in ihrem kognitiven Anspruch. Sie variieren von niederstufigen biologisch bestimmten Mustern bis hin zu kognitiv anspruchsvollen, kontext- und kulturabhängigen Prozessen. Die Bewertungstheorien finden auch in der emotionalen KI Anwendung.7 Gefühlstheorien (engl. feeling theories) hingegen verstehen die subjektive Erlebnisqualität als das entscheidende Merkmal von Emotionen. Da es zweifelhaft ist, ob Maschinen tatsächlich über subjektive Gefühlsqualitäten verfügen, ist dieser Ansatz in der emotionalen KI nicht verbreitet.
Tabelle 1: Emotionstheorien und affektive Phänomene