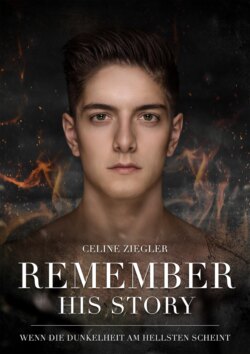Читать книгу REMEMBER HIS STORY - Celine Ziegler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5
Оглавление„Da hinten stehen die Schneeschippen und dort hinten unter dem Baum machst du den Schnee hin“, erklärt Ray, ein netter Kollege aus dem Hotel, mir meine nächste Aufgabe. Den Hinterhof vom Schnee befreien, der letzte Nacht in großen Mengen auf die Erde gerieselt ist. „Aber du musst auf die Blumen aufpassen. Dein Grandpa vergöttert diese Teile und wenn ihnen etwas zustößt, bin ich, glaube ich, sofort gekündigt.“
Wir lachen gemeinsam. „Das sollte kein Problem sein. Bei Blumen bin ich extra vorsichtig.“
„War ja klar, dass dieser Blumenfetisch in der Familie weitergegeben wurde. Also dann … Kann ich dich mit dem Schnee und den Schippen allein lassen?“
Ich nicke und nehme mir den Schneeschipper von der Hauswand. „Absolut.“
Kurz sieht sich Ray noch um, dann seufzt er. „Viel Spaß, du hast wirklich viel zu tun. Wenn du Hilfe brauchst, dann ruf einfach den Hausmeister, der hilft dir schon. Wer weiß, wo der wieder rumgeistert.“
Nur über meine Leiche, denke ich mir und fange an den ersten Schnee wegzuschippen.
„Wenn du fertig bist, dann komm zu mir in die Küche, da warten so einige Kartoffeln auf dich, die geschält werden müssen“, ruft Ray mir noch hinterher, bevor er wieder im Hotel verschwindet.
Ich vergrabe mein Gesicht mehr in meinem Wollschal und fahre mit dem Schneeschipper über den gepflasterten Hof, schmeiße dann den Schnee auf den Haufen unter dem Baum, von dem Ray gesprochen hat. Mein Arbeitstag ist schon fast vorbei und bisher ist mir Nathan noch nicht über den Weg gelaufen, worüber ich eigentlich glücklich bin, denn so plagt er mich nicht mit seinen beleidigenden Sprüchen oder zieht mich mit dem gestrigen Abend auf.
Allerdings habe ich sein Motorrad auch nicht auf dem Parkplatz gesehen, weswegen es auch sein kann, dass er gar nicht erst auf der Arbeit erschienen ist. Ob Nathan sich öfters mal erlaubt, einfach nicht zu kommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Grandpa ihm das oft durchgehen lassen würde und er seinen Job stattdessen dadurch schnell los wäre. Wahrscheinlich ist Nathan einfach nur intelligent genug, nicht mit dem Motorrad zu fahren, während alles zugeschneit ist.
Nachdem ich die Hälfte des Hofes schon freigeschaufelt habe, meine Finger mehr als eingefroren sind, weil ich meine Handschuhe vergessen habe, mache ich mich ans Blumenbeet. Ich nehme mir einen Besen, um die Alpenveilchen vorsichtig freizukehren. Normalerweise blühen sie erst im Februar, es ist beinahe ein Wunder, dass sie hier so bunt strahlen. Die Chance muss ich sofort nutzen.
Schnell gucke ich, ob ein Mitarbeiter mich sehen könnte, dann knie ich mich zu den Blumen und pflücke gleich zwei von den lila Blüten. Sachte schiebe ich sie in meine Jackentasche, damit sie nicht kaputt gehen. Schmunzelnd streiche ich über weitere Blumen und fühle mich sofort wohl. Blumen geben mir einfach gewisse Glücksgefühle, die mich so einiges vergessen lassen, warum auch immer. Wahrscheinlich weil ich damit meine Grandma verbinde und ich viele schöne Zeiten mit ihr erlebt habe, während wir Blumen in unsere Bücher geklebt haben. Im Eifer des Gefechts pflücke ich zwei weitere Blüten und lasse sie in meiner Jacke verschwinden. Man kann nie genug haben, vor allem weil bald Weihnachten ist und ich viele Bücher zu verschenken habe.
„Als Enkelin des Chefs ist das ganz schön unmanierlich“, ertönt plötzlich eine dunkle Stimme hinter mir und mir fällt ein Veilchen aus der Hand, weil ich mich so erschrecke.
Ich drehe mich um und blicke unmittelbar zu Nathan, der an der Hauswand gelehnt zu mir sieht. „N-Nathan“, stelle ich keuchend fest und stelle mich augenblicklich auf. „Was machst du denn hier?“
Er stößt sich mit den Händen in den Hosentaschen von der Wand ab und lässt sich auf eine Bank daneben fallen. „Ich soll dir helfen.“
„Okay … Und wirst du mir helfen?“
„Nein. Bis auf die Tatsache, dass du tatsächlich irgendwelche beschissenen Blumen aus dem Garten klaust, machst du das eigentlich gut. Ich werde hier sitzen und dir zugucken.“
„Ich, äh, ich habe sie nicht geklaut“, versuche ich, mich rauszureden, weil ich Angst bekomme, er könnte es Grandpa sagen und Grandpa ist wirklich sehr empfindlich, was seine Blumen angeht. Selbst vor mir würde er keinen Halt machen, mir eine Predigt zu halten oder mir eine Strafarbeit reinzudrücken.
Nathan hebt eine Braue. „Was hast du denn stattdessen mit den jetzt abgerissenen Blumen gemacht?“
Ich sehe zu ihnen, dann wieder zu ihm. „Ich habe sie mir … genommen.“
„Okay, du hast sie dir genommen. Zum Glück hast du sie dir nur genommen und nicht geklaut.“
Und schon geht er mir wieder mit seinen sarkastischen Sprüchen auf die Nerven. Keine zwei Minuten ist er hier, nimmt er mich erneut auf den Arm. Unerträglich in jedem Aspekt. „Solltest du mir nicht eigentlich helfen und aufhören, doofe Sprüche zu machen?“, meckere ich jetzt und nehme mir den Besen vom Boden.
Er zuckt nur gleichgültig mit einer Schulter. „Wie gesagt, du machst das auch gut ohne meine Hilfe. Du bist ein Naturtalent.“
Verärgert beginne ich wieder, mit dem Besen die Blumen vom Schnee zu befreien. „Übrigens habe ich gestern auch nur wenig Ärger von meinen Eltern bekommen, danke der Nachfrage.“
„Was interessiert es mich, was du mit deinen Eltern hast?“
„Es ist deine Schuld, dass ich zu spät nach Hause gekommen bin, nach Alkohol gerochen habe und mein Handy kaputt gegangen ist.“
„Nein, das ist ganz bestimmt nicht meine Schuld“, lacht Nathan auf. „Du hättest ja nicht mitkommen müssen. Und wenn du dich nicht so kindisch verhalten hättest, wäre dir auch die Scheiße mit dem Wodka erspart geblieben.“
Empört sehe ich ihn an und stampfe mit dem Besen auf. „Kindisch? Du scheinst kindisch mit erwachsen zu verwechseln. Es war kindisch, wie sich deine seltsamen Freunde verhalten haben, und erwachsen, dass ich diese Rauschmittel abgelehnt habe.“
„Rauschmittel“, amüsiert sich Nathan. „Du hörst dich an wie eine verdammte Nonne. Was ist nur los mit dir?“
„Was ist nur los mit dir? Du sitzt hier rum und beleidigst mich! Ich arbeite wenigstens, im Gegensatz zu dir.“
„Stell dich nicht so an. Ich arbeite hier schon länger als du, ein wenig Arbeit tut dir mal gut. Jetzt bekommst du eben nicht mehr den Arsch von deinen Eltern gepudert.“
„Ich bekomme den Arsch von meinen Eltern nicht gepudert“, verteidige ich mich und muss schon wieder aufhören, mit dem Besen die Blumen zu befreien, denn sonst zerquetsche ich sie noch, weil ich durch Nathan so geladen bin. „Du kennst mich doch gar nicht, also behaupte nicht so etwas!“
Wieder sieht Nathan mich ungläubig an. „Also bekommst du von deinen Eltern nicht alles, was du dir erwünschst?“
Sofort schießen mir tausend Dinge in den Kopf, die ich in meinem ganzen Leben von meinen Eltern bekommen habe, und muss Nathan gedanklich recht geben. Ich habe immer das bekommen, was ich wollte, und musste nie für etwas arbeiten. Zumindest nicht körperlich. Sie hatten Erwartungen an mich, wie gute Noten und den Violinen- und Klavierunterricht, aber sonst hatte ich alles, was mein Kinderherz begehrte. Doch natürlich würde ich das nie vor Nathan zugeben. Nur weil meine Eltern mehr Geld haben und ich nicht betteln musste, um das zu bekommen, was ich wollte, macht mich das nicht zu einem minderwertigeren Menschen.
„Verzogen nenne ich so etwas“, gibt Nathan noch hinzu und legt desinteressiert seinen Kopf in den Nacken, lässt ein paar Schneeflocken in sein Gesicht fallen.
„Verzogen?“, frage ich empört. „Nur weil deine Eltern anscheinend keine Ahnung hatten, wie man ein Kind erzieht, heißt das noch lange nicht, dass ich verzogen bin!“
Nathan sieht mich wieder an und schweigt für einen kurzen Moment. Seine Augen wirken mit einem Mal so leer, da ist keine Belustigung mehr, kein Sarkasmus, kein Zorn, nichts. „Okay, ich gebe auf“, sagt er schließlich und sein rechter Mundwinkel hebt sich ein wenig, jedoch bleiben seine Augen leer. „Meine Erziehung wurde vollkommen verkackt und du bist verzogen. Einigen wir uns darauf.“
Zweifelnd sehe ich ihn mit gerunzelter Stirn an. „Hör auf zu behaupten, ich sei verzogen, das bin ich nicht. Ich kann auch ein Leben ohne meine Eltern leben.“
„Ach ja? Welches denn?“ Sein plötzliches Interesse erschreckt mich fast.
„Zum Beispiel werde ich bald auf eine Musikhochschule gehen“, sage ich stolz und fange wieder an, mit dem Besen die Blumen freizuschippen. „In ein paar Wochen …“
„Ja, ist mir eigentlich scheißegal“, unterbricht Nathan mich und steht stöhnend auf. „Ich musste nur ein wenig Zeit schinden, damit der Chef denkt, ich hätte dir wirklich geholfen.“ Er geht zur Tür. „Viel Spaß noch.“ Und kurz bevor er durch die Tür verschwindet, dreht er sich noch mal um. „Und die Sache mit den scheiß Blumen ist noch nicht vergessen … Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dich nicht verraten werde.“
„Also notier dir bitte den 3. Februar“, sagt Misses Baskin, während ich meine Violine in meinem Koffer verstaue. „Du darfst den Vorspieltermin nicht verpassen. Geh am besten in der Woche nicht zu viel raus, damit du nicht krank wirst, das ist wirklich sehr, sehr wichtig.“
Eine weitere vierstündige Probe an einem weiteren Samstagabend mit weiteren Reden von Misses Baskin darüber, wie wichtig das Vorspiel ist und wie absolut grausam ich meine Sonate spiele, geht vorüber. Diese Probe war ich sogar noch schlechter als die ganze Woche. Dadurch, dass Mama und Misses Baskin mir noch mehr Druck mit dem Vorspiel in Birmingham machen, scheine ich umso unkonzentrierter.
Und dann ist da natürlich noch Nathan. Egal, wie wenig ich an ihn denken mag, tue ich es trotzdem. Die Art, wie er mit mir umgeht, empört mich mehr als genug und dass er gleichzeitig noch so viele Geheimnisse hat, die ich gerne lüften würde, nimmt mir einfach jegliche Konzentration. Ich weiß nicht, wieso, aber er ist interessant, auch wenn er stets aufmüpfig und gemein ist. Nur ob er auf eine positive Art interessant ist, würde ich nicht behaupten. Er ist interessant als Mensch an sich, wieso er so ist, wie er nun mal ist, ein Mysterium, das man gerne hinterfragen und näher betrachten würde, doch mehr nicht. Ich bin mir beinahe sicher, dass er diese Art schlechter Mensch ist, die kein Gewissen und jegliche Humanität schon vor Jahren abgelegt hat. Zumindest verhält er sich so. Ich sollte mich nicht mit so jemanden auseinandersetzen, doch irgendwas lässt meine Gedanken doch immer wieder zu ihm schweifen.
„Und sei morgen früh pünktlich um neun Uhr hier“, redet Misses Baskin weiter und sammelt die vielen Notenblätter ein. „Ich dulde diesmal keine Unpünktlichkeit wie die ganze letzte Woche.“
Ich bin nur einmal fünf Minuten zu spät gekommen, würde ich sie gerne korrigieren, doch ich nicke gehorsam und nehme meinen Koffer in die Hand. „Aber wenn ich pünktlich sein muss, dann sollten wir zehn Uhr machen. Morgen früh sind wir in der wöchentlichen Kirchenmesse, das wissen Sie doch.“
„Oh, stimmt.“ Sie hält mir den Ordner mit den Notenblättern hin. „Dann morgen um zehn Uhr. Pünktlich.“
„Versprochen, Misses Baskin“, sage ich und lächle ihr noch mal zu, bevor ich das Gebäude erschöpft verlasse.
Früher haben mir die Proben jeden Tag Spaß gemacht, doch heute ist es nur noch pure Folter, der ich nicht aus dem Weg gehen kann. Seit ich diesen Druck im Hinterkopf habe, weil ich unbedingt dieses Vorspiel schaffen muss, klappt gar nichts mehr. Selbst das Üben zu Hause bekomme ich nur halbherzig hin, weil mir die Lust und der Wille zu alledem einfach fehlen. Ich schaffe es ja doch nicht.
Doch weil der Tag nicht schon schlimm genug war, bekomme ich genau in der Sekunde einen Regentropfen ab, als ich den ersten Schritt nach draußen mache. Klasse. Der Weg nach Hause ist lang und meine Karte, um U-Bahn zu fahren, habe ich schlauerweise nicht dabei. Genervt halte ich mir den Koffer über den Kopf und gehe mit schnellen Schritten nach Hause. Ich laufe eine Abkürzung durch ein paar Gassen, damit ich schneller zu Hause bin, die ich sonst nicht laufe, weil ich es hier nicht mag. Es ist dreckig und hier stinkt es immer widerlich nach Einöde. Hier wohnen auch Leute, doch diese Menschen tun mir nur leid, denn hier zu wohnen, muss eine Plage sein.
Ich muss nur noch um eine Ecke laufen, dann habe ich es schon geschafft und ich komme wieder an die weniger gruseligen Stellen von Cardiff. Doch genau in der Sekunde, in der ich um die Ecke laufe, guckt mich ein Hund an. Ich bin tierlieb und es würde mich nicht stören, wenn ein streunender Hund vor mir steht, doch dieser Hund … Kann man so etwas Hund nennen? Man sieht ihm augenblicklich an, dass er aus dieser Gegend hier kommt, sein Fell ist zerpflückt und ihm fehlt das rechte Auge, das ihn noch angsteinflößender wirken lässt.
Ich bleibe stocksteif stehen und hoffe, dass er mir nichts tut, weil er mir genau in die Augen sieht und mich anknurrt. Als ich vorsichtig versuche, einen Schritt nach rechts vorne zu machen, um an ihm vorbeizulaufen, bellt er plötzlich lauthals und ich schrecke auf Anhieb auf, lasse einen leisen Schrei los, der mehr wie ein Wimmern klingt.
„Lieber Hund“, rede ich vor Angst zitternd mit ihm, als er mit gefletschten Zähnen und Sabber aus dem Maul laufend auf mich zukommt. „Ganz ruhig.“ Ich gehe ein paar Schritte zurück, während er mir immer näher kommt. Zu meinem Pech komme ich auch schon mit einer kalten Steinwand in Berührung, die den Abstand zwischen dem einschüchternden Tier und mir verringert.
Ich handle schnell. Ich renne so schnell ich kann nach links um eine Ecke, hoffe, ich komme irgendwo an, wo ich schnell verschwinden kann, doch mal wieder habe ich Pech. Ich stehe in einer Sackgasse. Der wildgewordene Hund folgt mir bellend und ich verstecke mich wie ein Kleinkind hinter einem Müllcontainer und bete, dass er jeden Moment verschwinden wird. Er steht einfach am anderen Ende der Sackgasse und starrt zu mir hinüber.
Und gerade als ich denke, er würde verschwinden, legt er sich seelenruhig auf den Boden und scheint zu warten. Worauf? Wahrscheinlich darauf, bis er mich endlich zu Tode beißen kann. Weil das noch nicht reicht und der Abend nicht noch schlimmer werden kann, höre ich ein polterndes Donnern und der Regen wird heftiger.
Ich setze mich in die Ecke der Sackgasse auf den dreckigen Boden und halte mir meine Jacke etwas über den Kopf, damit ich nicht noch nasser werde. Gleichzeitig kämpfe ich damit, nicht jeden Moment einen Herzinfarkt zu bekommen, weil Gewitter meine absoluten Erzfeinde sind.
Selbst nach fünfzehn Minuten und bereits eingefrorenen Gliedern sitzt der Hund noch immer dort und sieht mich an.
Ich will nach Hause.
Doch dann sehe ich einen Hoffnungsschimmer.
Jemand joggt an der Sackgasse vorbei. Schnell stehe ich auf. „Hallo?“, rufe ich. „Ich brauche Hilfe!“ Doch der Jogger joggt weiter und scheint mich nicht zu hören. Ich traue mich, etwas weiter zum Ende der Sackgasse zu laufen und hoffe, der Hund bleibt still. „Hallo! Bitte!“
Schließlich bleibt der Jogger stehen und durch die Dunkelheit erkenne ich, dass es ein Mann ist. Er kommt zurückgelaufen und scheint den Hund gar nicht gesehen zu haben, denn er geht einfach in die Sackgasse hinein.
Schnell gebe ich mich zu erkennen und rufe von weiter weg: „Können Sie mir helfen?“
Als der Mann näher kommt, erkenne ich ihn erst. Nathan. Was für ein verflixter Zufall. Natürlich muss er in solch einer Gegend herumlaufen.
„Honor?“, lacht er und kommt näher. „Was zur Hölle?“
Doch ich bin viel zu verängstigt durch den gruseligen Hund und das Gewitter über unseren Köpfen, um jetzt nicht glücklich darüber zu sein, dass jemand hier ist, sei es auch nur Nathan. „Nathan“, sage ich erleichtert und gehe mit schnellen Schritten auf ihn zu. „Zum Glück bist du da!“
„Zum Glück bin ich da? Bist du breit?“ Erst jetzt fallen mir seine Sportklamotten auf. Eng anliegende Hosen, schwarze Handschuhe und schwarzer Kapuzenpullover, darunter trägt er eine schwarze Mütze. Wie immer ganz in Schwarz.
„Bitte sei einmal nicht gemein“, flehe ich und schäme mich für mein jämmerliches Auftreten. „Kannst du mir einfach helfen, hier rauszukommen? Bitte … Auch wenn du mich nicht leiden kannst.“
Er schiebt seine Brauen zusammen. „Was hält dich davon ab, hier rauszukommen?“
Zitternd zeige ich hinter ihn zu dem schwarzen Hund, der wie ein Teufelshund durch die Dunkelheit wirkt.
Nathan sieht hinter sich, dann sieht er amüsiert zu mir. „Wegen des Hundes?“
Ich nicke und presse die Lippen aufeinander. Er muss wirklich denken, ich bin eine Heulsuse, doch ich kann nichts dagegen machen. Dieser Hund ängstigt mich und bei Gewittern kenne ich keine Scherze. „Bitte hilf mir einfach“, sage ich leise.
Man sieht ihm genau an, dass er einen Spruch auf den Lippen hat, ihn jedoch runterschluckt. Er nimmt zwei Finger zwischen die Lippen und ein lautes Pfeifen ertönt, was mich kurz aufschrecken lässt.
Der schwarze Hund kommt zu uns gerannt und Nathan dreht sich zu ihm um.
„Nathan, pass auf!“, warne ich schnell und verstecke mich hinter seinem Rücken, damit mich das Tier nicht angreift.
Doch er ignoriert meine Worte völlig und beugt sich zu dem Hund nieder.
Jedoch ziehe ich ihn schnell wieder nach oben, halte seinen Pullover zwischen meinen Fingern gekrallt. „Er wird dich angreifen!“
„Mach dich locker“, sagt Nathan und beugt sich wieder zu dem Hund, streichelt ihm kurz über die Schnauze. „Das ist meiner, mich wird er ganz bestimmt nicht angreifen.“
Mir klappt entsetzt die Kinnlade runter. Das soll Nathans Hund sein? Er streunt hier einfach umher und bellt wildfremde Menschen an, knurrt rum wie ein wildes Tier! Nun gut. Es könnte doch Nathans Hund sein, immerhin sind die beiden genau gleich. Nathan beleidigt auch ständig fremde Leute und verbreitet Angst und Schrecken.
„Allerdings kann ich dir nicht versprechen, dass er dich nicht angreifen wird“, fügt Nathan noch hinzu.
„Sehr witzig“, murmle ich und streiche mir eine nasse Strähne aus der Stirn. Immer wenn ich Nathan begegne, bin ich entweder in Arbeitsklamotten, durchnässt oder sehe fix und fertig aus. Er hat ein sehr schlechtes Bild von mir und mir gefällt das nicht. Und nicht mal zwei Sekunden später donnert und blitzt es laut, was mich leise aufkreischen lässt und mich gleichzeitig dazu zwingt, mich an Nathan zu krallen.
Doch er findet das ganz und gar nicht gut. „Man, was soll die Scheiße?“, flucht er und zieht seinen Arm von mir und geht einen Schritt weg. „Hast du irgendwelche Probleme? Du verhältst dich wie ein weinerliches Kleinkind.“
Sofort schäme ich mich für meine vielen Ängste. Ich kann doch nichts dafür. Konnte ich nie. „Tut mir leid. Ich hatte schon immer etwas mehr … ähm, Angst vor … na ja …“
„Unwetter?“, fragt Nathan mich halb belustigt, halb ernst.
Ich nicke peinlich berührt und sehe auf den Boden. Mir sollte so etwas nicht peinlich sein, immerhin hat jeder Mensch seine Ängste und meine größte Angst ist nun mal die vor Gewittern.
„Scheiße, du bist echt ein weinerliches Kleinkind“, höhnt Nathan und zieht sich seine Kapuze wieder über und dreht sich etwas weg. „Ich verschwinde.“
Und wieder einmal lässt er mich in der Kälte, klitschnass in der tiefsten Dunkelheit stehen. Was ein trauriges Déjà-vu. Deprimierender könnte es kaum sein. Ob ich je ein Wort mit ihm wechseln kann, ohne dass ich mich danach schlechter fühle als vorher? Ist der Stress mit Birmingham und meinen Proben nicht genug?
Niedergeschlagen schlappe ich zum Ende der Sackgasse und gehe die Straße entlang. Ich male mir aus, wie ich gleich zu Hause in meinem warmen Bett liege, wie Mama mich anmeckern wird, weil ich wieder so dreckig bin, doch dann wird es noch schlimmer. Ein Auto fährt mit viel zu schneller Geschwindigkeit an mir vorbei durch eine Schlammpfütze und bedeckt mich von oben bis unten mit Schlamm und Wasser. Entsetzt wische ich es mir aus dem Gesicht und will gerade meinen Violinenkoffer abstellen, da rutsche ich aus und falle geradewegs auf mein Hinterteil in die nächste Pfütze.
Ich könnte heulen. Nein, ich will heulen. Wie ein kleines Kind in den Schlamm trommeln, mit den Beinen strampeln und laut weinen. Verdammtes Schicksal. Verdammtes Karma. Was habe ich denn heute falsch gemacht?
Doch als ich gerade noch meine ersten Tränen aufhalten kann, steht jemand vor mir und hält mir seine Hand hin. Ich muss zweimal hinsehen, um mir auch sicher sein zu können, wer es wirklich ist.
„Steh auf“, sagt Nathan. Es wäre netter gewesen, wenn er es freundlicher gesagt hätte, doch es ist schon ziemlich nett für jemanden wie Nathan, mir überhaupt seine Hand hinzuhalten.
Ich ergreife benebelt seine Hand und sehe ihm in die Augen.
Ich weiß nicht, ob es einfach dieses Wohlfühlgefühl ist, weil mir jemand hilft oder etwas anders ist, das plötzlich ein erwärmendes Gefühl durch meinen Körper sendet. Es ist beinahe verwirrend, doch ich achte nicht weiter darauf, als ich mich von ihm – voll mit Schlamm bedeckt – auf die Beine ziehen lasse.
Nathan lässt meine Hand sofort wieder los, als ich stehe. Ich betrachte meine Klamotten und muss feststellen, dass ich schlimmer aussehe, als ich dachte. Ich bin wirklich völlig bedeckt mit Schlamm, sogar meine Haare sind erneut versaut. So kann ich nicht nach Hause gehen, auf keinen Fall. Grandpa und Grandma kommen heute Abend zum Abendessen und wenn ich so zu Hause durch die Haustür spaziere, wird meine Mutter ausrasten, denn meine Grandma ist eine sehr pingelige Frau. Sie achtet stets auf Ordnung und Perfektionismus. In solchen Momenten vermisse ich meine andere Grandma, Papas Mama. Sie war das komplette Gegenteil von ihr.
Nathan bückt sich nach meinem Violinenkoffer und hebt ihn hoch. Er ist ebenfalls mit Schlamm getränkt und ich sehe jetzt schon das Gesicht meiner Mutter vor meinem geistigen Auge rot anlaufen, weil ich den teuren Koffer kaputt gemacht habe. „Der scheint ganz schön im Arsch zu sein“, sagt Nathan und betrachtet den Koffer.
Ich nehme es ihm ab und sehe ihn traurig an. Der Abend kann nicht noch schlimmer werden.
Nach kurzem Schweigen sagt Nathan: „Wie auch immer. Diabo!“, ruft er und sein schwarzer Teufelshund erscheint wieder hinter einem Gebüsch. „Vielleicht solltest du beim nächsten Mal durch die Straßen laufen, zu denen du auch gehörst.“ Er dreht sich um und läuft davon.
Doch ich kann ihn nicht einfach wegjoggen lassen. Ich kann nicht einfach so nach Hause gehen, ich kann nicht schon wieder Ärger von meiner Mutter kassieren und eine Blamage vor meiner strengen Oma riskieren, ich muss mich jetzt endlich mal was trauen. Deswegen rufe ich: „Nathan!“
Er bleibt stehen, dreht sich jedoch nicht zu mir um. Sein Hund sieht mich misstrauisch an.
Ich schlucke den Kloß in meinem Hals herunter und rufe wieder durch den Regen und das Gewitter: „Bitte lass … bitte lass mich nicht so nach Hause gehen.“
Etwas dreht er sich zu mir, doch nicht genug, dass ich sein ganzes Gesicht sehen kann, denn seine Kapuze verdeckt alles. Überlegt er?
Ich presse den Violinenkoffer an meine Brust. „Bitte“, flehe ich weiter, kann mir gleichzeitig aber auch nicht ausmalen, was passieren würde, wenn er mir tatsächlich helfen würde. Das wäre merkwürdig und ich frage mich, wieso ich ihn überhaupt um Hilfe bitte.
Nathan dreht sich wieder nach vorne, doch joggt nicht weiter. Ich höre ihn leise „Scheiße“ vor sich hin fluchen, dann überrascht er mich, indem er sagt: „Ein einziges beschissenes Mal.“
Mehr als baff von seinem Willen, mir wirklich zu helfen, mich mit zu sich zu nehmen, mir zu zeigen, wo er wohnt, wie er so lebt, sammle ich mich schnell und folge ihm. Allerdings laufe ich mit einem sicheren Abstand von knapp zwei Metern hinter ihm, weil ich immer noch nicht einschätzen kann, wie er auf Nähe reagiert und schon gar nicht, wie er reagieren würde, wenn ich genau neben ihm laufe. Dass ich mir mal bei einer Person über solch seltsame Dinge Gedanken machen muss, ist beinahe amüsant, doch gleichzeitig so bedrückend.
Nathan ist einfach so ein merkwürdiger Mensch. Er steckt voller Fragen, die ich endlich beantworten möchte. Vielleicht finde ich Antworten in seinem Zimmer oder wo auch immer er lebt.
Wie erwartet verläuft der Weg zu ihm nach Hause still. Zwar hätte ich ihn alle fünf Meter gefragt, wie tief er noch in diese gruseligen Straßen um uns herumlaufen will, doch dass ihn das nerven würde, habe ich mittlerweile schon verstanden. Er ist sehr reizbar. Doch wirklich wundert es mich nicht, dass er dort wohnt, wo sich sonst niemand hin traut. Er passt hierhin, genauso wie sein Hund zu ihm passt.
Er geht zu einem alten Blockhaus und geht dort zwei kaputte Treppen nach oben, steckt in die alte Tür seinen Schlüssel. „Hier nach wirst du sofort vergessen, wo ich wohne, verstanden?“, raunt er mir zu, als er die Tür noch nicht geöffnet hat, und sieht mich eindringlich an.
Ich nicke schnell und presse den Violinenkoffer enger vor meine Brust. Weil seine Haare unter der schwarzen Mütze versteckt sind, stechen seine grünen Augen mehr heraus und somit könnte er einen mit seinem messerscharfen Blick noch mehr zerfleischen.
Schließlich öffnet er die Tür und betritt das Haus. Er hält sie mir nicht auf, deswegen schlüpfe ich schnell hinein, weil meine Hände noch um den Koffer geschlungen sind.
Und der Anblick hier schockiert mich. Wir stehen in einem alten grauen Treppenhaus mit Rissen und Einkerbungen in den Wänden, von denen ich schwören könnte, dass sie durch Schusswaffen entstanden sind. Ich muss schwer schlucken, als ich mich umsehe, während ich Nathan die Treppe nach oben folge. Hier ist es sogar noch kälter als draußen und das, obwohl wir in einem Gebäude sind. Ich hoffe, dass es bei Nathan wärmer ist.
Es tut mir leid, dass er in solch einem heruntergekommenen Zuhause leben muss. Ob er mit seinen Eltern hier wohnt? Ob er hier früher schon als kleiner Junge gelebt hat?
Wir laufen bis nach ganz oben des Treppenhauses und bleiben vor einer weiß bemalten Holztür stehen, von der der Lack schon abblättert. Unten rechts fehlt in der Tür eine Ecke, was mich befürchten lässt, dass es in Nathans Wohnung kalt sein wird. Er öffnet diese Tür ebenfalls und sein Hund sprintet gleich hinein, ich hinter ihm, der die Tür hinter mir schließt.
Verunsichert stehe ich in dem kleinen Flur und versuche, mich nicht zu offensichtlich umzusehen. Vielleicht sollte ich mich auch nicht so genau umsehen, denn der erste Eindruck schockiert mich noch mehr. Kaputte Türrahmen, ein kaputtes Regal im Flur, das Glas der Tür zum Badezimmer ist zersprungen, es liegen sogar noch Scherben auf dem Boden. Bleiche Wände ohne Tapete, sie sind einfach grau, strahlen eine ungemeine Einsamkeit und Kälte aus.
„Ich kann dir natürlich keine Luxusvilla bieten, wie du zu Hause hast, aber ist mir auch scheiß egal“, holt mich Nathan aus meiner Erkundigungstour und zieht sich die Mütze mit Kapuze vom Kopf, lässt beides einfach auf das kaputte Regal fallen. Er zeigt auf die Tür mit dem zersplitterten Glas. „Da drin ist das Badezimmer. Nutz das und dann verschwinde wieder.“
Ich kann nicht mal ein Wort sagen, weil ich noch zu verdutzt von diesem ganzen Ambiente bin.
Nathan geht an mir vorbei, ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen, und geht durch einen Türrahmen ohne Tür, lässt sich dort auf eine alte Couch fallen. Das wird wohl das Wohnzimmer sein … oder so. „Und komm bloß nicht auf die Idee, dass du mir irgendeine Art Rechenschaft schuldig bist. Ich brauche kein Danke, es reicht, wenn du einfach schweigend aus meiner Wohnung verschwindest.“
Ich starre einfach nur zu ihm rüber, wie er mit verschränkten Armen auf der Couch sitzt, seine Beine auf einen kleinen Tisch davor legt und sein Hund sich vor ihn auf den Boden setzt. Gerne würde ich wissen, ob er wenigstens so etwas wie einen Fernseher hat, doch ich traue mich nicht nachzusehen. Deswegen nicke ich einfach nur und gehe mit meinem Violinenkoffer zu der Tür mit der kaputten Scheibe. Ich schiebe vorsichtig die Scherben davor zur Seite und öffne sie.
Ich hatte erwartet, dass das Bad stinken oder abartig aussehen würde, doch es sieht sogar seltsamerweise gepflegt aus. Zwar hat das Waschbecken ein paar Risse und das Regal darunter hat auch ein eingetretenes Loch in der Tür, doch der Rest ist sauber. Kein Schimmel, keine ekligen Krabbeltiere, die mir Albträume bereiten könnten. Wenigstens das.
Erleichtert schließe ich die Tür hinter mir und stelle meinen schmutzigen Koffer auf den Boden. Zitternd entledige ich mich meiner Klamotten, weil es einfach sehr, sehr kalt ist, und steige in die Wanne, die gleichzeitig die Dusche ist.
Wer hätte letzte Woche noch gedacht, dass ich irgendwann mal bei Nathan unter der Dusche stehe. Ich hoffe, das Wasser ist warm. Wie schrecklich wäre es für ihn, wenn er immer mit kaltem Wasser duschen müsste.
Ich stelle die Dusche an und traue mich noch nicht unter den Strahl, weil es noch kalt ist, bete gleichzeitig, dass es bald warm werden wird. In der Zeit sehe ich mich genauer um.
Er hat genau zwei Duschmittel. Eins für die Haare, eins für den Körper. Ich kenne Kerle, bei denen steht die ganze Dusche voller Waschzeug, weil sie nicht genug bekommen können, doch Nathan scheint eher bedächtig damit umzugehen. Aber natürlich kann ich auch nicht erwarten, dass er viel davon hier stehen hat, immerhin wohnt er auch in … solch einer Wohnung.
Als ich mich unter den Strahl stelle und erleichtert das warme Wasser über meinen Körper fließen lasse, empfinde ich plötzlich tiefstes Mitleid für ihn. Ja, vielleicht hat er einen schlechten Charakter und eine unreine Seele, doch das hier … dieses Zuhause hat er nicht verdient. Das ist grausam für einen Neunzehnjährigen. Ich wünschte, Grandpa würde ihm mehr bezahlen, damit er sich wenigstens eine etwas bessere Wohnung leisten kann. Vielleicht in einer netteren Gegend, mit netteren Leuten. Ich bin mir sicher, dass seine Nachbarn keine netten Leute sind.
Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage, welche Eltern ihr Kind in solchen Verhältnissen leben lassen. Das hier ist grausam, ich könnte meinen Sohn hier nie so schrecklich leben lassen. Wo sind sie? Sie müssen doch ein schlechtes Gewissen haben, ihm wenigstens finanzielle Hilfe bieten. Wer weiß, ob er sich überhaupt jeden Tag etwas Ordentliches zu essen leisten kann.
Eventuell musste er deshalb damals in der Apotheke stehlen. Weil er kein Geld hat. Ich wüsste gerne, was es war, das er gestohlen hat, vielleicht verrät das mehr über ihn.
Ich benutze Nathans Duschmittel nur spärlich, weil ich ihm nicht zu viel davon nehmen möchte. Ich bin mir sicher, dass er sich davon auch nicht so viel leisten kann, wenn er schon das ganz billige Zeug benutzt.
Nach knapp sieben Minuten steige ich wieder aus der Dusche und mache mich in der eisigen Kälte auf die Suche nach einem Handtuch. Hier ist nichts, rein gar nichts, was man mit einem Handtuch vergleichen könnte. Na super. Jetzt muss ich ihn rufen, obwohl er mir das strikt verboten hat. Doch es muss sein.
Leise öffne ich die Tür und will gerade rufen, da sehe ich schon ein schwarzes Handtuch vor der Tür liegen. Überrascht bücke ich mich danach und bin mal wieder baff von Nathans Aufmerksamkeit. Das ist schon die dritte nette Sache, die er heute für mich getan hat. Die vierte, wenn man bedenkt, dass er mich vor seinem eigenen Hund „gerettet“ hat.
Ich nehme das Handtuch schnell und gehe – mir damit die Haare trocken rubbelnd – zum Waschbecken und betrachte mich in dem Spiegel. Doch das geht wohl nicht.
Nathan besitzt keinen Spiegel.
Vor mir hängt nur ein Regal, doch kein Spiegel. Allerdings erkennt man ganz klar auf den Regaltüren einen quadratischen Rand und abgenutzten Kleber, auf dem definitiv mal ein Spiegel hing. Er hat ihn abgerissen?
Es gibt so viele Dinge an ihm, die einfach keinen Sinn machen, aber gleichzeitig so gut zusammenpassen. Er ist eine definitiv verkorkste Seele, wieso sollte er also nicht seinen Spiegel abreißen? Wieso sollte er nicht einen gruseligen Hund mit nur einem Auge halten? In seinem Kopf wird es mit Sicherheit Sinn machen, irgendwo ganz tief in seinen verschlüsselten Gedanken. Ich als Außenstehende kann nur die Stirn runzeln, doch ich habe natürlich auch keinen Blick in seinen Kopf, wie gerne ich es auch hätte.
Ich bücke mich nach meinen Klamotten, lasse sie aber schnell wieder fallen, weil sie wirklich völlig mit Schlamm und Wasser getränkt sind. Es ist unmöglich, sie anzuziehen, ohne dass ich nicht gleich wieder schmutzig werde. Mir das Handtuch über die Schultern werfend, weil ich so dermaßen friere, seufze ich. Das ist ein Desaster.
Eine Lösung würde sich natürlich anbieten, doch mich das zu trauen, ist eine andere Sache. Nathan einfach mal nach Klamotten zu fragen, ist wahrscheinlich schlimmer, als würde ich ihn nach hundert Pfund fragen. Es ist sehr intim und da er es nicht so mit dem Teilen seiner Privatsphäre hat, bin ich mir sicher, dass er mich auch gleich nackt rausschmeißen wird, wenn ich ihn danach frage. Doch mir bleibt nichts anderes übrig. Meine Klamotten sind einfach im Eimer.
Ich wickle mir das schwarze Handtuch um den Körper, bin froh, dass es groß genug ist, um meine komplette Blöße zu bedecken, und öffne wieder die Tür. Oh je. Nathan wird wütend werden. Er wird wütend werden und mich rausschmeißen, ich bin mir so sicher, doch hoffe auf ein wenig Verständnis von ihm. Dass eventuell seine nette Phase noch nicht vorüber ist und er mir einfach ein altes T-Shirt und eine alte Hose von ihm gibt. Ich muss nur nach Hause kommen.
Beinahe ängstlich laufe ich durch den Flur, achte darauf, nicht auf gefährliche Gegenstände zu treten, und stelle mich in den Türrahmen zu dem Raum, wo Nathan sitzt. Er sitzt gelangweilt auf der Couch und sieht fern. Doch dann schaut er zu mir. Sein Blick fällt auf meinen Körper, der kaum bedeckt ist, dann wieder in mein Gesicht. „Was soll das?“, fragt er und setzt eine böse Miene auf.
Noch mehr verunsichert halte ich das Handtuch um meine Brust fester und sehe auf meine blanken Füße. „Ich, ähm …“ Weil ich denke, dass er mich wieder gereizt unterbrechen wird, stoppe ich und sehe ihn an, aber er tut es nicht. Er sieht mich zwar genervt an, doch redet nicht. Deswegen rede ich weiter. „Ich habe keine Klamotten.“
„Doch hast du.“
„Ja. Aber sie sind stark beschmutzt und nass … Ich kann sie unmöglich anziehen.“
„Und?“
Unruhig kaue ich auf meiner Innenlippe. „Vielleicht … Vielleicht könntest du mir, na ja … Etwas von deinen geben.“
Er sieht von mir weg. „Vergiss es. Sieh zu, wie du klarkommst.“
Enttäuscht davon, dass seine nette Phase anscheinend wirklich schon ein Ende genommen hat, drehe ich mich um und gehe wieder ins Bad. Das hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ich kann mich glücklich schätzen, dass er nicht noch schlimmere Sachen zu mir gesagt hat.
Ich bücke mich wieder zu meinen Klamotten und inspiziere sie erneut. Ich ziehe mir meine Unterwäsche an, die zum Glück nicht nass ist und versuche mich dann in meine völlig durchnässte Jeans zu quetschen. Ich verzweifle. Der Stoff klebt widerspenstig an meiner Haut und es will einfach nicht funktionieren. Ich bin am Ende. So geht das nicht. So kann das einfach nicht gehen. Nathan hat schon keinen Föhn, womit ich meine Haare trocknen kann, was definitiv eine Erkältung nach sich ziehen wird, und jetzt auch noch meine dreckigen Klamotten. Ich könnte eigentlich auch gleich hier auf dem Boden ausrutschen und mir ein Bein brechen, das wäre beinahe das weniger schlimme Übel.
„Honor“, ertönt plötzlich Nathans dunkle Stimme durch die Tür. Er steht nicht davor, sonst würde ich ihn sehen.
Ich sehe einfach nur zur Tür und weiß nicht, was ich machen soll, weil er nichts weiter sagt.
„Ich rufe nicht ein zweites Mal.“
Oh, okay. Schnell stehe ich auf, schnappe mir das Handtuch und halte es vor meinen halb nackten Körper. „Ja?“, sage ich und stelle mich in den Flur, wo ich ihn nicht entdecken kann.
„Komm her“, kommt seine Stimme aus einem Zimmer. Ich gehe dort hin und stelle mich in den Türrahmen.
Nathan steht in dem dunklen Raum vor einem Regal und zieht etwas aus einer Schublade, schmeißt es auf eine Matratze, die einfach am Boden liegt.
„Was ist das?“, frage ich.
„Was glaubst du wohl?“
Ich gehe zwei Schritte darauf zu und betrachte es näher. Er hat mir eine schwarze Stoffhose und ein schwarzes T-Shirt rausgelegt. Er hat mir wirklich von sich Klamotten rausgelegt. Anscheinend ist seine nette Phase doch noch nicht vorbei. Ich sehe ihn an und lächle mehr als dankend. „Vielen Dank. Das ist wirklich nett.“
Er sieht schnell weg und rümpft die Nase, als hätte ich ihn beleidigt. Während ich das T-Shirt in die Hand nehme, sehe ich, wie er meine Hände gedankenverloren beobachtet und auf seiner Innenwange herumkaut. Etwas scheint ihn anzuspannen, er wirkt ganz und gar nicht zufrieden.
„Du musst mir deine Klamotten nicht geben“, sage ich, weil ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, ob er das wirklich will. „Ich schätze sehr, dass du es mir angeboten hast, aber …“
„Nimm es einfach“, unterbricht er mich und atmet tief ein und aus. „Die Sachen sind mir sowieso zu klein.“
Ich nicke und nehme mir die Hose und das Shirt, achte darauf, dass mein Handtuch nicht von meinem Körper wegrutscht. „Danke“, sage ich leise und drehe mich etwas von ihm weg. „Ich werde wieder ins Badezimmer gehen.“ Und verschwinde im Bad.
Die fünfte nette Sache. Ich muss in mich hineinschmunzeln, als ich seine Klamotten in meinen Händen halte. Natürlich sind sie schwarz, doch sie sind ein Geschenk von ihm für mich und das macht es gleich viel schöner. Heute scheint der erste Tag zu sein, an dem Nathan wirklich nett zu mir ist. Na ja, er hat mir schon vor zwei Wochen bei unserer ersten Begegnung das Leben auf der Straße gerettet und mich vor ein paar Tagen spät abends nach Hause gefahren, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass er es auch wirklich so meint, wenn er es tut.
Schnell ziehe ich mir die Sachen über und fühle mich direkt wohler. Sie sind mir zu groß, doch nicht sehr viel. Es ist bequem. Ich kämme mir meine Haare mit meinen Fingern durch und verfluche es, dass er keinen Spiegel hat. Ich muss scheußlich aussehen, mit verschmierter Wimperntusche und geröteten Wangen.
Ich schnappe mir meine anderen Klamotten und meinen Koffer, ziehe mir meine Schuhe an und gehe so aus dem Bad, schließe die Tür leise hinter mir. Ich erinnere mich an Nathans Bitte, ich solle einfach schweigend gehen, wenn ich fertig bin, und bedankt habe ich mich auch schon bei ihm für die Klamotten, deswegen öffne ich leise die Wohnungstür, um zu verschwinden, wie er es gesagt hat. Erkältung, ich komme.
„Hey“, hält mich Nathans Stimme auf und ich drehe mich verwirrt um. Er steht im Flur und zieht sich gerade seine schwarze Jacke über, dann seine Kapuze über den Kopf. „Ich nehme dich mit.“
„Du nimmst mich mit?“
Er nimmt sich seinen Schlüssel vom Regal und kommt auf mich zu. Seine Brust ist meiner gefährlich nah, als er an mir vorbeigreift, um das Licht auszuschalten, doch trotzdem entgeht mir nicht sein Geruch, den ich das erste Mal rieche. Es riecht nach … Nathan. Einfach nach Nathan. Es riecht gut.
„Ja, ich nehme dich mit“, wiederholt er und geht an mir vorbei in den Hausflur.
Ich schließe die Tür überfordert hinter mir und folge ihm schnell, ziehe mir meinen verdreckten Mantel über. „Mit deinem Motorrad?“
Mit schnellen Schritten läuft er die vielen Treppen nach unten. „Ja.“
„Wieso?“, frage ich und muss mich anstrengen, seinen schnellen Schritten standzuhalten.
Plötzlich bleibt er stehen und ich knalle in seinen breiten Rücken. Er sieht über die Schulter zu mir. „Willst du laufen?“
Ich blinzle. „Nein, ich … aber …“
„Also hör auf, so beschissene Fragen zu stellen.“
„Tut mir leid“, sage ich leise vor mich hin, als wir das Haus verlassen.
Die sechste nette Sache, die er für mich tut. Es ist seltsam. Das alles ist seltsam. Er tut all das, aber gleichzeitig kommt es mir so vor, als würde er es nicht wollen. Als wäre es eine riesige Belastung für ihn. Irgendetwas kann doch da nicht stimmen. Aber trotzdem bin ich mehr als froh, dass ich nicht mit meinen nassen Haaren nach Hause laufen muss. Allerdings wird mir der kalte Wind auch einen ordentlichen Zug verpassen, doch es ist immer noch besser, als eine halbe Stunde zu laufen. Und ich komme vielleicht noch pünktlich nach Hause.
Nathan läuft neben das Haus zu seinem Motorrad, setzt sich darauf und tritt es an. Er muss es wohl eilig haben.
Schnell gehe ich zu ihm und setze mich vorsichtig hinter ihn, damit ich meinen Koffer und meine Klamotten nicht verliere. Er setzt sich seinen Helm auf und nimmt das Motorrad vom Ständer.
Ich rutsche nah an ihn heran. Es ist einfach dieses Gefühl der Sicherheit, das er mir vermittelt, wenn ich hinter ihm sitze, was mich näher an ihn heranbringt. Außerdem ist es so wärmer. Er strahlt eine gewisse körperliche Wärme aus und sein Geruch … Wow. Einmal ist er nett, schon denke ich so skurril über ihn. Eigentlich war er sechsmal nett zu mir, aber er ist immer noch unausstehlich.
„Könntest du etwas zurückrutschen?“, fragt Nathan mich über den Klang des Motors.
Ich nehme meinen Kopf von seinem Rücken und richte mich etwas auf. Was? Doch ich tue, was er sagt, auch wenn ich es nicht möchte. Anscheinend fühlt er sich in meiner Nähe nicht so sicher wie ich mich bei ihm. Doch wer hätte das erwartet? Jeder.
„Darf ich mich dennoch an dir festhalten?“, frage ich. „Ich habe Angst herunterzufallen.“
„Ja, darfst du. Aber komm mir nicht so nahe.“
Ich nicke verletzter, als ich es sein sollte, und rutsche noch etwas von ihm weg, lege jedoch meine Arme wieder um seinen Oberkörper.
Ich bin froh, wenn ich im Bett liege.