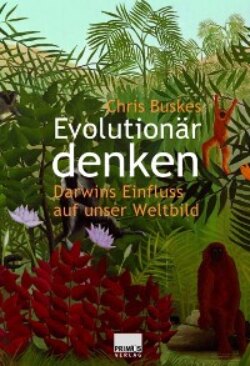Читать книгу Evolutionär denken - Chris Buskes - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weismann und Mendel
ОглавлениеIn den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wuchs die Einsicht, dass Darwin ein bedeutender wissenschaftlicher Durchbruch gelungen war. Die Entstehung der Arten wurde in viele Sprachen übersetzt, Darwins Ruhm verbreitete sich rasch. Trotz seiner schwachen Gesundheit widmete sich Darwin intensiv der Verbreitung seiner Ideen. 1871 veröffentlichte er Die Abstammung des Menschen (The descent of men). Darin legte er dar, dass auch der Mensch das Produkt einer evolutionären Entwicklung sei. Mensch und Affe stammten von einem gemeinsamen Vorfahren ab, und das bedeutete, dass Homo sapiens nicht länger den Sonderstatus einnahm, den ihm die Kreationisten zuschrieben. Das viktorianische Publikum allerdings war von diesem Gedanken nicht besonders angetan und machte seiner Entrüstung in Karikaturen Luft (Abb. 1.2).
Darwins Evolutionstheorie wies allerdings noch eine auffällige Lücke auf. Darwin und seine Anhänger zerbrachen sich den Kopf darüber, auf welchem Weg Körpermerkmale von Generation auf Generation weitergegeben werden. Es war deutlich, dass Variation die Voraussetzung der Evolution war. Aber welche Variationen erreichten die nächste Generation und welche nicht? Und würde eine günstige Eigenschaft nicht nach und nach durch Vermischung schwächer werden? Man wusste zwar, dass neue Organismen aus der Verschmelzung einer Samen- und einer Eizelle entstehen. Aber bisher konnte niemand sagen, welche Information bei der Befruchtung weitergegeben wird. Was Darwin fehlte, war eine einleuchtende Vererbungstheorie.
Abb. 1.2: Darwin als Affe
In den letzten zehn Jahren seines Lebens griff Darwin auf Lamarcks Vorstellung zurück, erworbene Eigenschaften seien erblich. Er entwickelte zur Erklärung eine eigene Theorie, die Pangenesis-Theorie. Die Geschlechtszellen empfangen demnach ständig Informationen über das, was im Körper vor sich geht. Alle Körperteile produzieren winzige Körperchen (Gemmulen) und senden sie über die Blutbahn zu den Samen- oder Eizellen, sodass die Erbinformation immer up to date bleibt. Diese Hypothese erklärte gleichzeitig auch das Lamarck’sche Prinzip vom Gebrauch und Nichtgebrauch. Wie intensiv etwa ein Organ von einem Lebewesen gebraucht wurde, teilten die Gamellen den Keimzellen mit. Auf diese Weise erbten Nachkommen die im Lauf des Lebens erworbenen – oder verlorenen – Eigenschaften ihrer Eltern. Unter anderem durch Darwins Einsatz erlebte der Lamarckismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Renaissance.
Diese Neubelebung fand jedoch ein abruptes Ende, als der deutsche Biologe August Weismann nachwies, dass Lamarcks Vererbungs- und Darwins Pangenesis-Theorie nicht stimmen konnten. In einem etwas grausamen, aber nützlichen Experiment schnitt er Mäusen mehrere Generationen hindurch die Schwänze ab, um festzustellen, ob ihre Kinder schwanzlos zur Welt kommen. Das war nicht der Fall, jede Mäusegeneration wurde mit gleich langem Schwanz geboren. Weismann folgerte, dass im Laufe des Lebens erworbene Eigenschaften – in diesem Fall eine Verletzung – nicht erblich sind. (Er hätte sich die Mühe sparen können, wenn er sein Augenmerk auf jüdische oder muslimische Jungen gerichtet hätte, die seit Jahrhunderten beschnitten werden und deren Söhne immer mit intakter Vorhaut zur Welt kommen.) Weismann entwickelte daraufhin seine Keimplasma-Theorie. Er zog eine scharfe Trennungslinie zwischen den Körperzellen (somatischen Zellen) und den Geschlechtszellen (Keimzellen). Das Erbmaterial, das in den Geschlechtszellen, dem Keimplasma, enthalten ist, kann durch Veränderungen in den Körperzellen nicht beeinflusst werden. Das Keimplasma bildet von Generation auf Generation eine eigene ununterbrochene Linie, völlig unabhängig davon, was mit dem Körper geschieht. Es führen kausale Stränge vom Erbgut zum Körper, doch nicht umgekehrt. Im 20. Jahrhundert sollte Weismanns entscheidende Erkenntnis zum sogenannten „zentralen Dogma“ der Molekularbiologie ausgebaut werden: Die Information, die in somatischen Proteinen enthalten ist, ist nicht auf die Nukleinsäuren der DNA übertragbar. So weit war man aber zu Weismanns Zeit noch nicht. Lamarcks Vererbungstheorie jedenfalls konnte nicht erklären, durch welchen Mechanismus Varianten entstehen. Die Suche ging weiter.
Als Darwin am 16. April 1882 starb, tappte man bezüglich dieses Problems noch immer im Dunkeln. Kaum jemand wusste, dass die Vererbungstheorie, nach der man so eifrig suchte, schon fünfzehn Jahre zuvor von einem tschechischen Mönch, dem Botaniker Gregor Mendel, formuliert worden war. In den Sechzigerjahren des 19. Jahrhunderts hatte er die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung untersucht und seine Beobachtungen in einem Artikel unter dem Titel „Versuche über Pflanzen-Hybriden“ veröffentlicht. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse hatten jedoch keine Beachtung gefunden. Durch Kreuzungsversuche an Erbsen entdeckte Mendel, dass Eigenschaften nach bestimmten Regeln vererbt werden. Das Erbgut besteht aus diskreten, von einander abgegrenzten Einheiten, den Genen. Sie vermischen sich nicht, man könnte sagen, dass sie „an-“ oder „ausgeschaltet“ werden. Mendel zeigte, dass bestimmte Merkmale, beispielsweise die gelbe oder grüne Farbe der Erbsen, über Generationen verborgen bleiben können, um irgendwann in einer Generation wieder aufzutauchen. Die Expression eines „Gens“ kann ausgeschaltet werden, nicht das „Gen“ selber. Die äußere Erscheinung eines Organismus (der Phänotyp) sagt demnach längst nicht alles über den ihm zugrunde liegenden genetischen Bauplan (den Genotyp) aus. Durch geschlechtliche Fortpflanzung werden die Erbfaktoren zwar ständig durcheinander gewürfelt, aber nicht vermischt: Der Partikelcharakter der Gene bleibt erhalten. Gene, die zum Ausdruck kommen (zum Beispiel in der Farbe Gelb) nannte Mendel „dominant“, diejenigen, die unterdrückt werden (zum Beispiel die Farbe Grün) „rezessiv“. Mendel konnte sehr genau vorhersagen, in welchem Verhältnis Merkmale auftreten bzw. nicht auftreten. Außerdem kam er den spontanen Veränderungen im Bauplan von Organismen, den sogenannten Mutationen, auf die Spur. Durch sie entstehen manchmal völlig neue phänotypische Varianten. Wenn die Mutation in den Geschlechtszellen auftritt, ist sie erblich.
Im Jahr 1900, achtzehn Jahre nach Darwins Tod, wurde Mendels Arbeit wiederentdeckt. Man setzte nun alles daran, seine Erkenntnisse mit Darwins Theorie der natürlichen Selektion in Einklang zu bringen. Keine leichte Aufgabe, denn schon bald bildeten sich zwei rivalisierende Lager, die Mendelisten und die Darwinisten. Die Mendelisten meinten, gelegentliche Mutationen seien die Triebfeder der Evolution, sie verlaufe in Sprüngen. Durch eine Makromutation, eine große Veränderung, könne sogar mit einem Schlag eine neue Art entstehen. Den Mendelisten zufolge war das Prinzip der natürlichen Selektion eigentlich überflüssig. Die Darwinisten (manchmal auch als Biometriker angedeutet) waren dagegen davon überzeugt, dass kontinuierliche Variation Grundlage der Evolution sei. Darwin hatte ja festgestellt, dass Organismen, die zur selben Art gehören, immer kleine Unterschiede aufweisen. Und nur die natürliche Selektion könne diese kleinen, vorteilhaften Variationen aussieben. Der tiefe Graben, der zwischen den Mendelisten und den Darwinisten entstand, sollte erst Anfang des 20. Jahrhunderts überwunden werden.