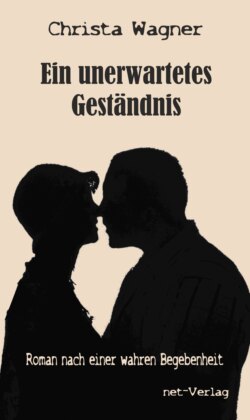Читать книгу Ein unerwartetes Geständnis - Christa Wagner - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеWie sehr die kommenden beiden Tage ihr Leben für immer verändern sollten, konnte Simone nicht ahnen, als sie im Mai 2007 mit ihrem Auto unterwegs in ihr Heimatdorf war. Regen prasselte gegen die Windschutzscheibe, die Wischer flitzten hin und her. Simone hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Regengrau und Müdigkeit drückten zusätzlich ihre Stimmung, die mit der Aussicht auf die kommenden Tage eigentlich schon ausreichend getrübt war: heute und morgen die kranke Mutter betreuen. Allein.
Aber es gab kein Ausweichen, sie war die einzige Wahl. Der Vater und ihr Bruder samt Familie, die normalerweise für die Pflege zuständig waren, weil sie alle zusammen auf dem Hof lebten, fuhren zur Beerdigung eines Onkels nach Hamburg. Über 600 Kilometer waren einfach zu viel für einen Tag, klar verstand sie das. Simone seufzte.
Die Vorstellung, für zwei Tage mit der kranken Mutter allein und für alles verantwortlich zu sein, verursachte Bauchgrimmen und schweißfeuchte Hände, die am Lenkrad klebten. Obwohl die Diakonie früh und abends die schwere Arbeit erledigte – Gott sei Dank – und für sie nur noch Handgriffe blieben, hatte sie Angst davor, mit ihrer Mutter, die nicht allein sein sollte, allein zu sein.
Tränen traten Simone in die Augen. Rasch wischte sie sie mit dem Jackenärmel weg; sie musste klar sehen, sich auf die Straße konzentrieren. Wenigstens ließ der Regen etwas nach.
Die letzten Monate hatte Mutter abwechselnd im Krankenhaus und zu Hause verbracht. Jetzt war sie austherapiert. Was für ein Wort! Warum sagten sie nicht einfach, was es war? Endstation. Warten auf den Tod.
Das Nachbardorf tauchte auf, die Pappelallee, die den Berg hinauf in Simones Dorf führte. Sie hatte all die Jahre, in denen sie in der Stadt lebte, nie das Gefühl gehabt, nach Hause zu kommen, wenn sie ins Dorf zurückfuhr. Es bedeutete ihr nicht mehr viel, war ihr fremd geworden. Sie hatte sich auch wenig um den Erhalt von Kontakten bemüht. Wozu auch? Die Freunde von einst lebten ein völlig anderes Leben.
Simone bremste am Ortsschild auf 50 km/h, bog von der Hauptstraße ab; geradeaus vor ihr lag direkt der Hof. Jetzt, nach der Wetterfront, spiegelten sich die ersten Strahlen der Morgensonne im Regennass.
Sie parkte vor der Scheune, nahm ihren Trolley und den Cellokasten aus dem Kofferraum, öffnete die immer unversperrte Haustür und trat in die Diele, wo sie beides erst einmal abstellte. Sie wusste, sie würden alle in der Küche sein.
Nach raschem Klopfen öffnete Simone die Tür. Da saßen sie auf der Eckbank um den großen Küchentisch: ihr Vater Reinhard, ihr Bruder Walter, die Schwägerin Irene und sogar der sechsjährige Marco, ihr Neffe – alle schwarz gekleidet, startklar für die bevorstehende Fahrt zur Beerdigung.
»Na endlich!« Irene sprang auf.
Die anderen nickten ihr lediglich zu.
Simone wuschelte Marco durchs Haar. »Du bist ja schon wieder gewachsen!«
Vater brummte: »Es wird Zeit, dass er im Herbst in die Schule kommt, er hat nur noch Unfug im Kopf.«
Marco grinste, Simone lachte.
Irene lief zum Kühlschrank. »Ich erkläre dir jetzt, was mit Bärbel zu tun ist. Wir müssen gleich los.« Sie nahm Fläschchen und Tabletten heraus und dozierte, was wann zu geben und wie zu handeln sei bei allen möglichen Eventualitäten.
Simone nickte alles stumm ab.
Dann endlich brachen sie auf.
»Bis morgen Abend!«, rief Simone noch. Die Autotüren wurden zugeschlagen, der Wagen startete, wurde leiser. Simone schnaufte durch, ging auf die Schlafzimmertür zu, zögerte, drückte dann aber langsam die Klinke.
Da lag die Mutter in ihrem weißen Krankenhausbett, dünn, blass. Von ihrem Leiden gezeichnet, aber mit lebhaften Augen. Kaum zu glauben, dass sie erst achtundfünfzig war.
»Meine Simone!« Mit leichtem Lächeln hob Bärbel die schmale Hand etwas an.
Simone ergriff sie, streichelte die welke Haut, lächelte zurück. Dann gab sie sich einen Ruck und fuhr mit den Fingern sanft die Gesichtskonturen ihrer Mutter nach. Sie spürte, wie sie sich beide entspannten.
»Wie geht es dir?« Simone hörte selbst, wie hohl ihre Frage klang.
Umso mehr überraschte sie die Antwort ihrer Mutter. »Gut. Verhältnismäßig gut. Bin froh, endlich zu Hause zu sein.«
Ihre Stimme klang wirklich nicht mehr ganz so schwach wie beim letzten Mal bei Simones Besuch im Krankenhaus, selbst die Augen schimmerten klarer.
»Das ist schön, Mama. Sehr schön!« Simone lächelte zuversichtlich.
»Und dir? Was macht Georg?«
»Mir geht’s wie immer, Mama. Das Wochenende war wieder stressig. Drei Aufführungen. Bin jede Nacht um eins ins Bett gefallen. Aber jetzt hab ich zwei Tage frei. Übermorgen beginnen wieder die Proben. Übrigens hab ich mein Cello dabei, um ein bisschen zu üben, und vor allem, um dir mal was vorzuspielen. Du magst das ja so.«
Bärbel nickte und lächelte in sich hinein.
Simone fuhr fort: »Und Georg? Ja, der hat viel zu korrigieren mit einer Abiklasse in Mathe. Momentan sehe ich nicht viel von ihm. Wenn ich Zeit habe, ist er in der Schule, und wenn er frei hat, muss ich spielen. Das alte Problem. Na ja. Aber Mitte August wollen wir für zwei Wochen nach Norwegen fahren. Da freu ich mich drauf.«
Die letzten beiden Sätze sprach Simone leiser, unsicherer. Ihr wurde bewusst, dass ihre Mutter dann wahrscheinlich nicht mehr lebte. Wie konnte sie nur so unsensibel sein und behaupten, sich auf eine Zeit zu freuen, in der ihre Mutter nicht mehr da sein würde.
Aber Bärbel drückte ihre Hand. »Schön, dass du dich auf die Ferientage mit Georg freust. So muss es doch sein.«
Simone antwortete nicht. Sie hatte Georg schon mehrmals mitgebracht in den drei Jahren, in denen sie zusammen waren. Er war nett zur Familie gewesen, hatte sich um Gesprächsthemen bemüht, mehr als sie selbst. Es gab durchweg positive Rückmeldungen. Die Schwägerin ließ sich sogar zur Bemerkung hinreißen, Georg sei doch etwas ganz anderes als dieser Koreaner. Simone hatte ihr hinter ihrem Rücken die Zunge rausgestreckt. Wenigstens das.
Simone schaute ihre Mutter an. Heller, kurzer, grauer Flaum hatte sich über der Kopfhaut gebildet, seit die Chemo abgesetzt war. Jetzt schaffte es die Morgensonne, durch die Wolken zu brechen, und ein einzelner Lichtstrahl beleuchtete Bärbels Bett. Der Flaum leuchtete auf dem Kissen wie ein fransiger Heiligenschein, der den Kopf umrahmte. Das Gesicht strahlte unerwartete Energie aus.
Bärbel tastete nach Simones Hand. »Gut, dass wir heute allein sind, ich muss dir etwas erzählen. Etwas Wichtiges. Solange ich noch Zeit habe. Stell deinen Stuhl neben mein Bett!«
Simone gehorchte, nahm aber noch nicht Platz, sondern verschwand erst noch schnell in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen.
Was hatte Mama wohl auf dem Herzen? Vielleicht kam jetzt das, was viele Sterbende suchten – die Gespräche über alles, was sie versäumt hatten und bereuten, damit den Kindern ja nicht dasselbe passierte.
Das Leben der Mutter war in Simones Augen völlig ereignislos, um nicht zu sagen langweilig, verlaufen. Sie hatte kaum etwas erlebt, war nur selten aus dem Dorf rausgekommen, so gut wie nie in den Urlaub gefahren. Ihre Kontakte beschränkten sich im Großen und Ganzen auf die Dorfgemeinschaft.
Simone kehrte mit dem Kaffee zurück, setzte sich und nahm einen kräftigen Schluck. Er tat ihr gut.
Bärbel lächelte in sich hinein. »Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Hab dem Papa damals versprochen, dass ich keinem Menschen davon erzähle, auch dir nicht. Dir schon gleich gar nicht.«
Simone horchte auf.
»Aber in den letzten Monaten hab ich viel Zeit gehabt und hin- und herüberlegt. Es geht nicht anders, ich muss wohl mein Versprechen an Reinhard brechen. Heute ist die Gelegenheit. Alle anderen sind fort. Ich habe extra nur die Hälfte der Morphine genommen, damit ich mehr Kraft habe und nicht so leicht eindöse.«
Berührt strich Simone ihr über die eingefallene Wange. »Ist es etwas Schlimmes?«
Mutter lächelte. »Nein, eigentlich nicht. Ich habe dir ja schon immer viel von meiner Kindheit erzählt, mein Schatz, auch weil du so interessiert warst, du weißt eigentlich auch ziemlich alles.
Aber eines hab ich ausgespart oder bei Nachfragen nur kurz und beiläufig erwähnt, das war meine Zeit in Würzburg, als ich bei Tante Alice gewohnt habe. Und erst jetzt habe ich mich entschlossen, dir davon wahrheitsgemäß zu berichten, denn sie hat mich sehr geprägt, mehr als alles andere.
Für mich hat es damals, trotz meiner guten Noten, weder Schul- noch Berufsalternativen gegeben. Die Kreisstadt mit den höheren Schulen lag zu weit entfernt, um die Strecke mit dem Fahrrad bewältigen zu können; Schulbusse verkehrten erst viel später.
Außerdem war ich als einziges Kind meiner Eltern dafür vorgesehen, ihren Hof weiterzuführen. So habe ich halt, wie viele andere Jugendliche aus dem Dorf, eine landwirtschaftliche Lehre absolviert.
Meine Mutter, also deine Oma Marga, hatte damals schon eine Herzschwäche, und dein Opa war froh, wenn ich es war, die ihm bei der schweren Arbeit helfen konnte.
Aber im Spätsommer 1966 veränderte sich meine Welt mit einer Kette von Ereignissen, von denen du keinerlei Ahnung hast. Damals war ich knapp achtzehn Jahre alt, hatte meine landwirtschaftliche Lehre bereits hinter mir und bewirtschaftete zusammen mit meinen Eltern unseren kleinen Hof.«