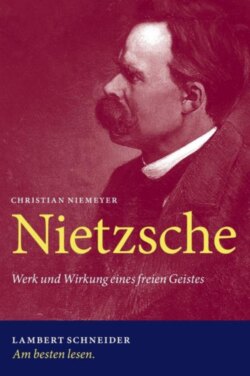Читать книгу Nietzsche - Christian Niemeyer - Страница 10
Morgenröthe: Das Baugerüst wird hochgezogen, als Wahlspruch gilt: „Rückkehr zur Wissenschaft!“
ОглавлениеEnde August 1881, unmittelbar nach Erscheinen seiner Morgenröthe (in diesem Kapitel: M)50 mit dem Untertitel Gedanken über die moralischen Vorurtheile, gab Nietzsche gegenüber seinem „liebe[n] Freund“ Paul Rée der Hoffnung Ausdruck, nun gerate sein Ruf als „neuer unmöglicher unvollständiger aphoristischer Philosophus“ ebenso in Vergessenheit wie seine „arme stückweise Philosophie.“ (6: 123f.) Fast drei Jahre später, nach Erscheinen der ersten drei Bücher von Also sprach Zarathustra, meinte Nietzsche gegenüber seinem Baseler Freund und Kollegen Franz Overbeck, er habe beim erneuten Durchlesen von M (sowie von Die fröhliche Wissenschaft) gefunden, „daß darin fast keine Zeile steht, die nicht als Einleitung, Vorbereitung und Commentar zu genanntem Zarathustra dienen kann.“ (6: 496) M war also für Nietzsche ein sehr wichtiges Buch, wichtig vor allem mit Blick auf die in ihm verborgene theoriesystematische Absicht, die im Zarathustra kulminiert.
Nicht zu vergessen: Mit M setzte Nietzsche den Paradigmenwechsel fort, der mit Menschliches, Allzumenschliches begonnen hatte. Die hier geübte Kritik an der „metaphysische[n] Philosophie“ (II: 23) zeigt beispielsweise Wirkung, wenn sich Nietzsche nun über „Etwas, das sich die Philosophie nennt“, mit dem Wort lustig macht, sie wolle nichts weiter als „Verschönerung“ der Wissenschaften und entarte damit zur quasi-religiösen „Unterhaltungskunst“, um dagegen, mit einer kleinen Volte gegen Rousseau, den Imperativ zu setzen: „‚Rückkehr zur Wissenschaft! Zur Natur und Natürlichkeit der Wissenschaft!‘“ (III: 263)
Was aus diesem Imperativ im Einzelnen folgt? Nun, Nietzsche stellte beispielsweise „die unerhörte Quacksalberei an den Pranger […], mit der, unter den herrlichsten Namen, bis jetzt die Menschheit ihre Seelenkrankheit zu behandeln gewöhnt ist“ (III: 56). Beachtung verdient auch Nietzsches Hoffnung, dass eines Tages „[d]as, was wir bisher praktische Moral nannten, sich in ein Stück […] Heilkunst und Heilwissenschaft“ (III: 178) verwandelt haben möge. Diese Entwichtung der Ethik zugunsten der Medizin resp. Psychologie schien Nietzsche vor allem aufgrund des (zeitgenössischen) Umgangs mit Verbrechern ratsam – und muss gelesen werden als Teil der Forderung, „den Begriff der Strafe, der die ganze Welt überwuchert hat, aus ihr zu entfernen!“ (III: 26)
Des Weiteren entdeckt Nietzsche die dunkle Seite des Mitleids nach dem Schema: „Der Unfall des Andern beleidigt uns, er würde uns unserer Ohnmacht, vielleicht unserer Feigheit überführen, wenn wir ihm nicht Abhülfe brächten […] Diese Art Pein und Beleidigung weisen wir zurück und vergelten sie durch eine Handlung des Mitleidens, in ihr kann eine feine Nothwehr oder auch Rache sein.“ (III: 125) Dies ist fein durchanalysiert, führt zur Entdeckung dessen, was die Psychoanalytiker heutzutage Helfersyndrom heißen – und stellt Altruismus ganz allgemein in Frage nach dem Muster: „Die Unterwerfung unter die Moral kann sclavenhaft oder eitel oder eigennützig oder resignirt oder dumpf-schwärmerisch oder gedankenlos oder ein Act der Verzweiflung sein, wie die Unterwerfung unter einen Fürsten: an sich ist sie nichts Moralisches.“ (III: 89) Dieser Satz zielt mitten hinein in die Gottesvorstellung als Begründungsmotiv moralischen Handelns, denn: „Wenn immer ein Anderer um uns ist, so ist das Beste von Muth und Güte in der Welt unmöglich gemacht. Möchte man nicht gegen diese Zudringlichkeit des Himmels, gegen diesen unvermeidlichen übernatürlichen Nachbar ganz des Teufels werden!“ (III: 279) Gott wird hier nicht expressis verbis genannt. Aber er spielt eine Rolle als Kontrollorgan – und gegen ihn steht Nietzsche, der sich in jenen ‚Teufel‘ verwandeln, sich dieser ‚Zudringlichkeit des Himmels‘ erwehren und im Zarathustra den Tod Gottes erklären wird, um den Ausblick auf eine Tugendlehre ohne Gott freizulegen.
Dass der Mensch, um den damit sich stellenden Anforderungen gewachsen zu sein, der Selbsterkenntnis bedarf, ist Nietzsche rasch klar: „Wir sind Alle nicht Das, als was wir nach den Zuständen erscheinen, für die wir allein Bewusstsein und Worte – und folglich Lob und Tadel – haben.“ (III: 107) Schon das vielbeschworene „sogenannte ‚Ich‘“ sei keine Tatsache, sondern nichts weiter als „[u]nsere Meinung über uns“ (III: 108). Als weiterer Akt der Demontage der überlieferten Subjektvorstellungen wird die Vermutung unterbreitet, dass „all unser sogenanntes Bewusstsein ein mehr oder weniger phantastischer Commentar über einen ungewussten, vielleicht unwissbaren, aber gefühlten Text ist.“ (III: 113) Und schließlich folgt, unter dem Titel Zur Beruhigung des Skeptikers, den der Zweifel umtreibe, ob er wisse, was er tue, und wissen könne, was er tun soll: „Du hast Recht, aber zweifle nicht daran: du wirst gethan! In jedem Augenblick! Die Menschheit hat zu allen Zeiten das Activum und das Passivum verwechselt, es ist ihr ewiger grammatikalischer Schnitzer.“ (III: 115)
Analoges vermutet Nietzsche für das Wollen (s. III: 116) sowie das Vergessen, hier nun sehr deutlich in Vorwegnahme Freuds: „Dass es ein Vergessen giebt, ist noch nicht bewiesen; was wir wissen, ist allein, dass die Wiedererinnerung nicht in unserer Macht steht.“ Dass die aus dem Nachsatz filterbare Ausrede nicht von Bestand sein wird, stellt der Zusatz klar, die Behauptung, die Wiedererinnerung stünde nicht in unserer Macht, bezeichne nur eine „Lücke unseres Wissens um unsere Macht.“ (III: 117) Folgerichtig postuliert Nietzsche in Weiterführung des hierzu in Der Wanderer und sein Schatten (s. II: 639) Vorgetragenen: „Nichts ist mehr euer Eigen als eure Träume! Nichts mehr euer Werk! Stoff, Form, Dauer, Schauspieler, Zuschauer, – in diesen Komödien seid ihr Alles ihr selber!“ (III: 117)
Unter die Kategorie der kontinuierenden Motive fällt auch vieles von dem, was Nietzsche nun in Sachen Pädagogik vorzutragen hat. Dies gilt beispielsweise, wenn er „bei einem Rückblick auf den Weg des Lebens“ die „Vergeudung unserer Jugend“ anprangert, weil man „wider dem obersten Satz aller Bildung“ gehandelt habe: „dass man nur dem, der Hunger darnach hat, eine Speise gebe!“ (III: 168) Weitergeführt wird diese Analyse unter der Perspektive der notwendigen Befreiung von der dem Menschen anerzogenen zweiten Natur „dann, wenn unter ihrer Hülle die erste Natur reif geworden ist.“ (III: 275) Dies klingt nach der Historienschrift von 1874, in welcher Nietzsche erstmals von der Notwendigkeit der Selbsterziehung gesprochen hatte, hin „zu einer neuen Gewohnheit und Natur, heraus aus einer alten und ersten Natur und Gewohnheit.“ (I: 328) Warum dies erforderlich sei, stellt Nietzsche nun, in M, mit den Worten klar: „Unter der Herrschaft der Sittlichkeit der Sitte hat die Originalität jeder Art ein böses Gewissen bekommen; bis diesen Augenblick ist der Himmel der Besten noch dadurch verdüsterter, als er sein müsste.“ (III: 24)
Dass Nietzsche dabei auch an sich dachte, liegt auf der Hand. Denn schließlich war er es, der, gegen viele Widerstände im privaten Umfeld, hinter der ihm anerzogenen zweiten Natur des Philologen seine erste Natur (die des freigeistigen Philosophen) erst mühsam freizulegen hatte.51 Entsprechend dreht er den Spieß nun um: Wohlwissend, dass er durch seine „Freigeisterei“ insbesondere seine „Nächsten“ „in Zweifel, Kummer und Schlimmeres“ geworfen hatte, fordert er, „entferntere Zwecke unter Umständen auch durch das Leid des Anderen zu fördern.“ (III: 137) Diese so gedachte und im Interesse der Entdeckung des Neuen unvermeidbare Umkehr des in der (geisteswissenschaftlichen) Pädagogik seit Schleiermacher anerkannten Generationenverhältnisses wird einem später in der Reformpädagogik wieder begegnen52 – und erklärt, warum diese sowie Nietzsche dem pädagogischen Mainstream verdächtig waren (s. Teil B: S. 113ff.). Dies gilt umso mehr, als Nietzsches Kampf für das Neue und Innovative grundlegende Bürgertums- und Christentumskritik erfordert. Eher en passant geschieht dies dort, wo Nietzsche, ohne einen Namen zu nennen, Wagners – für ihn im Parsifal sinnfällig gewordene – Rückkehr zum Christentum mit dem spöttischen Kommentar versieht, dass das Alter nun einmal „schwach und vergesslich mache.“ (III: 58) Im vermeintlich ‚guten‘, christlichen Menschen ist also, so müssen wir Nietzsche verstehen, nichts weiter zu besichtigen als die zur Tugend aufgewertete Schwäche, die sich wiederum anheischig macht, das ‚Starke‘ als das ‚Böse‘ ins Abseits zu setzen nach dem Tenor: „Die Leidenschaften werden böse und tückisch, wenn sie böse und tückisch betrachtet werden.“ (III: 73)
Positionen wie diese weisen darauf hin, dass Nietzsche auch in M in verdeckter Form den Skandal erörtert, der an ihm im Verlauf seiner Erziehung begangen wurde, weil die Neuheit seines Denkens immer wieder mit Attributen wie ‚böse‘ und ‚gefährlich‘ belegt wurde. Erst aus dieser Skandalisierung heraus erhoffte sich Nietzsche neue Freiräume für die Setzung seiner selbst als eines Menschen, der eigene Werte zu setzen vermag. Nietzsche hierzu: „Der freie Mensch ist unsittlich, weil er in Allem von sich und nicht von einem Herkommen abhängen will: in allen ursprünglichen Zuständen der Menschheit bedeutet ‚böse‘ so viel wie ‚individuell‘, ‚frei‘, ‚willkürlich‘, ‚ungewohnt‘, ‚unvorhergesehen‘, ‚unberechenbar‘.“ (III: 22) Weil Nietzsches Interesse dahin ging, seine Epoche, das seiner Wahrnehmung nach theologisch dominierte auslaufende 19. Jahrhundert, wieder in einen in diesem Sinne ‚ursprünglichen Zustand der Menschheit‘ zu versetzen, forderte er: „Man hat viel von der Verunglimpfung wieder zurückzunehmen, mit der die Menschen alle Jene bedacht haben, welche durch die That den Bann einer Sitte durchbrachen, – im Allgemeinen heissen sie Verbrecher.“ (III: 33) Dem nämlichen Ziel dient Nietzsches Klage, dass noch kein Denker den Mut gehabt habe, „die Gesundheit einer Gesellschaft und der Einzelnen darnach zu bemessen, wie viel Parasiten sie ertragen kann.“ (III: 178) Wohlgemerkt: Vokabeln wie ‚Verbrecher‘ und ‚böse‘ sind nur Metaphern. Sie sollen helfen bei der Erörterung des Problems, wie das Neue entsteht und die Gesellschaft mit Hilfe von Toleranz die Regeneration ihrer selbst sicherstellen kann.53
Nietzsches Antwort war eindeutig: Neues – und in diesem Sinne ‚Böses‘ – kann nicht anders in die Welt treten als mittels Opposition gegen das, was das herrschende Bewusstsein für Normalität hält. Auch Einsamkeit muss folglich eine Zeit lang ertragen werden, wie der Fall Rousseau zeige. Denn, so kann man Nietzsches unter dem Titel Der Böse vorgetragenes Argument zusammenfassen: Rousseaus Ärger über seinen Ex-Freund und Enzyklopädisten Denis Diderot, der gespottet hatte, nur der Einsame – also Rousseau, der sich aus Angst vor Verfolgung als Eremit aufs Land geflüchtet hatte – sei böse, ist zwar verständlich, wenn man bedenkt, dass Rousseau dies nicht nur als Verhöhnung seiner theoretischen Position, sondern auch als persönlichen Angriff empfinden musste. Andererseits aber, so Nietzsche, übersah Rousseau die theoretische Begründung für Diderots Argument, ließ also außer Acht, dass „jeder böse Hang inmitten der Gesellschaft […] sich selbst in das Prokrustes-Bett der Tugend zu legen“ (III: 293) habe, so dass das ‚Böse‘ und mithin Neue tatsächlich nur außerhalb der Gesellschaft, also in der Einsamkeit, in Erscheinung treten könne.
Nietzsches Bürger- und Christentumskritik in M, so kann man hier erkennen, ist Teil eines weiträumig angelegten psychologischen Forschungsprogramms in anti-normativistischer und anti-metaphysischer Absicht. Primäres Ziel ist dabei, „die ganze reine Zufälligkeit des Geschehens“ (III: 26), in späterer Terminologie geredet: die „Unschuld des Werdens“ (VI: 96), zu rehabilitieren. Dazu gehört, das bisher noch nicht hinreichend Erforschte oder als a-moralisch ins Abseits Gedrängte am Menschen ins Licht zu holen und in seinen produktiven Momenten geltend zu machen. Nietzsche tat dies im Zuge seiner Diagnose einer kulturellen Schwächeperiode, der er, seinen wehmütigen Blick beharrlich auf die Renaissance als Stärkeperiode der Menschheitsgeschichte heftend, nichts Gutes abzugewinnen vermochte. Das Verstehen, so Nietzsche in diesem Zusammenhang, sei, ähnlich wie das Sich-Verstellen, weniger unter den stolzen denn „unter den ängstlichen Völkern zu Hause“ (III: 135), weil und insofern es die Furcht vor dem Fremden zu mildern verspricht. Nicht-Verstehen war für Nietzsche mithin Teil eines auf Nicht-Nivellierung des Neuen abstellenden Programms. Dies war aber nicht verbunden mit einem Generalverdacht gegen ‚das‘ Verstehen als Methode. Eben deswegen vermochte Nietzsche einer Nächstenliebe, die als „eine milde, betrachtsame, gelassene Freundlichkeit“ (III: 282) aufzutreten verstünde, durchaus Sinn abzugewinnen.
Kommen wir zum Schluss: M markiert den zweiten Höhepunkt in Nietzsches Schaffen und steht für die konsequente, nun auch um stärker antichristliche Akzente bereicherte Fortführung der anti-metaphysischen Programmatik, wie sie Nietzsche seit Menschliches, Allzumenschliches umtreibt. Und M gibt einen Vorbegriff jenes neuen, psychologisch aufgeklärten Bildungsprogramms, wie es Nietzsche dann im Zarathustra in dichterischer Sprache umreißen wird. Erstaunlich an den von Nietzsche gegenüber Heinrich Köselitz herausgestellten zahlreichen „unausgesprochenen Gedanken“ (6: 160) dieses Werkes ist vor allem das Ausmaß, in welchem Nietzsche zentrale Programmformeln der Psychoanalyse Freuds vorwegnimmt. Dies betrifft sogar jene Entthronung des Ich, die sich Freud später, in Sachen Nietzsche nach eigener Angabe unkundig54, als sein spezifisches Verdienst zurechnen und mit dem Siegel versehen sollte, es handele sich hierbei um eine Art ‚kopernikanische Wende‘.55 So betrachtet und eingedenk subtiler Studien zum Thema56 scheint durchaus die Zeit gekommen für kritische Anfragen (in Richtung Freud) à la Michel Onfray57.