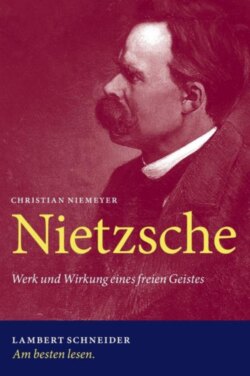Читать книгу Nietzsche - Christian Niemeyer - Страница 9
Nietzsches Nietzsche Menschliches, Allzumenschliches & Co.: Fundamente der Freigeistepoche – listig, libertär, ausbaufähig
ОглавлениеVielleicht thut jetzt, als Vorarbeit für alles zukünftige Philosophiren, nichts so noth, als Stein auf Stein, Steinchen auf Steinchen psychologische Arbeit zu häufen und tapfer jeder Mißachtung dieser Art Arbeit zu widerstreben. Zu welchen Entdeckungen wird eine spätere Generation, vermöge eines solchen Materials, kommen! (Nietzsche: NF 1876/77; VIII: 444)
Erinnern wir uns noch einmal des einleitend angeführten Zitats von Karl Schlechta aus dem Jahr 1957: Das „eigentliche Werk“, so heißt es da, beginne mit Menschliches, Allzumenschliches (in diesem Kapitel: MA).19 Dieser These wird auch hier gefolgt. Anknüpfen lässt sich dabei daran, dass dieses im Mai 1878 erschienene Werk zusammen mit den zwei Nachträgen Vermischte Meinungen und Sprüche (1879; in diesem Kapitel: VM) und Der Wanderer und sein Schatten (1880; in diesem Kapitel: WS) – zusammen: Menschliches, Allzumenschliches II – für einen „radikalen stilistischen und inhaltlichen Wandel in Nietzsches Schaffen“20 steht. Stilistisch meint: Nietzsche entdeckt den Aphorismus als die sowohl seinem Anliegen als auch seinen Lebensumständen gegenüber angemessene Redeform. Inhaltlich meint: Nietzsche liest Wagner und die Basler Professur – so sein rückblickender Kommentar aus Ecce homo – als seinen „Fehlgriff“, als Hinweis auf eine „Gesammt-Abirrung [s]eines Instinkts“, und er entdeckt, „dass es die höchste Zeit war, mich auf mich zurückzubesinnen“ (VI: 324). Sowie: Nietzsche nimmt eine Thematik wichtig, die ihn bisher eher am Rande interessierte und über die das hier als Motto vorangestellte Zitat ebenso Auskunft gibt wie seine Bemerkung aus MA, der „gelehrtere Ausdruck“ für sein „Nachdenken über Menschliches, Allzumenschliches“ laute: „die psychologische Beobachtung“ (II: 57).
Dass und wie sehr das Ganze auch mit Wagner und mit schmerzlich sich vollziehender Wagnerabkehr zu tun hat, verdeutlicht Nietzsches Erläuterung von 1886, es gehe in VM und WS um „Fortsetzung und Verdoppelung einer geistigen Kur, nämlich der antiromantischen Selbstbehandlung, wie sie mir mein gesund gebliebener Instinkt wider eine zeitweilige Erkrankung an der gefährlichsten Form der Romantik selbst erfunden, selbst verordnet hatte.“ (II: 371) Wie in MA geht es also auch in VM und WS um Nietzsches Emanzipation von Wagner und entsprechend um (allerdings zumeist verklausulierte) Kritik an ihm. Sie gipfelt in dem Urteil, Wagners Art der „Aneignung der altheimischen Sagen“ stünde für „den allerletzten Kriegs- und Reactionszug […] gegen den Geist der Aufklärung“ (VM; II: 451). Es ist dieser Hintergrund, der Nietzsches Klage verständlich macht, „Krankheit dieses Jahrhunderts“ sei die Tendenz der Völker, „noch mehr national“ werden zu wollen, um anzufügen, wer so denke, sei „ein Feind der guten Europäer, ein Feind der freien Geister.“ (WS; II: 593) Denn natürlich spielt zumal dieser Nachsatz auf Nietzsches ‚Feind‘ Wagner an, den Nietzsche auch im späteren Verlauf dieser Aphorismensammlung unter der Maske „Prediger des Franzosenhasses“ (WS; II: 652) auftreten lässt21, während er selbst sich in der Linie von MA 475 als ‚guten Europäer‘ auszulegen beginnt. Dass derlei Kritik an Wagner zumindest implizit auch Selbstkritik war, zeigt der Umstand, dass Nietzsche plötzlich einräumt, „der Zusammen- und Fortklang alles Men[s]chlichen“ sei „ebenso sehr das Werk von Cyklopen und Ameisen als von Genie’s.“ (VM; II: 186) Denn immerhin hatte Nietzsche noch Anfang 1871 unter dem Einfluss Wagners glatt das Gegenteil behauptet und „die herrliche Kultur mit einem bluttriefenden Sieger“ (I: 767) verglichen.
Um die Tiefe dieses Paradigmenwechsels nachvollziehen zu können, muss man sich vor Augen führen, wie sehr Nietzsche Wagner verehrte und wie lange: nicht lediglich fünfzehn Monate, wie neuerdings Martine Prange mutmaßt22, sondern mindestens vier Jahre, vom November 1868 an gerechnet.23 Und wie sehr? Dies sei vorerst nur durch zwei Dokumente unterstrichen. In einem dieser Texte, Nietzsches Brief an Erwin Rohde vom 28. Januar 1872 (zu einer Zeit also, zu der Nietzsche, ginge es nach Prange, schon seit fast einem Jahr kein Wagnerianer mehr ist), findet sich die bemerkenswerte Äußerung: „Ich habe mit Wagner eine Alliance geschlossen. Du kannst Dir gar nicht denken, wie nah wir uns jetzt stehen und wie unsre Pläne sich berühren.“ (3: 279) Das zweite Dokument ist fast in diesem Geist gehalten: Nietzsche versichert im Oktober des nämlichen Jahres, fast vier Jahre nach Beginn dieser verhängnisvollen Freundschaft: „[I]hn [Wagner] zu befriedigen reizt mich mehr und höher als irgendeine andre Macht.“ (4: 72f.)
Freilich, und auch dies muss man zugestehen: Der Wind begann sich durchaus früher zu drehen als erst 1876 infolge der ersten Bayreuther Festspiele. Als wichtiges Fanal gilt Nietzsches Publikationsverzicht in Sachen Bildungsvorträge im Februar 1873.24 Klartext in dieser Sache sprach Nietzsche erstmals (allerdings nur für sich) in einem Vorwortentwurf zu MA von Ende 1876–Sommer 1877: „Lesern meiner früheren Schriften will ich ausdrücklich erklären, daß ich die metaphysisch-künstlerischen Ansichten, welche jene im Wesentlichen beherrschen, aufgegeben habe: sie sind angenehm, aber unhaltbar.“ (VIII: 463) Die hier angedeutete Scham ob jener ‚früheren Schriften‘ gab Nietzsche im Sommer 1878 gar Anlass zu der erstaunlichen, allerdings wiederum nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickenden Bitte: „Ich wünsche dass billig denkende Menschen dieses Buch als eine Art Sühne dafür gelten lassen, dass ich früher einer gefährlichen Aesthetik Vorschub leistete: deren Bemühen war, alle aesthetischen Phänomene zu ‚Wundern‘ zu machen – – ich habe dadurch Schaden angestiftet, unter den Anhängern Wagner’s und vielleicht bei Wagner selbst […]. Dies bedauere ich sehr.“ (VIII: 531) Immerhin: Auch der dann veröffentlichte Text war in dieser Frage weitgehend unmissverständlich. So lesen wir beispielsweise: „[M]it Religion, Kunst und Moral rühren wir nicht an das ‚Wesen der Welt an sich‘; wir sind im Bereich der Vorstellung, keine ‚Ahnung‘ kann uns weitertragen.“ (MA; II: 30) Dies ging gegen Wagner, aber auch gegen dessen – und Nietzsches frühes – Idol Schopenhauer, über den Nietzsche noch Jahre später spotten wird: „Die Musik offenbart nicht das Wesen der Welt und ihren ‚Willen‘, wie es Schopenhauer behauptet hat […]: die Musik offenbart nur die Herren Musiker!“ (XII: 77f.)
Nimmt man zahllose weitere Äußerungen dieser Art hinzu (etwa XI: 163f.; II: 623; IV: 35ff.; XII: 118), steht man einigermaßen ratlos vor Urteilen derart, Themen des Frühwerks seien im Spätwerk „fortgeschrieben“25 worden, Nietzsche habe „schon in seinen frühen Schriften zu der ‚Aufgabe‘, den wichtigsten Themen und leitenden Unterscheidungen seines Philosophierens gefunden“26 sowie, dezidiert auf das hier in Rede stehende Werk bezogen: MA sei eine „Fortsetzung“ der Geburt der Tragödie und diese selbst „die Grundlage der Spätwerke“ – eine Einschätzung, die erkennbar Folge des Umstandes ist, dass der so Urteilende (Matthew Meyer27) den Eindruck ernst nimmt, den Nietzsche in Ecce homo zu erwecken sucht (s.S. 105). Deswegen sei hier, zugleich in einem Akt des Widerspruchs gegen die zuvor aufgelisteten Positionen, festgehalten: Nietzsche hat (1.) ab 1876/77 bis hin zu Ecce homo fast alles an seinem Frühwerk für falsch und verfehlt erklärt. Nietzsches (2.) zentraler Einwand gegen das Frühwerk verschafft sich Ausdruck in einem Paradigmenwechsel zugunsten der Psychologie als neuer Leitwissenschaft, die auch im Fall Wagner weitergeholfen hätte, wie die Bemerkung zeigt: „Mein Gemälde Wagner’s ging über ihn hinaus, ich hatte ein ideales Monstrum geschildert, welches aber vielleicht im Stande ist, Künstler zu entzünden. Der wirkliche Wagner, das wirkliche Bayreuth war mir wie der schlechte allerletzte Abzug eines Kupferstichs auf geringem Papier. Mein Bedürfniß, wirkliche Menschen und deren Motive zu sehen, war durch diese beschämende Erfahrung ungemein angereizt.“ (VIII: 495)
Wer genau hinschaut, kann sich übrigens nicht dem Eindruck entziehen, Nietzsche habe damals in Versuchung gestanden, seine 1873er Philippika Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne auf Wagner und Bayreuth anzuwenden, und zwar mit nämlichem Befund: „Im Menschen“ – so Nietzsche damals, in einem, wie die 1886er Vorrede zu MA II andeutet, wohl nicht umsonst „geheim gehaltene[n] Schriftstück“ (II: 370) – „kommt die Verstellungskunst auf ihren Gipfel: hier ist die Täuschung […], das Maskirtsein, die verhüllende Convention, das Bühnenspiel vor Anderen und vor sich selbst […] so sehr die Regel und das Gesetz, dass fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen konnte.“ (I: 876) Das Ganze klingt nach einem zweiten Rousseau – und wie das Porträt eines dekadenten Wagner in Bayreuth.
Und damit nun liegt auch die zweite Assoziation nahe: Einer jener ‚wirklichen Menschen‘, deren Motive Nietzsche im Frühling-Sommer 1878 als Ausgleich zur ‚beschämenden‘ Wagnererfahrung kennenzulernen wünschte, war der jüdische Philosoph Paul Rée. Mit ihm, dem fünf Jahre Jüngeren, freundete sich Nietzsche im März 1876 an, was sechs Jahre gut und immer besser ging – bis beide sich, leider unglücklich, also einseitig, in dieselbe Dame verliebten: Lou von Salomé. Ungeachtet des dadurch unvermeidlichen Bruchs auch mit Rée hielt Nietzsche beiden, als Menschen, die Treue, wie sein Brief an Malwida von Meysenbug von Mitte Mai 1884 belegt. Ihren Vorwurf nämlich, Rée wie Salomé stünden für eine „greuliche Denkweise“, konterte Nietzsche mit dem Argument, dass er gerade diese „höchst anziehend“ fand, hinzusetzend, mit einer weiteren kleinen Spitze gegen seine angeblich so „geduldige, mütterliche“28 Freundin: „Es sind im Grunde bisher die zwei einzigen Personnages gewesen, welche ich frei fand von dem, was ich, in Bezug auf das gute alte Europa, die ‚moralische Tartüfferie‘ zu nennen pflege.“ (6: 504)
So betrachtet überrascht nicht, dass Rée rasch Nietzsches wichtigster Freund und Ideengeber wurde – so sehr, dass Nietzsche sich am 10. August 1878 brieflich mit Seitenblick auf dessen Aphorismensammlung Psychologische Betrachtungen (1875) den Scherz erlauben konnte: „Alle meine Freunde sind jetzt einmüthig, daß mein Buch von Ihnen geschrieben sei und herstamme: weshalb ich zu dieser neuen Autorschaft gratulire.“ Nietzsche wusste – und konnte dieses Wissen bei Rée voraussetzen –, dass sein Anteil an der (vorübergehend) gemeinsamen Sache, dem „Réealismus“ (5: 346), außer Frage stand.
Bei Wagner verhielt sich die Sache ganz anders: Er goss all seinen Hohn und Spott in das bittere Wort „Réekleckse“29 und reflektierte damit auf die legendenumwobene ‚Bayreuthflucht‘ und den nach den (ersten) Bayreuther Festspielen (1876) unvermeidlichen Bruch mit Nietzsche sowie den Umstand, dass er mit Rée sowie einem Baseler Studenten auf Einladung Malwida von Meysenbugs den folgenden Herbst und Winter in Sorrent verbracht hatte, vertieft in gemeinsame Arbeit, aus der, was Nietzsche angeht, MA resultierte. Fortan galt Nietzsche in Bayreuther Lesart als Nihilist30 sowie als Opfer des Juden Rée und dessen Begeisterung für die französische Aufklärung.31
Interessant sind die zahllosen Erzählvarianten Nietzsches zu diesem Vorgang. Berührend ist jene in der Vorrede zur 1886er Neuausgabe: „Die grosse Loslösung kommt für solchermaassen Gebundene plötzlich, wie ein Erdstoss: die junge Seele wird mit Einem Male erschüttert, losgerissen, herausgerissen, – sie selbst versteht nicht, was sich begiebt. […] [E]ine heftige gefährliche Neugierde nach einer unentdeckten Welt flammt und flackert in allen ihren Sinnen. ‚Lieber sterben als hier leben‘ – so klingt die gebieterische Stimme und Verführung: und dies ‚hier‘, dies ‚zu Hause‘ ist Alles, was sie bis dahin geliebt hatte!“ (II: 16) Der Schmerz wird hier noch deutlich, die bittere Enttäuschung – anders als in der eher nüchternen Variante vom Sommer 1885: „Es war im Sommer 1876. Damals stieß ich, wüthend vor Ekel, alle Tische von mir, an denen ich bis dahin gesessen hatte, und ich gelobte mir, lieber zufällig und schlecht, lieber von Gras und Kraut und unterwegs, wie ein Thier, lieber gar nicht mehr zu leben als meine Mahlzeiten mit dem ‚Schauspieler-Volk‘ und den höheren ‚Kunstreitern des Geistes‘ […] zu teilen: – denn ich […] zürnte und tobte darüber, dort geliebt zu haben, wo ich hätte verachten sollen.“ (XI: 683) Dieses Zitat zeigt die tiefe Verunsicherung Nietzsches darüber, sich Wagner dermaßen weitgehend ausgeliefert zu haben – mit Folgen, die sich beispielsweise in seinem Anfang 1871 nach einem Weihnachts- und Silvesterbesuch in Tribschen verfassten Fragment einer erweiterten Form der ‚Geburt der Tragödie‘ besichtigen lassen: Nietzsche lässt sich hier darüber aus, dass die Würde eines Menschen davon abhänge, ob er „bewußt oder unbewußtes Werkzeug des Genius ist“, deutlicher: „[N]ur als völlig determiniertes, unbewußten Zwecken dienendes Wesen kann der Mensch seine Existenz entschuldigen.“ (I: 348) Sätze wie diese, eines Fanatikers würdig und von Nazis wie Heinrich Härtle wegen des hier zur Anerkennung gebrachten Führer/Gefolgschaftstheorems begrüßt32, lassen den Normalsterblichen fassungslos zurück. Immerhin wird so vielleicht das – zumeist verhüllte – Ausmaß der Erbitterung des zur Einsicht in dieser Frage gekommenen Nietzsche über den Umstand nachvollziehbar, dass er im Fall Wagner „Vergrößerungsgläser“ nutzte, „welche die Hoffnung uns giebt.“ (XI: 258)
Sehr weit freilich gedieh Nietzsches Nachdenken über die Gründe für seine jugendphasentypische Wagner-Idolatrie nicht. Trotz auf der Hand liegender Indizien für eine veritable Vaterübertragung Nietzsches33 reichte es beim Betroffenen selbst lediglich zu fallübergreifend analytischen Sätzen wie: „Jugend selber ist etwas Fälschendes und Betrügerisches.“ (XI: 670) Oder: „[U]nsere Eitelkeit, unsere Selbstliebe [fördert] den Cultus des Genius’: denn nur wenn dieser ganz fern von uns gedacht wird, als ein miraculum, verletzt er nicht.“ (MA; II: 151) Hiermit hatte Nietzsche zugleich seinen eigenen, um Wagner betriebenen Geniekult demontiert.34 Das Wagnerkapitel in Nietzsches Biographie war damit der Hauptsache nach abgeschlossen. Ersatzweise dominierte der bissige Rückblick, dessen Höhepunkt im Nachlass vom Frühjahr 1880 erreicht ist: „Die Genieverehrung ist oft eine unbewußte Teufelanbetung gewesen.“ (XI: 58)
Nietzsches Rache für Wagners Missbrauch seiner (gläubigen) Person war weitgehend und subtil. Schon seine plötzliche Vorliebe für Voltaire spricht Bände. Denn an sich war Nietzsche zunächst Anhänger Rousseaus gewesen35, wie ein Schreiben vom 28. Juli 1862 belegt: Nietzsche, damals siebzehn Jahre alt und im Pfarrhaus seines Onkels und Vormundes Edmund Oehler in Gorenzen die Ferien verbringend, empfiehlt seinem Pfortenser Klassenkameraden Raimund Granier die Lektüre von Rousseaus Émile, „von dem Sie etwas Natürlichkeit und Bildung lernen könnten, auch, daß man seine Versprechen halten müsse.“ (1: 216) Das Buch, das es Nietzsche angetan hatte, stand damals, einhundert Jahre nach seinem Erscheinen, hoch im Kurs. Das „Sie“ im Brief hingegen war Pose, so redet ein „homme étudié en lettres“, als welcher Nietzsche zeichnet. Über fünfzehn Jahre später, am 3. Dezember 1877, weist Nietzsche seinen Verleger an, sein neues Buch MA mit einer Widmung an Voltaire zu versehen und pünktlich zur Feier von dessen 100. Todestag im Mai 1878 erscheinen zu lassen (5: 293).36 Diese Widmung sorgte in Bayreuth für helle Aufregung und veranlasste Cosima zu dem Scherz, „dass, wenn unter allen Menschen einer, der hiermit gefeierte Voltaire die Geburt der Tragödie nicht verstanden haben würde!“37 Einen deftigen Paradigmenwechsel also konstatierte die Dame, dies zumal im Rückblick auf Nietzsches von ihrem Gatten noch gefeierten Erstling von 1872: ein Paradigmenwechsel weg vom Wagnerianer Nietzsche hin zum Freigeist Nietzsche, der den Eindruck erweckt, er sei nun Voltairianer. Jahre später wird Nietzsche die Widmung denn auch damit begründen, dass Voltaire „ein grandseigneur des Geistes“ gewesen sei: „genau das, was ich auch bin. – Der Name Voltaire auf einer Schrift von mir – das war wirklich ein Fortschritt – zu mir …“ (6: 322)
Liest man diesen Satz seinem Subtext nach, dann lautet er: ‚Der Name Rousseau, noch 1862 von mir hochgehalten, war ein Rückschritt, eine Entfernung von dem, was mir eigen ist.‘ Worin aber gründet der fundamentale Gegensatz, den Nietzsche nun zwischen sich und Rousseau auszumachen meint? Seine 1862er Belehrung gegenüber Granier, man könne von Rousseau das Einhalten von Versprechen lernen, deutet eine Richtung an: So zu reden, entsprach nicht mehr dem Freigeist Nietzsche, der um 1876 anhebt, sich Voltaire als neues Idol erwählt und dem Rousseau von nun an nichts weiter ist als eine „Moral-Tarantel“, die vom „moralischen Fanatismus“ (III: 14) umgetrieben werde. Folgerichtig war Nietzsches Anti-Fanatismus-Kur, ausgehend von dem Programmsatz: „Allen moralischen Systemen, welche befehlen, wie der Mensch handeln soll, fehlte die Kenntniß und Untersuchung, wie der Mensch handelt.“ (IX: 266) Indes: Ob Nietzsche mit diesem Satz dem Auch-Psychologen Rousseau nicht sehr viel näher stand als dem Nicht-Psychologen Voltaire, ist eine durchaus offene Frage.
Deswegen sei hier noch eine zweite Fährte erprobt, um den Wandel in Nietzsches Rousseau-Bewertung bei gleichzeitiger Hochschätzung Voltaires zu erklären: diejenige, die sich über Wagners Voltaire-Bild eröffnet. Die These ist simpel: Voltaire war eigentlich immer Wagners Aufreger gewesen, so dass Nietzsches Ehrgeiz dahin gegangen sein dürfte, Wagner im Moment des Bruchs zwischen beiden durch ein demonstratives Bekenntnis zu dessen Antipoden zum Nachdenken zu zwingen. Diese Erwartung betraf auch Wagners Engagement als geistiger Mentor für den ihm zu dieser Zeit gänzlich verfallenen bayerischen König Ludwig II., der ihm seit Oktober 1864 (für zunächst drei Jahre) als Sponsor zur Verfügung stand und dem Wagner klarzumachen suchte, dass seine Rolle jedenfalls nicht die eines zweiten, gleichsam deutschen Voltaire sei.38
In welche Richtung Wagner Ludwig II. ersatzweise zu lenken gedachte, wird deutlich, wenn man Wagners speziell für den König verfasste Tagebuchaufzeichnungen vom September 1865 heranzieht. Sie erlauben den Schluss, dass Wagner im Interesse einer gedeihlichen Sicherstellung wahrhaften Deutschtums für sich am bayerischen Hof jenen Platz beanspruchte, den Voltaire vorübergehend und mit hemmenden Folgen für die Regeneration des deutschen Geistes in Sanssouci innegehabt hatte.39 Nietzsches giftige Reaktion auf Wagners aus den Tagebuchaufzeichnungen entwickelte Schrift Was ist deutsch? (1878) in Gestalt seines Aphorismus: „Gut deutsch sein heisst sich entdeutschen“ (VM; II: 511) ist, so betrachtet, vom gleichen Kaliber wie die im Mai 1878 mit der Voltaire-Widmung zu MA greifende Entwindung Voltaires aus den Klauen eines zum Deutschtum wild entschlossenen Wagner: Hier wie da ging es darum, ein Zeichen zu setzen und deutlich zu machen, dass er jedenfalls sich nicht länger vor Wagners Karren spannen lassen wollte und, dieses Zwecks wegen, pro Voltaire argumentierte.
So betrachtet mag außer Frage stehen, dass Nietzsches überraschendes 1878er Bekenntnis zu Voltaire mindestens auch Geste war und als solche vergleichsweise schnell ausgespielt hatte, sprich: bei der Neuausgabe 1886 sang- und klanglos entfiel – auch, weil Nietzsche, wie Henning Ottmann40 mit einem Nietzsche-Wort mutmaßte, die von Voltaire ins Zentrum gerückten Themen Ehe und Kirche für „zu Ende gespottet“ (MA; II: 201) hielt. Des Weiteren mag verständlich sein, dass jene Geste die nächste nach sich zog, nämlich die der Abwertung des Voltaire-Antipoden Rousseau. Damit ist aber die Frage noch nicht erledigt, was Nietzsche denn, abzüglich dessen, an Rousseau der Sache nach störte.
Bei einer Antwort auf diese Frage wird man kaum an dem Umstand vorbeigehen können, dass Nietzsche Rousseau als Teil jenes „Strom[s] moralischer Erweckung“ (WS; II: 650f.) ansah, der Europa im 18. Jahrhundert durchzogen habe, um mahnend anzufügen: „Ihre [der Aufklärung; d. Verf.] Gefährlichkeit ist dadurch fast grösser geworden, als die befreiende und erhellende Nützlichkeit, welche durch sie in die grosse Revolutionsbewegung kam. Wer diess begreift, wird auch wissen […], von welcher Verunreinigung man sie zu läutern hat: um dann, an sich selber, das Werk der Aufklärung fortzusetzen und die Revolution nachträglich in der Geburt zu ersticken, ungeschehen zu machen.“ (WS; II: 654) Diese Mahnung darf man wohl so übersetzen, dass eine politische Umwälzung dann entbehrlich sei, wenn man sich selbst in die Zucht der Selbstaufklärung nimmt und den – angeblich von Rousseau verscheuchten – Geist der Aufklärung „bei sich selber“ (WS; II: 299) zurückruft, um so jeder von außen kommenden Tugendlehre für alle Zeiten enthoben zu sein: eben als Freigeist.
Dies nun wiederum hilft, die psychologischen Beiträge, die Nietzsche in MA und seinen zwei Nachträgen zutage förderte, genauer einzuordnen. Zusammengehalten werden sie durch den Programmsatz: „Der wissenschaftliche Mensch ist die Weiterentwicklung des künstlerischen.“ (MA; II: 186) Diese Formulierung gab das Signal für eine Neuorientierung, auf deren Höhepunkt (1884) Nietzsche ganz im Geist der von ihm nun verfochtenen, primär anti-christlichen „neue[n] Aufklärung“ (XI: 295) ausrufen wird: „Nicht eine Philosophie als Dogma, sondern als vorläufige Regulative der Forschung.“ (XI: 266) Dabei muss man beachten, dass Nietzsche noch in der Geburt der Tragödie „den mit höchsten Erkenntniskräften ausgestatteten, im Dienste der Wissenschaft arbeitenden theoretischen Menschen“ (I: 116) der Lächerlichkeit preisgegeben hatte, um ihn durch den sich nicht zuletzt in der Figur Wagners explizierenden künstlerischen Menschen zu überbieten. Die nun (ab MA) geltende Wahrheit Nietzsches war eine andere, gegenläufige, und sie lässt sich in einem Satz bündeln: ‚Der Wissenschaftler Nietzsche ist die Weiterentwicklung des Künstlers Wagner‘.41
Erstaunlich ist dabei der psychologische Feinsinn, den Nietzsche an den Tag legte und der in der Nietzscheforschung, nach zögernden Anfängen42, zunehmend Beachtung findet.43 So notierte sich Nietzsche beispielsweise zum Stichwort ‚Liebe‘: „[J]ene Zahllosen, welche Liebe vermissen, von Seiten der Eltern, Kinder oder Geliebten, namentlich aber die Menschen der sublimirten Geschlechtlichkeit, haben im Christenthum ihren Fund gemacht.“ (VM; II: 425) Nicht minder grandios ist Nietzsches – Freud vorgreifende – Einsicht: „Unsere Träume sind […] symbolische Scenen- und Bilder-Ketten an Stelle einer erzählenden Dichter-Sprache.“ (WS; II: 639) In der Summe zielte Nietzsche mit der Herausstellung derartiger Sachverhalte auf Infragestellung des Glaubens an die „Willens-Freiheit“ und der daraus entspringenden „Grundempfindung […], dass der Mensch der Freie in der Welt der Unfreiheit sei, der ewige Wunderthäter.“ (WS; II: 547f.) Das Gegenteil sei richtig: „Ueber dem Einen steht die Nothwendigkeit in der Gestalt seiner Leidenschaften, über dem Andern als Gewohnheit zu hören und zu gehorchen, über dem Dritten als logisches Gewissen, über dem Vierten als Laune und muthwilliges Behagen an Seitensprüngen.“ (WS; II: 545) Man sieht: Nietzsche redet hier sowohl von der durch Erziehung bewirkten Unfreiheit (‚Gewohnheit zu hören und zu gehorchen‘) als auch von Notwendigkeiten, die Folge von Temperament (‚Leidenschaften‘) oder Charakter (‚Laune‘) des Einzelnen sind.
Insoweit gilt nach Nietzsche auf diesem seinem Stand des Wissens: Der Mensch mag sich nach Freiheit sehnen, aber er ist zunächst einmal in vielfältiger Hinsicht gebunden und sieht sich diversen Notwendigkeiten unterworfen. Sowie: Der Versuch des Menschen, sich das, was er, der Notwendigkeit folgend, tut, als Tugend zuzurechnen, ist in Nietzsches Sicht nur das höchst fragwürdige Bemühen, das je in Rede stehende ‚Lebensgefühl‘ zu adeln, also – um an die erwähnten vier Notwendigkeiten anzuknüpfen – mal die ‚Leidenschaft‘, mal die ‚Pflicht‘, mal die ‚Erkenntniss‘, mal den ‚Muthwillen‘. Insoweit hat Nietzsche mit dieser Überlegung zwar nicht den Weg zur Freiheit vollständig durchmessen, wohl aber gezeigt, in welcher Richtung er sich auf jeden Fall nicht verbirgt: eben in der Linie der Lehre von der Willensfreiheit. Sie nämlich – so müssen wir Nietzsche verstehen – sei so lange Metaphysik, solange sie unbesorgt bleibt um die der einzelwissenschaftlichen Forschung harrenden psychologischen Abgründe, welche sich in der menschlich-allzumenschlichen Umdeutung des den Menschen Notwendigen in ein von ihm Gewolltes offenbaren. So betrachtet steht MA für einen ersten Höhepunkt in Nietzsches Schaffen, wie selbst noch die hübsche, in Ecce homo nachgereichte Inhaltsangabe erkennen lässt: „Ein Irrthum nach dem andern wird gelassen aufs Eis gelegt, das Ideal wird nicht widerlegt – es erfriert … Hier zum Beispiel erfriert ‚das Genie‘; eine Ecke weiter erfriert ‚der Heilige‘; unter einem dicken Eiszapfen erfriert ‚der Held‘; am Schluss erfriert ‚der Glaube‘, die sogenannte ‚Überzeugung‘, auch das ‚Mitleiden‘ kühlt sich bedeutend ab – fast überall erfriert ‚das Ding an sich‘…“ (VI: 323)
Mit der zuletzt genannten Vokabel verwies Nietzsche den Leser auf den ersten Aphorismus. Kritisiert wird in ihm, in einer grundlegenden Absetzung von zweitausend Jahren Philosophiegeschichte44, die „metaphysische Philosophie […], insofern sie die Entstehung des Einen aus dem Andern leugnete und für die höher gewertheten Dinge einen Wunder-Ursprung annahm, unmittelbar aus dem Kern und Wesen des ‚Dinges an sich‘ heraus.“ Ersatzweise bringt Nietzsche, in Vorwegnahme Freuds45, das Stichwort „Sublimirung“ (MA; II: 23) ein und lobt eine noch zu entwickelnde „historische Philosophie“, in deren Logik sich sowohl „im Gross- und Kleinverkehr der Cultur und Gesellschaft“ als auch „in der Einsamkeit an uns“ noch zeigen werde, dass auch auf dem Gebiete der Kultur und Gesellschaft, ähnlich wie in der Chemie, „die herrlichsten Farben aus niedrigen, ja verachteten Stoffen gewonnen sind.“ (MA; II: 24)
Dieser Grundgedanke hat seine Bedeutung u.a. für Morgenröthe, aber auch noch für das Spätwerk. Hingewiesen sei nur auf den Eröffnungsabschnitt von Jenseits von Gut und Böse: Nietzsche kritisiert hier die „Metaphysiker aller Zeiten“, die erfolglos einen „eigenen Ursprung“ für „die Dinge höchsten Werthes“ „im Schoosse des Sein’s, im Unvergänglichen, im verborgenen Gotte, im ‚Ding an sich‘“ suchten bzw. gesucht hätten. Und auch diesmal hält Nietzsche, ähnlich wie schon 1878, derlei Metaphysik seine These entgegen, dass jene „Dinge höchsten Werthes“ in jedem Fall aus dem je Gegebenen, also „aus dieser vergänglichen verführerischen täuschenden geringen Welt, aus diesem Wirrsal von Wahn und Begierde“ (V: 16) ableitbar sein müssten. In der zentralen Frage ist sich Nietzsche diesmal sicher: „Fast Alles, was wir ‚höhere Cultur‘ nennen, beruht auf der Vergeistigung und Vertiefung der Grausamkeit – dies ist mein Satz; jenes ‚wilde Thier‘ ist gar nicht abgetödtet worden, es lebt, es blüht, es hat sich nur – vergöttlicht.“ (V: 166) Grausamkeit meint hier nicht – anders als in der in diese Richtung weisenden Kulturtheorie im Umfeld der Geburt der Tragödie – ein den Anderen versklavendes und nur auf diese Weise Kultur ermöglichendes Handeln. Grausamkeit meint vielmehr eine Art Selbstversklavung. Insoweit nimmt der ‚späte‘ Nietzsche in Weiterführung des vom ‚mittleren‘46 Vorbereiteten das vorweg, was Freud später meinen wird, wenn er sagt, die Kultur sei „auf der Unterdrückung von Trieben aufgebaut.“47
Zu beachten bleibt dabei: Wenn man die Terminologie aus jenem ersten Aphorismus von MA zum Maßstab nimmt, liegt es nahe, nicht nur eine antimetaphysische ‚historische Philosophie‘, sondern auch eine entsprechend ausgerichtete Pädagogik zu fordern und ihr abzuverlangen, sie müsse anderes elaborieren als die Vorstellung einer Art Wunder-Erziehung. Ähnlich – so Nietzsche in dem mit dieser Überschrift versehenen Aph. 242 –, „wie die Heilkunst erst erblühen konnte, als der Glaube an Wunder-Curen aufhörte“, wird das Interesse an der Erziehung „erst von dem Augenblick an grosse Stärke bekommen, wo man den Glauben an einen Gott und seine Fürsorge aufgiebt.“ (MA; II: 202) Dies war nichts anderes als eine Kampfansage an die Adresse jeder theologisch unterlegten Erziehungsmetaphysik, die selbsterlebte eingeschlossen.
Um dies zu erkennen, muss man Nietzsches pädagogische Erfahrung in Betracht ziehen48, als deren Extrakt der Satz zu gelten hat: „Nur von Selbst-Erziehung sollte man als Denker reden. Die Jugend-Erziehung durch Andere ist entweder ein Experiment, an einem noch Unerkannten, Unerkennbaren vollzogen, oder eine grundsätzliche Nivellirung, um das neue Wesen, welches es auch sei, den Gewohnheiten und Sitten, welche herrschen, gemäss zu machen: in beiden Fällen also Etwas, das des Denkers unwürdig ist, das Werk der Eltern und Lehrer, welche Einer der verwegenen Ehrlichen nos ennemis naturels genannt hat.“ (WS; II: 667f.) Den Einzelnen ‚den Gewohnheiten und Sitten, welche herrschen, gemäss zu machen‘ – dies also war für Nietzsche der eigentliche, der das Aufkommen des Neuen behindernde, an seiner Person exekutierte epochetypische Erziehungsskandal. Folgerichtig spürte Nietzsche denn auch dem „Ursprung der Sitte“ nach und fand ihn vor allem in dem Gedanken: ‚„[D]ie Gemeinde ist mehr werth als der Einzelne‘“, um bitter klagend anzufügen: „Ob nun der Einzelne von einer Einrichtung leide, die dem Ganzen frommt, ob er an ihr verkümmere, ihretwegen zu Grunde gehe, – die Sitte muss erhalten, das Opfer erbracht werden.“ Auch hier gilt: Man muss nur wenig von Nietzsches Erziehung wissen, um zu sehen, dass er selbst es ist, der sich hier in verklausulierter Form als „Opfer“ der in Gestalt seiner Mutter auftretenden ‚Naumburger Tugend‘ zur Anzeige bringt – und der denen, die diese seine Opfergabe auf der Ebene ihrer Gesinnung, also nach Maßgabe dessen, was sie ihre „Sittlichkeit“ heißen, heiligsprechen, zu bedenken gibt, „dass der Einzelne mehr werth sein könne als Viele.“ Die Mehrheit freilich, so viel ist Nietzsche klar, sieht dies anders. Sie teilt nicht die von ihm hier vorgetragene „Philosophie des Opferthieres“, „und so bleibt es bei der Sitte und der Sittlichkeit“, deutlicher gesprochen: „So kommt es fortwährend vor, dass der Einzelne sich selbst, vermittels seiner Sittlichkeit, majorisiert.“ (VM; II: 412)
Damit wird die Frage drängend nach Nietzsches Alternative. Was Nietzsche offeriert, ist die Idee, dass auch die Pädagogik, wenn sie Wissenschaft werden und nicht länger angewandte Metaphysik bleiben will, lernen muss, „gute[r] Nachbar der nächsten Dinge [zu] werden“ (WS; II: 703), etwas ausführlicher geredet: Was grundlegend nottut, ist, nach Nietzsche, die Widerrufung der der Metaphysik eigenen Geringschätzung „aller nächsten Dinge“, wie „zum Beispiel Essen, Wohnen, Sich-Kleiden, Verkehren“, bei gleichzeitiger übertriebener Hochschätzung der vermeintlich „‚wichtigsten Dinge‘“, zum Ausdruck gelangend beispielsweise in der (priesterlichen) Lüge, „welche von der Kindererzeugung als der eigentlichen Absicht aller Wollust redet.“ (WS; II: 541) Nietzsche wollte also beides: Er wollte mit dieser Metaphysik der Theologen Schluss machen – und folglich den aufklärerischen Gedanken zur Anerkennung gebracht wissen, dass der Sexualität ein Eigenrecht zukomme. Und er wollte, dass durch einzelwissenschaftliche Forschung die Unkenntnis in Fragen der vermeintlich banalen Dinge des täglichen Lebensvollzugs, also in Sachen „grosse und kleine Noth innerhalb der vierundzwanzig Tagesstunden“ (WS; II: 542f.), behoben wird.
Womit wir es hier zu tun haben, ist also nichts anderes als ein neuer Programmpunkt des mit Aph. 1 aus MA eingeleiteten anti-metaphysischen Feldzuges, über dessen Aufklärungscharakter die folgenden Formulierungen hinreichend belehren: „[U]nsere fortwährenden Verstösse gegen die einfachsten Gesetze des Körpers und Geistes [bringen] uns Alle, Jüngere und Aeltere, in eine beschämende Abhängigkeit und Unfreiheit […], – ich meine in jene im Grunde überflüssige Abhängigkeit von Aerzten, Lehrern und Seelsorgern, deren Druck jetzt immer noch auf der ganzen Gesellschaft liegt.“ (WS; II: 541) Deutlich erkennbar ist hier die Anspielung auf Kants Satz, Aufklärung sei der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit, vor allem aber auf die Fortführung: „Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt u. s. w.: so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.“49 Anders aber als Kant wendet Nietzsche diese Überlegung kritisch gegen die Philosophie selbst, sofern sie metaphysischen Annahmen und den Fragen nach den letzten Dingen verhaftet bleibt. Nietzsches Fazit ist denn auch unmissverständlich: „Alles Andere muss uns näher stehen, als Das, was man uns bisher als das Wichtigste vorgepredigt hat: ich meine jene Fragen: wozu der Mensch? Welches Loos hat er nach dem Tode? Wie versöhnt er sich mit Gott? und wie diese Curiosa lauten mögen […]. Wir müssen wieder gute Nachbarn der nächsten Dinge werden.“ (WS; II: 550f.)
Versuchen auch wir ein Resümee: Mit MA – sowie nachfolgend VM und WS – beginnt eine neue Phase in Nietzsches Schaffen. Inhaltlich gesehen zentral ist der Durchbruch zugunsten einer im Geist der Aufklärung vorgetragenen anti-metaphysischen und mithin gleichermaßen kultur-, religions- wie auch moralskeptisch angelegten ‚historischen‘ Philosophie (sowie Pädagogik und Psychologie), die mit den von Wagner oder Schopenhauer und den daran geknüpften Vorstellungskomplexen und Programmatiken nur noch rückversichernd und im (ideologie-)kritischen Gestus dessen umgeht, der, im Rückblick auf das Frühwerk gesprochen, einen Paradigmenwechsel beabsichtigt und ihn als notwendig sowie unhintergehbar zu beglaubigen sucht.