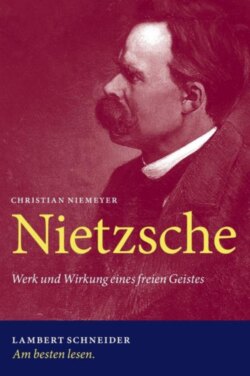Читать книгу Nietzsche - Christian Niemeyer - Страница 8
Teil A: Nietzsches Werk
ОглавлениеDas Elend der mühsam lebenden Masse muß noch gesteigert werden, um einer Anzahl olympischer Menschen die Produktion der Kunstwelt zu ermöglichen. (Nietzsche: NF Anfang 1871; VII: 339f.)
[S]ei anders, als alle Übrigen und freue dich, wenn Jeder anders ist, als der Andere (Nietzsche: NF 1880; IX: 73)
Die Schwachen und Missrathnen sollen zu Grunde gehn: erster Satz unsrer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. (Nietzsche: Der Antichrist [1888]; VI: 170)
Ich lasse eben alle Antisemiten erschiessen … (Nietzsche an Franz Overbeck am 4. Januar 1889; 8: 575)
Die hier vorangestellten vier Zitate markieren die beiden Pole, welche die anziehende, aber eben auch die abstoßende Seite Nietzsches exemplarisch versinnbildlichen – und damit eben auch die Spannung im Werk sowie die, in die derjenige gerät, der sich zu Nietzsche bekennt. Einen Rückschluss scheinen die vier Zitate zumal dem Einsteiger zu erlauben: Nietzsche begann als Fanatiker, er endete als Fanatiker – und zwischendurch, um 1880, war er ein ziemlich netter Kerl, als dessen stärkstes Statement wir vorerst den Satz aus jenem unter dem Titel L’Ombra di Venezia berühmt gewordenen Nachlasskonvolut vom Frühjahr 1880 festhalten wollen.
Bemerkenswert an diesem Nietzsche – und dies gilt es gleich zu Beginn dieses Buches herauszustellen – ist das harsche Urteil Nietzsche über seine „älteren Schriften“: „Fast überall, wo in ihnen die Rede auf Andersdenkende kommt, macht sich jene blutige Art zu lästern und jene Begeisterung in der Bosheit bemerklich, welche die Abzeichen des Fanatismus sind.“ (IX: 47) Belege bleibt Nietzsche schuldig, aber man kann sie sich leicht zusammentragen, wenn man jene ‚älteren Schriften‘ – denen das zuerst gegebene Zitat entstammt – nach dieser Maßgabe kritisch durchmustert. Das Ergebnis kann auf der Basis einer in Nietzsche verstehen12 gegebenen ausführlichen Begründung kaum fraglich sein: Jene ‚älteren‘ Schriften kommen kaum in Betracht, sie gelten ihrem Urheber, auf dem Stand des Jahres 1880 gewertet, als Spreu, nicht als Weizen.
Damit ergeben sich zahlreiche Anschlussfragen; eine von ihnen sei hier zumindest erwähnt (und zugleich beantwortet): Ja, Nietzsche war auch schon vor der Zeit seiner Wagnerverehrung ein ‚netter Kerl‘. Aber dies gehört nicht hierher und muss insofern ‚geglaubt‘ werden: exemplarisch unter Hinweis auf Nietzsches gleichsam freigeistigen Spott auf Ludwig II. aus dem Jahr 1866.13 Daraus folgt zugleich, dass für die Zwecke dieser Arbeit jene drei Nietzsches genügen: der Fanatiker 1, der Anti-Fanatiker und der Fanatiker 2. Die Frage ist schlicht: Welcher von den Dreien ist Nietzsches Nietzsche? Und welche Werke Nietzsches außer jenen älteren bezeugen dessen Geist, wichtiger vielleicht noch: Welche tun dies nicht?
Einem Einwand sei dabei gleich zuvorgekommen: Das letzte der oben angegebenen vier Zitate („Ich lasse eben alle Antisemiten erschiessen …“), eine der letzten Verlautbarungen Nietzsches aus einem jener ominösen ‚Wahnsinnszettel‘ vom Januar 1889 unmittelbar vor seinem geistigen Zusammenbruch in Turin, steht dieser Herkunft wegen, also gleichsam gattungsgemäß, unter Pathologieverdacht – und lässt sich eben deswegen mit dem unmittelbar vorhergehenden nicht vergleichen. Wirklich? Wer genau hinschaut14, wird nicht in Abrede stellen können, dass jene Overbeck-Notiz zwar Zeugnis gibt für einen partiellen Kontrollverlust – aber eben nicht für ein totales Blackout. Denn der Sache nach wird mit ihr nichts weiter variiert als die folgende Bemerkung aus dem Nachlass vom Frühjahr 1888: „Il faut tuer le Wagnerisme“, denn: „Was uns nicht umbringt – das bringen wir um, das macht uns stärker.“ (XIII: 478) Denken könnte man aber auch an den im Nachlass vom Oktober 1888 vorfindbaren Satz: „Es bleibt kein andres Mittel, die Philosophie wieder zu Ehren zu bringen: man muß zuerst die Moralisten aufhängen.“ (XIII: 602) Einigen wir uns also lieber darauf: Nietzsche neigte im Spätwerk, ähnlich wie im Frühwerk, zu extremen Formulierungen. Die Frage bleibt mithin allein: Warum? Ausführlicher geredet: Was machte, dass Nietzsche zum Fanatismus konvertierte, diesem abschwor, um schließlich doch als Fanatiker zu enden? Oder in noch kleinerer Münze geredet und unter Bezug auf die gegebenen vier Zitate: Warum formulierte Nietzsche 1871, 1888 und 1889 derart dogmatisch, auch für das Risiko des Nicht-Verstandenwerdens ob dieser Radikalität und/oder gar des Gefühls beim Leser, er habe es hier mit einem Verrückten zu tun, der keine Scheu vorm Widersprechen, aber auch vor Widersprüchen habe?
Die zuletzt verwendete Vokabel führt uns, nicht ganz unbeabsichtigt, auf die Einleitung zurück. Denn natürlich dachte Kurt Tucholsky, als er kritisierte, man fände bei Nietzsche für alles ein Zitat, nicht nur an die Nietzscheleser, sondern auch an Nietzsche, den Vorlagengeber, der für eine geradezu verwirrende Vielfalt des Angebots gesorgt habe nach dem Muster, so Tucholsky: „Für Deutschland und gegen Deutschland; für den Frieden und gegen den Frieden; für die Literatur und gegen die Literatur – was Sie wollen. Wir wollen aber gar nicht.“15 ‚Wir wollen aber gar nicht‘ – dies eben ist der springende Punkt, der selbst einen arrivierten Nietzscheforscher wie Volker Gerhardt gleichsam aus der Haut fahren ließ, als er Nietzsche vorwarf, es herrsche bei ihm ein „unbekümmerte[r] Umgang mit Widersprüchen in seinen eigenen Schriften.“16 Ist dem aber wirklich so?
Schauen wir uns die Einzelheiten etwas genauer an. Das Erste, was dabei auffällt: Nietzsche hat, als habe er sich über Tucholsky und Gerhardt lustig machen wollen, über seine eigenen Widersprüche auch noch gespottet nach dem Muster: „Dieser Denker braucht Niemanden, der ihn widerlegt: er genügt sich dazu selber.“ (II: 662) Zweitens: Möglicherweise aus schlechtem Gewissen darüber gab Nietzsche eine Fülle von Ratschlägen, wie man ihn zu lesen und zu verstehen habe17, nicht eben selten solche von durchaus schlichtem Zuschnitt, wie das folgende, Ecce homo entnommene Beispiel lehrt: „Dass aus meinen Schriften ein Psychologe redet, der nicht seines Gleichen hat, das ist vielleicht die erste Einsicht, zu der ein guter Leser gelangt.“ (VI: 305) Nun sei gern eingeräumt – in der Einleitung begegnete uns ja schon so ein Fall –, dass es Philosophen mitunter widerstrebt, sich an diesen von Ken Gemes18 mit gutem Grund ins Zentrum gerückten Ratschlag zu halten und ihnen vielleicht anderes als ‚erste Einsicht‘ auffällt, eben, um beim Thema zu bleiben: dass sich in Nietzsches Schriften zahllose ungeklärte Widersprüche fänden. So betrachtet hilft es nicht wirklich weiter, diesem Thema noch länger auszuweichen.
In der Tat, und um gleich mit einem Beispiel zu beginnen, das uns auf den Kern des Problems, den Fanatismus, zurückführt: Als Nietzsche in jener Phase anzukommen scheint, die wir bisher, sicherlich unzureichend, mit der Vokabel ‚netter Kerl‘ bezeichnet hatten, notierte er sich: „Wer die Menschheit eines Experimentes wegen vergift en wollte, würde von uns wie ein ganz gefährliches Subjekt in Banden gelegt werden; wir fordern: das Wohl der Menschheit muss der Grenzgesichtspunkt im Bereich der Forschung nach Wahrheit sein.“ (VIII: 432f.) Dies, niedergelegt Ende 1876–Sommer 1877, in jener Phase also, in der Nietzsche nach seinem Bruch mit Wagner eine neue Welt des Wissens zu entdecken beginnt, klingt wunderbar, zahm, human, fast ist man versucht zu ergänzen: kein bisschen dogmatisch oder gar fanatisch – wäre da nicht die grimme Entschlossenheit in Sachen der Verteidigung dieses nun erreichten Standpunktes. Freilich: Dies ist man fast bereit in Kauf zu nehmen eingedenk des Nietzsche vom Frühling–Sommer 1875, der sich noch, fast in nämlicher Angelegenheit, eher für das Gegenteil ausgesprochen hatte, als er sich notierte: „Mißhandelt die Menschen, treibt sie zum Äußersten, und das durch Jahrtausende – da springt, durch eine Verirrung der Natur, durch einen abspringenden Funken der dadurch entzündeten furchtbaren Energie, auf einmal der Genius hervor.“ (VIII: 95) Das Ganze klingt fast wie abgeschrieben aus einem nationalsozialistischen Lehrbuch für Übermenschen – und könnte, im Verein mit dem vorgenannten Zitat, dazu verleiten, Nietzsche eines Widerspruchs zu zeihen, um den er ‚unbekümmert‘ (Gerhardt) blieb. Ersatzweise liegt es nahe, die Rede von einem fanatischen Nietzsche ins Spiel zu bringen, der sich dann glücklicherweise doch, auf Wegen, die wir noch nicht kennen, in jenen ‚netten Kerl‘ verwandelt habe, wie er uns im vorgenannten Zitat von 1876/77 begegnet.
Dass die Sache weit komplizierter ist, zeigt der hier nun nach zureichende Nachsatz zum Zitat von 1875: „So redet die Geschichte zu mir. Schreckliches Gesicht! Weh! Ich ertrag’ dich nicht!“ (VIII: 95) Denn dies klingt fast so, als berichte Nietzsche, hilfesuchend, über den Kampf mit dem Dämon in seiner Brust, den er mal zu verlieren droht, dann aber eben doch auch, wie das Zitat von 1876/77 zeigt, siegreich gestalten kann. So betrachtet hat die Rede von Widersprüchen in Nietzsches Aussagen vergleichsweise wenig Sinn. Spannender ist schon die Frage nach jenem Kampf: seinem aus lösenden Moment, aber auch seiner Dynamik. Dass Nietzsche dies ähnlich sah und seinen Interpreten Anstrengungen in dieser Hinsicht abverlangte, zeigt seine Bemerkung aus dem Nachlass von 1880/81: „Sie machen’s sich leicht und suchen mich aus dem Übergange in’s andere Extrem zu verstehen – sie merken nichts von dem fortgesetzten Kampfe und den gelegentlichen wonnevollen Ruhepausen im Kampfe, merken nicht, daß diese früheren Schriften solchen entzückten Stillen, wo der Kampf zu Ende schien, entsprungen sind und wo man über ihn schon nachzudenken begann. Es war eine Täuschung. Der Kampf ging weiter. Die extreme Sprache verräth die Aufregung, die kurz vorher tobte und die Gewaltsamkeit, mit der man die Täuschung festzuhalten suchte.“ (IX: 432) Nicht alles an diesem Zitat kann hier schon, in dieser frühen Phase des vorliegenden Buches, als verstehbar vorausgesetzt werden; nicht alles an ihm kann verständlich gemacht werden, abgesehen von der Hauptbotschaft: Nietzsche erwartete subtiles Wissen um die Nuancen seiner Schriften und hätte Leser, die sich allein über Widersprüche oder isoliert gelesene fanatisch klingende Sätze empört hätten, vermutlich der Spreu zugerechnet, nicht dem Weizen.
Was aber, so die sich damit fast zwingend nahelegende Anschlussfrage, machen wir dann mit jenem Nietzsche, der seinerseits offenbar nicht gewillt war, sich an jenes Gebot zu halten? Der sich um Nuancen und Begründungen so gut wie nicht mehr kümmerte? Der nur bewundert werden wollte, angestaunt wie ein „fremde[s] Gewächs“ (8: 375), wenn nicht gar: gefürchtet? Kurz, und um die Provokation etwas auf die Spitze zu treiben: Was machen wir mit Ecce homo sowie mit Der Wille zur Macht (und Konsorten)? Die Antwort kann kaum fraglich sein: Beide Schriften sind Spreu, nicht Weizen. Beide Texte haben, wie wir gegen Ende dieses Kapitels unter der Überschrift Nietzsche jenseits noch sehen werden, mit Nietzsches Nietzsche so gut wie nichts zu tun.
Dies indes verlangt zuallererst nach einer Antwort auf die Frage, was es mit diesem auf sich hat. Wo also, in welchen Werken Nietzsches, betätigt sich Nietzsches Nietzsche und worin bestehen seine primäre Absicht und Zielsetzung? Und wann und wo beginnt der Verfall von Nietzsches Nietzsche, vorerst noch zögernd, wie der Titel des zweiten Hauptkapitels, Nietzsche am Rubikon, andeuten soll?