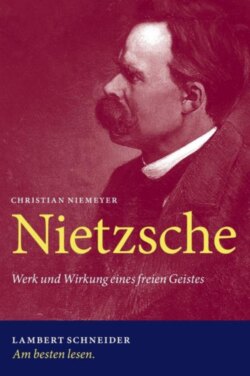Читать книгу Nietzsche - Christian Niemeyer - Страница 7
Einleitung
Оглавление[E]s wäre an der Zeit, sich das Selbstverständnis des späteren Nietzsche zu eigen zu machen und das eigentliche Werk mit „Menschliches, Allzumenschliches“ beginnen zu lassen. (Karl Schlechta: Die Legende und ihre Freunde [1957], S. 90)
Der Nietzsche, um den es hier geht, ist der ‚echte‘, zu sich selbst […] zurückgekommene Nietzsche, also der antimytische, antiromantische, antiwagnersche Nietzsche. (Mazzino Montinari: Nietzsche lesen [1982], S. 56)
Nietzsche gilt heutzutage als der meistzitierte Philosoph weltweit, wenngleich die Vokabel ‚Philosoph‘ mancherorts Bauchschmerzen verursacht. Volker Gerhardt beispielsweise, einer der führenden deutschen Nietzscheforscher, von Haus aus auch Psychologe, gab neuerdings zu bedenken: „Auch wenn sein [Nietzsches] Werk in fast allem unfertig geblieben ist, obgleich sich viele seiner Gedanken in einer exaltierten Geste erschöpfen und es in seinen Schriften kaum eine Einsicht gibt, die sich nicht schon bei anderen findet, ist er zum Klassiker der Philosophie geworden.“1 Vielleicht hat Gerhardts Skepsis, die seiner früheren Begeisterung für Nietzsches „stilistische Brillanz“ und „schonungslose Kritik“2, auch für Nietzsche als Psychologen3, deutlich kontrastiert, mit der inzwischen eingetretenen Distanz gegenüber dem eigenen Herkunftsgebiet und, damit zusammenhängend, einem der letzten Worte Nietzsches zu tun: „Es gab vor mir noch gar keine Psychologie.“ (VI: 371) Denn warum jemanden als Philosophen anerkennen, der sich so sehr als Psychologe verstand?
Von etwas anderer Art scheint die Skepsis des Kantianers Reinhard Brandt: „Nietzsche sinkt weit unter das humanitäre und intellektuelle Niveau der großen Denker des 18. Jahrhunderts zurück“, er habe die Aufklärung „nicht vorsichtig fortgeführt, sondern bedenkenlos vertan.“4 Sicherlich: Wer Nietzsche seriös liest, muss in puncto der Vokabel ‚Auflärung‘5 – um nur diesen Aspekt anzusprechen – fraglos zu einem anderen, differenzierteren Urteil gelangen. Aber dies muss nicht notwendig jene Leser stören, die in Sachen Nietzschelektüre von Ressentiments getragen sind und/oder höchst eigene, nicht eben selten politische Zwecke verfolgen. Und dass es zahllose derartige Leser gibt, habe ich in meinem Buch Nietzsche verstehen. Eine Gebrauchsanweisung (2011) zu zeigen versucht.6
Folgerichtig sind momentan zahllose Nietzsches in Umlauf – dem Prinzip folgend, das ich gegen Ende jenes Buches unter Berufung auf Kurt Tucholsky in Erinnerung gebracht habe: „Sage mir, was du brauchst, und ich will dir dafür ein Nietzsche-Zitat besorgen.“7 Mitunter gewinnt man, über achtzig Jahre nach dieser Äußerung, den Eindruck, es gäbe so viele Nietzsches, dass manch ein Nietzscheforscher den Überblick zu verlieren droht und seinen Beitrag zum Thema am liebsten mit der Überschrift Mein Nietzsche versehen würde. Aber ein derartiger Titel, so denke ich, bezeugt nicht so sehr postmodernes Denken denn Lesefaulheit bezogen auf deutungsrelevante Sekundärliteratur. Und dass sowie warum man derlei nicht adeln sollte, zeigt der Umstand, dass einer jener qua eigener Vollmacht und Herrlichkeit zur Debatte gestellten Nietzsches besonderes Unheil zumal über die deutschen Nietzscheleser gebracht hat: Gemeint ist Elisabeth Förster-Nietzsches Nietzsche.
Wie es sich mit diesem verhält, habe ich in meinem bereits erwähnten 2011er Band ausführlich dargelegt8, der, mit Mazzino Montinari gesprochen, der Gattung „Präliminarien“, „Warnungen“, „Bereinigungen“ im Hinblick auf eine mögliche Nietzsche-Lektüre9 zugehört. Hier, in dieser, wenn man so will, Follow-up-Studie, soll ein weiter gehender Schritt riskiert werden, in Anknüpfung an das letzte Kapitel jenes Buches über den Übermenschen als Option für das 21. Jahrhundert: Es soll gefragt werden, was an Nietzsches Werk als überdauernd relevant im Sinne Nietzsches betrachtet werden kann (Teil A). Und es soll gefragt werden, was, gleichfalls auf dem Stand des heutigen Wissens, als eine von Nietzsche intendierte Wirkung betrachtet werden kann und was nicht (Teil B).
Für speziell diese Frage findet sich hinreichend Legitimation in Nietzsches Sorge vom Mai 1884 darüber, welche „Unberechtigte[n] und gänzlich Ungeeignet[n] sich einmal auf meine Autorität berufen werden.“ (6: 499) Und was die erste Frage nach Nietzsches Werk angeht, so muss es vorerst reichen, auf Nietzsches Brief an Carl Fuchs hinzuweisen, dem er am 14. Dezember 1887 von Nizza aus schrieb: „In Deutschland beschwert man sich stark über meine ‚Excentricitäten‘. Aber da man nicht weiß, wo mein Centrum ist, wird man schwerlich darüber die Wahrheit treffen, wo und wann ich bisher ‚excentrisch‘ gewesen bin. Zum Beispiel, daß ich Philologe war – damit war ich außerhalb meines Centrum […]. Insgleichen: heute scheint es mir eine Excentricität, daß ich Wagnerianer gewesen bin.“ (8: 209) Es ist ein Brief wie dieser, der an Karl Schlechtas und Mazzino Montinaris hier vorangestellte Zitate erinnert, deutlicher gesprochen: an eine Konsequenz, die zwei der führenden Nietzscheforscher des 20. Jahrhunderts andeuteten und die nun, über fünfzig bzw. gut dreißig Jahre später, endlich gezogen werden sollte. Die Frage, die dann noch verbleibt, ist schlicht und, genau besehen, rhetorisch: Warum soll man sich eigentlich noch um den anderen, den ‚excentrischen‘ resp. nicht-‚echten‘ Nietzsche, kümmern?
Dass diese Frage dringlich ist, zeigt der Umstand, dass der im Wesentlichen auf Karl Lagerfelds Sponsoring zurückgehende Göttinger L. S. D.-Verlag unter der Federführung Rüdiger Schmidt-Grépálys unter dem Titel Nietzsches Nietzsche eine limitierte Luxus-Edition der Werke Nietzsches ankündigt, eine Edition letzter Hand unter Verzicht auf den Nachlass und die ihm zuzuordnenden Schriften. Diese editorische Entscheidung ist an sich zu begrüßen, wird mit ihr doch endlich Nietzsches – von seiner Schwester unterschlagene – Forderung Genüge getan, nichts zu veröffentlichen, was er nicht selbst zur Publikation bestimmt habe.10 Stimmt aber der Titel eigentlich? Ist das, was Nietzsche unter dem Einfluss Wagners schrieb, also das auf immerhin fünf Bände dieser 19-bändigen Edition berechnete Frühwerk (bis 1876), wirklich dem zuzurechnen, was der Titel zum Ausdruck bringt? Oder müsste man über dieses Frühwerk nicht viel eher die Überschrift Wagners Nietzsche setzen? Wenn dem so ist, gilt es, das Frühwerk bei Editionsprojekten oder aber auch bei entsprechend ambitionierten Lesebüchern11 zu ignorieren, jedenfalls wenn diese dem Geist Nietzsches verpflichtet sind.
Der hier gewählte Titel bringt die Kritik an dem Editionsprojekt Schmidt-Grépálys im Sinne Schlechtas und Montinaris auf den Punkt und sichert zugleich den Anschluss an das ältere Buchprojekt Nietzsche verstehen – als eine Art Fortführung, ohne dass allerdings eine Kenntnis dieses Buches vorausgesetzt wird. Die Absicht der folgenden Seiten geht dahin, Nietzsche wieder in seinen Intentionen freizulegen, jenseits von Rhetorik, Pathos und Selbststilisierung. Dies erfordert die Montage eines gleichsam authentischen Nietzsche – Nietzsches Nietzsche –, aber auch die Demontage eines sich selbst missverstehenden Nietzsche inklusive derer, die ihn missverstanden. So betrachtet geht es um eine (Zwischen-)Bilanz in Sachen Werk und Wirkung Nietzsches, dies immer mit der Frage, was uns Nietzsche heute, im 21. Jahrhundert, noch zu sagen hat.