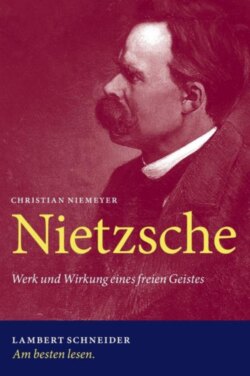Читать книгу Nietzsche - Christian Niemeyer - Страница 11
Die fröhliche Wissenschaft: Die neue Aussicht wird genossen, die Devise lautet: „Auf die Schiffe, ihr Philosophen!“
ОглавлениеNietzsches Aphorismensammlung Die fröhliche Wissenschaft (in diesem Kapitel: FW)58 vom August 1882 hatte einen eher unscheinbaren Start: Noch Mitte Dezember 1881 beabsichtigte Nietzsche nichts weiter als einen Anhang – „6. bis 10. Buch“ (6: 150) – zu Morgenröthe. Sechs Wochen später allerdings, nach Abschluss des achten Buches (dieser Rechnungsart) bzw. des Dritten Buches jener Aphorismensammlung, die er seinem Verleger im Mai 1882 erstmals unter dem Titel FW ankündigte (6: 191), wurde ihm klar, dass es damit nicht getan sei. Denn Nietzsche arbeitete seit einiger Zeit an einem Vierten Buch, welches die Akzente deutlich verschob. Dies gilt beispielsweise für den letzten Aphorismus (Nr. 342), der mit fast exakt den Worten beginnt, mit denen Nietzsche nur ein Jahr später auch Also sprach Zarathustra eröffnen wird. Dies gilt aber auch für den vorletzten Aphorismus (Nr. 341) mit dem Wiederkunftsgedanken, den Zarathustra später – zusammen mit dem Übermenschenkonstrukt – ins Zentrum seiner Lehre erheben wird. Insoweit kommt dem Vierten Buch von FW eine gewisse Sonderstellung zu.
Dass Nietzsche zunächst nur einen Anhang zu Morgenröthe plante, lässt sich auch dem Umstand entnehmen, dass der in diesem Werk begründete Imperativ „Rückkehr zur Wissenschaft!“ (III: 263) im Dritten Buch von FW unter der Überschrift Die vier Irrthümer (s. III: 474) weitergeführt wird. Nietzsche listet hier auf, was es heißt und erfordert, den Menschen durch die Wissenschaft vollständig zu beschreiben, basierend auf der Kenntnis realer Eigenschaften und mit dem Interesse, ihn in seiner wertsetzenden Kompetenz gegen ihn normierende Morallehren zur Geltung zu bringen. Aber auch im Vierten Buch ist jener Imperativ noch folgenreich, etwa wenn wir hier lesen: „Eine Art von Redlichkeit ist allen Religionsstiftern und Ihresgleichen fremd gewesen: – sie haben nie sich aus ihren Erlebnissen eine Gewissenssache der Erkenntniss gemacht […]. Aber wir, wir Anderen, Vernunft-Durstigen, wollen unseren Erlebnissen so streng in’s Auge sehen, wie einem wissenschaftlichen Versuche, Stunde für Stunde, Tag um Tag! Wir selber wollen unsere Experimente und Versuchs-Thiere sein.“ (III: 550f.) Deutlich wird hier: Den Menschen durch die Wissenschaft vollständig zu beschreiben, erfordert Redlichkeit, die tatsächlich aber eher für die Ausnahme denn für die Regel steht.
Interessant sind dabei die Details: Hinter der Vokabel ‚Redlichkeit‘ steht ein Verfahrensvorschlag in Sachen konsequenter Selbstbeobachtung, der letztlich auf das Projekt einer Hermeneutik des Erlebens hinausläuft. In eben diese Richtung weist auch die – biographisch aufschlussreiche – Bemerkung: „Dass du aber diess und jenes Urtheil als Sprache des Gewissens hörst, also, dass du Etwas als recht empfindest, kann seine Ursache darin haben, dass du nie über dich nachgedacht hast und blindlings annahmst, was dir als recht von Kindheit an bezeichnet worden ist.“ (III: 561) Alles Weitere ist damit präjudiziert: der (1) Bannspruch gegen Kant, der „noch nicht fünf Schritt weit in der Selbsterkenntniss gegangen [ist]“ (III: 562); die (2) – gleichfalls gegen Kant geltend gemachte – Einsicht, „dass alle Vorschriften des Handelns sich nur auf die gröbliche Aussenseite beziehen“ (III: 563); und (3) die Folgerung: „Beschränken wir uns also auf die Reinigung unserer Meinungen und Werthschätzungen und auf die Schöpfung neuer eigener Gütertafeln.“ (III: 563)
Nietzsches Ausgangspunkt war dabei die Empörung über das ihm von Haus aus nur allzu geläufige „Geschwätz der Einen über die Anderen“, dem er als seinen Slogan das Lob auf „die Neuen, die Einmaligen, die Unvergleichbaren, die Sich-selber-Gesetzgebenden, die Sich-selber-Schaffenden“ entgegenhielt, verbunden mit der Forderung: „Und dazu müssen wir die besten Lerner und Entdecker alles Gesetzlichen und Nothwendigen in der Welt werden: wir müssen Physiker sein, um in jenem Sinne Schöpfer sein zu können.“ (III: 563) Wohlgemerkt: Das Wort ‚Physik‘ ist hier als Gegenbegriff zum Wort ‚Metaphysik‘ gemeint – und zielt insoweit auf die Notwendigkeit, zum Wissen zu kommen in Fragen des Könnens, auch in Bezug auf Selbsterkenntnis und Selbstgestaltung59, und dies anstatt einer ‚metaphysischen‘ Rede über das Sollen. Nicht gemeint ist hingegen das, was man als Schulfach kennt – und was man sich dahingehend ausdeuten könnte, Nietzsche wolle als ‚Lerner und Entdecker alles Gesetzlichen und Notwendigen in der Welt‘ im naturwissenschaftlichen Sinne reüssieren. Gegen diese Engführung spricht die Pointe, „dass all unsere Bewusstheit sich auf Irrthümer bezieht.“ (III: 383) Hiermit wird, ganz nebenbei, die bereits angeführte Überlegung aus Morgenröthe weitergeführt, wonach „all unser sogenanntes Bewusstsein ein mehr oder weniger phantastischer Commentar über einen ungewussten, vielleicht unwissbaren, aber gefühlten Text ist.“ (III: 113) So gesehen überrascht es auch nicht, dass Nietzsche seinen Kampf für das Neue (s. III: 21ff.) wieder aufnimmt und beispielsweise statuiert: „Das Neue ist […] unter allen Umständen das Böse, als Das, was erobern, die alten Grenzsteine und die alten Pietäten umwerfen will.“ (III: 376)
Zu den ‚alten Pietäten‘ gehören fraglos auch Wagner und dessen Sache. Mit beiden, nicht zu vergessen: mit der eigenen frühen Teilhabe an beidem, rechnet Nietzsche im Nachgang zum Beschluss aus dem Nachlass vom Sommer 1880 ab: „Ich will der fanatischen Selbstüberhebung der Kunst Einhalt thun, sie soll sich nicht als Heilmittel gebärden, sie ist ein Labsal für Augenblicke.“ (IX: 156f.) Folgen zeigte diese Notiz in Der Wanderer und sein Schatten: „Zuletzt sind und bleiben wir der Musik gut, wie wir dem Mondlicht gut bleiben. Beide wollen ja nicht die Sonne verdrängen, – sie wollen nur, so gut sie es können, unsre Nächte erhellen.“ (II: 623) Vorbereitet ist damit die nicht minder elegante, nichtsdestotrotz ultimative Abrechnung aus FW: „Als ästhetisches Phänomen ist uns das Dasein immer noch erträglich.“ (III: 464) Die Wortwahl ist durchdacht, die Sperrung ebenfalls60: In ihr gelangt zum Ausdruck, dass die Kunst in Sachen der Rechtfertigung des Daseins ausgespielt hat, ebenso wie das Zentralpostulat aus der Geburt der Tragödie: „[N]ur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt.“ (I: 47) Was Nietzsche nun allein noch gelten lässt, ist Kunstindienstnahme für die Kultivierung der Lebensführung, etwa nach dem Muster: „Seinem Charakter ‚Stil geben‘ – eine grosse und seltene Kunst!“ (III: 530)
Auch hier erfolgt die Wortwahl nicht unbedacht: Zu denken ist an die – zumal im Dritten Reich beliebte61 – Forderung nach „Einheit des künstlerischen Stiles in allen Lebensäusserungen eines Volkes“ (I: 163) aus David Strauss der Bekenner und der Schriftsteller (1873), die nun, was Nietzsche angeht, ohne jede Relevanz ist. An ihre Stelle tritt extreme Liberalität bezüglich dessen, was das Individuum je für sich selbst als stilprägend empfinden mag – eine Option, der zumal postmoderne Denker wie Alexander Nehamas62 einiges abgewinnen können. Unerbittlich ist Nietzsche nur in einer Frage: dass, als Folge einer unentwickelten ‚Lebenskunst‘, keine Unzufriedenheit, will sagen: kein Nährboden für Ressentiments, verbleiben darf. So betrachtet ist das Alte abgetan.
Dem Neuen nähert sich Nietzsche, wenn er beispielsweise die „Welt des Irrsinnigen“ zu rehabilitieren sucht: Sie, so Nietzsche, unterscheide sich von der Welt der „Freunde ‚des gesunden Menschenverstandes‘“ allenfalls sukzessive; nicht zwischen Wahrheit und Irrsinn sei folglich zu trennen, sondern zwischen differenten Graden in der „Allgemeinheit und Allverbindlichkeit eines Glaubens“ (III: 431), im Fall der Nicht-Irrsinnigen also: des Glaubens an die Wahrheit. Ziel auch dieser Intervention ist – diesmal durch Irritation der „Gläubigen des grossen Gesammtglaubens“ an Wahrheit, an Gewissheit, an Vernunft etc. –, Platz zu schaffen für „die Ausnahme und die Gefahr“ (III: 432) und mithin für das Neue und dessen Entdeckung bzw. Entdeckbarkeit.
Wir sehen also: Nietzsche bewegt sich hier, im Zweiten Buch, im Vorfeld jenes Gedankens, den er dann im Vierten Buch, wieder aufnehmen wird unter Losungen wie „gefährlich leben!“ und dem gleich nachfolgenden: „Schickt eure Schiffe in unerforschte Meere!“ (III: 526) Diese Kolumbusmentalität wird mit dem Ausruf beendet: „Es giebt noch eine andere Welt zu entdecken – und mehr als eine! Auf die Schiffe, ihr Philosophen!“ (III: 530) Welche ‚andere Welt‘ Nietzsche erwartet, stellt der Ausruf klar: „Auch der Böse, auch der Unglückliche, auch der Ausnahme-Mensch soll seine Philosophie, sein gutes Recht, seinen Sonnenschein haben!“ (III: 529) Die Anrufung der Sonnenmetapher in diesem Zusammenhang ist ein Indiz dafür, dass Nietzsche hier in sinngebender Absicht tätig ist. Die ‚andere Welt‘, auf die Nietzsche im Vierten Buch abzielt, ist also identisch mit einem neuen philosophischen Grundgedankengang, der tauglich ist zu einer alternativen, aus herkömmlichen Philosophien nicht beziehbaren Daseinsrechtfertigung insbesondere für den ‚Bösen‘, den ‚Unglücklichen‘, den ‚Ausnahme-Menschen‘, man könnte vielleicht auch sagen: Nietzsche will eine ‚philosophische‘ Rechtfertigung resp. eine begründende Theorie der Lebens- und Denkart des ‚Bösen‘ resp. dessen, der für das Neue steht.
Aber man kann noch einen Schritt weitergehen. Denn in jenem Aph. 283 deutet sich ein Bildungsprogramm an, einerseits in Gestalt einer Abwertung von „Civilisation und Grosstadt-Bildung“, andererseits in Form der Aufwertung der Bildungsbedingung Natur – wenn man Nietzsches Slogan „Baut eure Städte an den Vesuv!“ (III: 526) in dieser Weise übersetzen darf. Entsprechend auch geht es um zwei divergente ‚Menschentypen‘: den (1.) ‚alten‘, domestizierten, durch Zivilisation um seine ‚erste Natur‘ gebrachten Menschen der ‚Jetztzeit‘; sowie (2.) den ‚neuen‘ Menschen, der durch die Bildungsbedingung Natur gefährdet war und darüber wieder tapfer geworden ist. Dies könnte die Resonanz erklären, auf die Nietzsche wenig später in großstadtmüder und zivilisationskritischer Zeit traf – auch und gerade in der Pädagogik, speziell: im Umfeld von Landerziehungsheim- sowie Jugendbewegung.63 Die Frage allerdings bleibt, ob derlei praktizistische Rezeption nicht vergessen macht, was doch Nietzsches primäres Anliegen gewesen war: nämlich dass es nicht um Tapferkeit i. S. irgendwelcher auf das Nachtwandern bezüglicher Wandervogeltugenden geht, sondern um Tapferkeit als Erkenntnisprämisse, um so beizutragen zu einem neuen Zeitalter, das „den Heroismus in die Erkenntniss trägt“ (III: 526).64
Für eine gesonderte Thematik steht der eingangs beiläufig angesprochene Wiederkunftsgedanke aus Aph. 341 (s. III: 570). Verglichen mit der in Ecce homo in dieser Angelegenheit vorgetragenen Argumentation (s.S. 101ff.) hält sich der Inszenierungsaufwand in FW noch in überschaubaren Grenzen: Nietzsche fragt einen fiktiven Leser, nachdem er ihn gebeten hat, sich vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn er sein Leben, wie er es jetzt lebe und wie er es bisher gelebt habe, „noch einmal und noch unzählige Male“ in genau derselben Weise wiederholen müsse, ob dies nicht auch eine Chance sei, denn: „Oder wie müsstest du dir selber und dem Leben gut werden, um nach Nichts mehr zu verlangen, als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung?“ (III: 570) Mit dieser Frage endet dieser Aphorismus. Der Sinn scheint klar: Es ging Nietzsche keineswegs darum, dass alles wiederkehre oder wiederkehren möge. Nietzsches Frage war vielmehr kritischer Natur – kritisch auch jenen gegenüber, deren Lebensführung Zeugnis dafür gab, dass diese sich besser nichtjeden Tag in genau dieser Weise wiederholen möge. So betrachtet kann der Wiederkunftsgedanke auch gefasst werden als ethische Formel zur Beglaubigung eines vollkommenen Lebens (und Handelns). Dabei erwartete Nietzsche diese Beglaubigung, anders als Kant, nicht von Anderen oder, präziser und mithin in Anlehnung an Kants Rede vom kategorischen Imperativ gesprochen: mit Blick auf die Maximen derer, auf die sich die Anderen im Sinne einer höheren Gesetzgebungsverfahrens geeinigt haben oder auf die hin sie sich jedenfalls doch aller Vernunft nach zu einigen hätten. Sondern Nietzsche erwartete diese Beglaubigung vom Handlungsträger selbst und als Effekt einer kritischen Selbstreflexion.65
Nietzsche selbst gab übrigens für derlei ein Zeugnis. So schrieb er seinem Freund Paul Rée Ende August 1882 und mithin im Hochgefühl wiedergewonnener Gesundheit sowie einer noch vergleichsweise ungetrübten Liebe für Lou von Salomé über sein soeben erschienenes Buch FW, „das Persönlichste aller meiner Bücher“: „Lesen Sie doch den Sanctus Januaris einmal im Zusammenhang! Da steht meine Privat-Moral beisammen, als die Summe meiner Existenz-Bedingungen, welche nur ein Soll vorschreiben, falls ich mich selber will.“ (6: 247) Wenn man sich an diesen Lesetipp hält, entdeckt man tatsächlich Nietzsches ‚Privatmoral‘, und zwar gleich im ersten Aphorismus, dessen entscheidender Satz lautet: „Ich will immer mehr lernen, das Nothwendige an den Dingen als das Schöne sehen […]. Amor fati: das sei von nun an meine Liebe! Ich will keinen Krieg gegen das Hässliche führen.“ (III: 521) Nietzsche ist später von vielen seiner Interpreten für dieses Hohe Lied auf die Schicksalsliebe (= Amor fati) gescholten worden – so, als rede er nun nichts anderem mehr das Wort als einer aus seiner eigenen Befindlichkeit heraus erklärbaren Lebensweisheitsdoktrin, welche auf Gestaltung von Welt und auf Kritik verzichtet. Gegen diese Lesart spricht aber die im Herbst 1886 verfasste Vorrede zur Neuausgabe, vor allem der Passus: „Jede Philosophie, welche den Frieden höher stellt als den Krieg […], erlaubt zu fragen, ob nicht die Krankheit das gewesen ist, was den Philosophen inspirirt hat.“ (III: 348) Denn dieser Satz klingt fast so, als mache sich Nietzsche über sein eigenes, aus seiner Krankheit resultierendes Plädoyer für eben jene Amor fati lustig, ebenso wie über die damit im Zusammenhang stehende Freude über die ewige Wiederkunft des Gleichen.
Ein allerletztes Wort erfordert noch der in der Nietzscheforschung von jeher vielbeachtete66 Aph. 125 (s. III: 480ff.). Nietzsche offeriert hier eine Art Generalprobe zum Eingangsszenario seiner wenig später nachfolgenden Dichtung Also sprach Zarathustra. Dabei wollen wir uns hier darauf beschränken, die Besonderheit des Szenarios von FW zu bestimmen. Im Zentrum stehen atheistische Marktbesucher. Sie halten dem gottsuchenden ‚tollen Menschen‘ in ebenso ironischer wie blasphemischer Attitüde entgegen, Gott halte sich wohl nur „versteckt“ bzw. er habe sich bloß „verlaufen wie ein Kind“ (III: 480). Daraufhin konfrontiert er sie nachdrücklich mit dem Hinweis, Gott sei tot. Deswegen auch mache sich der nur lächerlich, der, dies auch noch mit der Laterne am helllichten Tag – Nietzsches verschlüsselter Spott auf die Aufklärung –, nach ihm sucht. Es sei vielmehr zu reden – und hiermit beginnt nicht etwa, wie Gianni Vattimo67 meinte, die Postmoderne, sondern Nietzsches neue Aufklärung – von den Folgen der Tat, und dies ausgehend von dem Beharren auf neuer Sinngebung auch in einer Ordnung der Dinge ohne Gott. Dem folgt sogleich der Zweifel nach, ob der Mensch hierfür noch der richtige Ansprechpartner sei: „Ist nicht die Grösse dieser That zu gross für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen?“ (III: 481)
Dieser Gedanke, also die Idee einer nach dem Tod Gottes unabweisbar an den Menschen herantretenden Nötigung, gottähnlich zu agieren und sich der Verantwortlichkeit für sein Tun zu vergewissern, der Gedanke mithin auch, „selber, wie Gott, gegen alle Dinge gerecht, sonnenhaft [zu] sein und sie immer neu [zu] schaffen“ (IX: 591), ist einer, der Nietzsche nicht mehr losgelassen hat. Dies gilt auch, weil mit ihm der Übermensch ante portas steht. Zumindest als Vokabel ist er erstmals in Aph. 143 von FW (s. III: 490f.) zu besichtigen, dies schon verziert mit all den Attributen, die dieses Konzept in Zukunft für Nietzsche interessant machen werden: also dahingehend, dass es Wege zu erkunden gelte, wie „der Einzelne sich sein eigenes Ideal aufstelle und aus ihm sein Gesetz, seine Freuden und seine Rechte ableite“, kurz: wie dasjenige, was bisher „als die Abgötterei an sich galt“ (III: 490), in die Wirklichkeit übertreten könne. Dass dieses Konzept mithin entgegen Corinna Schuberts Vermutung rein gar nichts mit einem „starren, von anderen vorgesetzten und für alle gleichen Ideal“68 zu tun hat, stand für Nietzsche von Beginn an außer Frage.
Zusammenfassend gesprochen: FW ist ein bedeutendes Buch – aber nicht so sehr oder jedenfalls doch nicht allein, weil es den Wiederkunftsgedanken und die Diagnose vom Tod Gottes vorwegnimmt und insoweit als ‚Vorhalle‘ des Zarathustra zu gelten hat. Wichtiger scheint, dass Nietzsche in FW das Projekt einer anti-metaphysischen Humanwissenschaft vorangetrieben und ein Bildungsprogramm skizziert hat für ‚vorbereitende Menschen‘ resp. Übermenschen. Derer bedarf es dringend angesichts der Herausforderungen an eine selbstbestimmte Lebensführung in einer Ordnung der Dinge ohne Gott. Nicht zu vergessen: Sehr viel deutlicher als in der Morgenröthe gibt Nietzsche in FW einen Begriff jener ‚neuen Philosophen‘, die er von einem ‚kriegerischen‘ Zeitalter erwartet, ‚das den Heroismus in die Erkenntniss trägt‘ und die eine ‚andere Welt‘ des Wissens und des Lebens zu entdecken und zu begründen haben.