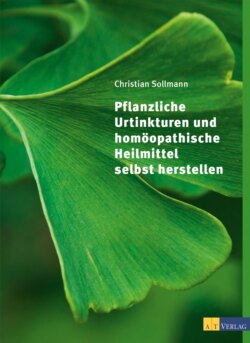Читать книгу Pflanzliche Urtinkturen und homöopathische Heilmittel selbst herstellen - Christian Sollmann - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Soll eine Veränderung möglichst in die Tiefe gehen, so gebe man das Mittel in den kleinsten Dosen, aber unablässig auf weite Zeitstrecken hin!« 50
Das Herstellen von Urtinkturen für homöopathische Mittel
Hahnemann beschreibt folgende Vorgehensweise bei der Erstellung seiner Urtinkturen: »Obwohl gleiche Theile Weingeist und frisch ausgepreßter Saft gewöhnlich das angemessenste Verhältnis bilden, um die Absetzung des Faser- und Eiweiß-Stoffes zu bewirken, so hat man doch für Pflanzen, welche viel zähen Schleim (zum Beispiel Beinwellwurzel, Freisam-Veilchen usw.) oder ein Übermaß an Eiweißstoff enthalten (zum Beispiel Hundsdill-Gleiß, Schwarz-Nachtschatten usw.), gemeiniglich ein doppeltes Verhältniß an Weingeist zu dieser Absicht nöthig. Die sehr saftlosen, wie Oleander, Buchs und Eibenbaum, Porst, Sadebaum usw., müssen zuerst für sich zu einer feuchten, feinen Masse gestoßen, dann aber mit einer doppelten Menge Weingeist zusammengeführt werden, damit sich mit letzterm der Saft vereinige, und so ausgezogen, durchpreßt werden könne; man kann letztere aber auch getrocknet, (wenn man gehörige Kraft beim Reiben in der Reibeschale verwendet) zur millionenfachen Pulver-Verreibung mit Milchzucker bringen, und dann nach Auflösung eines Grans davon, die fernern flüssigen Dynamisationen verfertigen (s. § 271).«51
Im Folgenden wird nun die einfachste Form der Herstellung homöopathischer Urtinkturen beschrieben. Wie gesagt – Quellwasser ist sicher der natürlichste Träger für die Bildekräfte der Pflanzen. Im Alltagsleben ist es aber nahezu unmöglich, unentwegt zu einer stillen, radiästhetisch rechtsdrehenden Quelle zu wandern. Außerdem werden inzwischen immer mehr der regionalen Quellen durch Vertreter diverser esoterischer Gruppierungen »besetzt« und von irgendwelchen Personen »besungen«. Auch Chemikalien oder Bakterien haben schon viele Quellen zum Umkippen gebracht. Nur die Firma Wala hat es bisher zustande gebracht, Wasser so zu rhythmisieren, dass es sogar über viele Jahre hinweg nicht umkippt und verjaucht. Somit ist das zweckmäßigste Medium für die eigene Mittelherstellung im privaten Rahmen der Ethanolalkohol.
»Ethanol wird inzwischen hauptsächlich durch Gärung aus Biomasse gewonnen, man kann es aber auch durch rein chemische Synthese aus Wasser und Ethen unter Zugabe von Schwefelsäure als Katalysator herstellen, auf welche Weise es lange Zeit im 20. Jahrhundert aus Erdöl hergestellt wurde.«52 Wenn man es also genau nimmt, ist das handelsübliche Ethanol aus der Apotheke mit den Informationen einer unbekannten Biomasse besetzt. Und was da verwendet wird, kann informationsmäßig – chemisch, elektromagnetisch oder gentechnisch – hochgradig verseucht sein. Hierzu schreibt Peter Hochmeier: »Kein ernsthaft arbeitender Spagyriker wird zur Herstellung von ›Heilmitteln‹ auf zweifelhafte Flüssigkeiten zurückgreifen, die bloß durch ein Etikett als ›Weingeist‹ ausgezeichnet werden, in Wahrheit aber nie mit echtem Wein in Berührung gekommen sind.«53
Radiästhetische Prüfung des Quellwassers.
Industrie-Ethanol, ein hochprozentiger Wein aus dem Bio-Markt oder nur destilliertes Wasser – keine dieser Flüssigkeiten ist wirklich informationsfrei. Es gibt keinen absolut neutralen Informationsträger. Also ist es auch nicht schädlicher, wenn man zur Streckung bzw. zur ersten Konservierung Grappa oder einen regionalen Kartoffelschnaps verwendet. Biologisch hergestellte Ware sollte natürlich schon bevorzugt werden. Hildegard von Bingen (1098–1179) und Paracelsus verwendeten Branntwein, der aus Wein hergestellt wird, und auch heute verwendet Soluna für ihre Präparate nur den Weingeist, der aus Burgunderwein hochdestilliert wurde.
Die gesamte Verarbeitung sollte so einfach und natürlich wie möglich, also in Handarbeit ohne elektrische Geräte (Erhitzen, Zerkleinern, Pressen und so weiter), Kontakt mit Metall und Ähnlichem geschehen. Durch eine möglichst schonende Verarbeitung der Pflanze wird ihre Eiweißstruktur nicht denaturiert, und sie bleibt in ihrer wirksamen Gestalt erhalten. Das Wesen und die Eigenart der Pflanze, ihr Astrum – also ihr astrologisches Prinzip –, kann hierdurch im noch lebendigen Zustand in ein neutrales Medium überführt werden. Man scheidet den Geist der Pflanze von seiner Hülle.
Um Urtinkturen herzustellen, gibt es wie gesagt viele Vorgehensweisen. Man kann spagyrisch oder anthroposophisch, schamanisch oder magisch, nach Hahnemann oder Paracelsus vorgehen oder auch ganz einfach mit einem Kräuterbuch anfangen und auf eigene Art Tinkturen zubereiten. Wichtig ist, das heilende Prinzip der Pflanze nicht zu zerstören und stimmig zu potenzieren. Man kann sich ja bei der Erstellung der Mittel für den privaten Bereich einen eigenen Stil erarbeiten, der sollte auch beibehalten werden, braucht dabei aber weitere Entwicklungen und Erfahrungen nicht auszuschließen.
Sind also die Pflanzen sauber und alle Insekten entfernt, auch die welken und kranken Teile, dann geht es ans Zerkleinern. Auch hier ist wie immer darauf zu achten, dass die Pflanzen so selten wie möglich mit Metall in Kontakt kommen. Nun ist das in diesem Fall sehr schwierig. Eine andere Möglichkeit, als mit dem Wiegemesser oder einem Fleischwolf Pflanzen zu zerkleinern, scheint es nicht zu geben.
Wie aber kommt man zum Beispiel an den Saft von Belladonna? Sicherlich gibt es Keramikmesser, -reiben oder mechanische Steinmühlen, aber ob der Aufwand – finanziell oder hygienisch – hierfür durch das Ergebnis gerechtfertigt wird, ist eine individuelle Entscheidung. Und wer eine Steinmühle nach jedem Gebrauch komplett zerlegen und alle mit dem Saft oder den Pflanzenteilen in Berührung gekommenen Teile abkochen muss, weiß, wie aufwendig so etwas ist.
Zum Zerkleinern und Aufschließen des Pflanzenguts genügt bereits ein einfacher Tonmörser mit Holzpistill.
Als vorzügliche Alternative für die Aufschließung der Pflanzen eignet sich ein Tonmörser mit Holzpistill. Die Zellstrukturen werden aufgebrochen und nicht durch Metall zerstört. Der körperliche Aufwand ist zwar höher, aber je mehr natürliche Kraft für die Öffnung der Pflanzen aufgewendet wird, desto umfangreicher wird ihre eigentümliche Kraft frei.
Schon hier beginnt die unterscheidende feine Heilmittelherstellung. Man kann also die Pflanzen in einem Tonmörser aufschließen, tierische oder menschliche Produkte in einem Porzellanmörser, Kalke oder überhaupt alle Mineralien und Edelsteine in einem Granitmörser, und wenn man noch die Signatur der Planetenbeziehung subtil hervorholen möchte, dann verreibt man Brennnessel, Kardamom oder Senf – als Beispiel für das Prinzip Mars – in einem Eisenmörser. Nebenbei bitte ich trotzdem immer sorgfältig abzuwägen, ob es unbedingt notwendig ist, ein Tier zu töten. Man muss grundsätzlich die Tierschutzgesetze beachten und sollte zuvor immer abwägen, ob ein pflanzliches oder mineralisches Präparat nicht eine vergleichbare Hilfestellung leisten kann.
Die Wirkung eines Mittels richtet sich hauptsächlich danach, dass man fachmännisch so weit wie möglich korrekt und sauber arbeitet, gedanklich sollte man dabei aber nicht dogmatisch und verbissen sein. Sicherlich ist es wichtig, dass keine Insekten und dergleichen mitverarbeitet werden, dass die Hände und der Arbeitsplatz sauber sind, keine offenen ätherischen Öle bzw. chemischen Putzmittel mit im Raum stehen, und die verschiedenen Füllmengen und Verhältnisse müssen stimmen. Schlampigkeit ist nicht erlaubt, die gewählte Herstellungsmethode sollte man so gut wie möglich einhalten – das Ganze soll aber kein Erbsenzählwerk werden. Ein technisches Korsett für die Verarbeitung und Mittelgabe, das somit nur die Form regelt, aber dem Inhalt, dem Gestalthaften, nicht gerecht wird, erstickt das Lebendige – in den Tinkturen sowie in der Therapie.
Man darf sich immer fragen, wie viel Menschlichkeit und Güte in einem Heilmittel stecken: Will man ein Medikament strikt im Geiste des Europäischen Arzneibuchs herstellen oder Heilkunst betreiben? Das Quantum satis – »So viel als nötig« – gilt nicht nur für die Mengenangabe des zu verwendenden Stoffes, sondern ist auch bei der Geisteshaltung des Herstellers zu suchen, der den rechten Umgang mit den Dingen der Natur pflegt – der dies überhaupt als künstlerisch-initiatorisches Kriterium für ein Heilmittel voraussetzt. Nur die Mächtigkeit einer heilen Gestalt kann erkranktes Leben heilen – durch ihre zeugende Fähigkeit Leben orientieren. Die jeweiligen Gestalten der Pflanzen wesen in den Tinkturen weiter, und sie wesen in dem Maße und so kräftig weiter, wie man sie nicht durch wesenheitsabtötende Bearbeitungsrichtlinien vertreibt.
»Die Bereitung der Arznei soll also in der Weise erfolgen, dass die vier Corpora [siehe Glossar] von den Arcana genommen werden, und dann soll man wissen, welches Astrum in diesem Arcanum, welches das Astrum der betreffenden Krankheit ist und welches Astrum es in der Arznei wider die Krankheit gibt.«54
Eine Essentia wird frei durch Läutern, aber nicht durch brutales Sterilisieren der Ausgangssubstanz mittels Erhitzen auf 121°C oder durch das selektive Herausbrechen von Einzelstoffen aus seinem Wirkstoffgefüge mit 90-prozentigem Ethanol. Je mehr man daran herumdoktert und raffiniertere technische Verfahren anwendet, die Pflanzenmoleküle gezielt auszusondern, um spezielle chemische Gruppen zu isolieren, desto amorpher wird dann die Urtinktur. Ihr fehlt die Quinta Essentia. Das Wichtigste in der Tinktur ist nicht die erreichte Höhe der gewünschten chemisch nachweisbaren Bestandteile, sondern dass das heilende religiöse Pflanzenprinzip in seiner Ganzheit so unverletzt wie möglich in die Erscheinungsform der Trägersubstanz Wasser, Zucker oder Alkohol, übergeht. Die Heilkraft in solcherart selbsthergestellten Tinkturen ist allen Industrieprodukten überlegen.
Das Ansetzen der Urtinkturen sollte bei frischen Pflanzen zügig geschehen, am besten noch während derselben Tageshälfte des Pflückens. Manche Pflanzen welken sehr schnell, somit verweht auch rasch der Pflanzengeist. Ziel ist es aber, das Prinzip der Pflanze, ihre Gestalt, in lebendiger Verfassung in ein Medium zu überführen. Entweder man mörsert sie sofort, oder man zerschneidet sie auf einem Teller, Holzbrett (Holzbretter sind unbedenklich, siehe hierzu auch die Erläuterung auf Seite 237), Keramikteller oder einer Glasplatte so klein wie möglich. Danach werden die kleinen Pflanzenstücke im Mörser nochmals bearbeitet und zu Brei gequetscht. Hierdurch wird die Zellmembran geöffnet, die Pflanze wird sozusagen aufgeschlossen, und der Übertritt des Pflanzenprinzips hinein in die Lösung durch Vergrößerung der Pflanzenoberfläche, der Grenzstrecke zwischen Pflanze und Medium, wird erleichtert.
Nun füllt man den Pflanzenbrei locker in ein sauberes Konservierungsglas. Die zerkleinerten Pflanzenteile werden mit einem Glasstab noch etwas nachgestopft, um eventuelle Luftbläschen aufzutreiben. Hier ist es dann sinnvoll, mit durchsichtigen Gläsern zu arbeiten. Während der Auszugszeit können die Tinkturen beobachtet und der Farbton betrachtet werden. Ich empfehle die handelsüblichen Einweckgläser. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und gut zu reinigen. Selbstverständlich können auch ausrangierte Marmeladenoder Gurkengläser benutzt werden. In diesem Fall ist es empfehlenswert, zwischen Deckel und Füllgut eine kleine zurechtgeschnittene Plastikfolie zu legen. Die einmal gebrauchten Deckel dieser Gläser werden nämlich nie wieder richtig sauber.
Nach der Abfiltrierung wird die fertige Urtinktur in Braungläsern an einem dunklen, kühlen Ort verwahrt. Frische Pflanzenteile füllen das Glas fast vollständig, getrocknete nur etwa zu drei Vierteln. (Achtung bei getrockneten Pflanzenteilen: Viele Wirkstoffe zerfallen beim Trocknungsvorgang oder erhalten sich nur bei schonendster Trocknung, zum Beispiel die ätherischen Öle im Rosmarin, die Bitterstoffe des Wegerichs oder das Saponin in der Vogelmiere. Solche Pflanzen werden auf keinen Fall getrocknet, sondern gleich als Urtinktur angesetzt.)
Der Rest des Glases wird mit Ethanol unbedingt bis zum Glasrand aufgefüllt. Wenn man sich vorgenommen hat, Urtinkturen nur für homöopathische Mittel zu erstellen, dann reichen kleine Mengen. Wer Tinkturen, Salben und so weiter herstellen möchte, wird selbstverständlich größere Mengen ansetzen. 50- bis 100-ml-Gäser genügen als Grundlage für die Homöopathie vollauf. Nach dem Abfiltern ergibt das dann zwischen 30 und 80 ml Urtinktur. Diese ist ausreichend für die nächsten fünfzig Jahre. Die Gläser werden mit dem Pflanzennamen, den verwendeten Pflanzenteilen, dem Fundort, dem Datum und dem Ethanolgehalt beschriftet. Auch sollte eine eventuelle Giftigkeit vermerkt sein und ob die Ernte vor, während oder nach der Blüte erfolgte. Die Gläser bleiben nun mindestens 4 bis 6 Wochen – einen philosophischen Monat also, lieber länger – in einem trockenen, dunklen und nicht zu kühlen Raum stehen. Zwischendurch wird immer wieder einmal das Glas geschüttelt und umgedreht hingestellt.
Die Vorgehensweise ist vor allem für die Pflanzenauswahl in diesem Buch geeignet. Daneben gibt es andere Pflanzen oder Substanzen, die ausgeglüht (Rotbuche), destilliert (Buchenholz) oder wie die Austernschale gleich mit Milchzucker verrieben werden (siehe Seite 231).
Eine eindeutige Beschriftung der Gläser schützt vor Verwechslungen.
Max Amann hat über die Höhe des zu verwendenden Ethanolgehalts anhand seiner vierzigjährigen Erfahrung mit der Tinkturenherstellung eine Tabelle über die »Löslichkeit von Wirkstoffen in Ethanol« zusammengestellt, die er in seinen Seminaren vermittelt.55 Darin wird anschaulich, welche Wirkstoffe hauptsächlich wasserlöslich sind und welche eher durch Ethanol herausgelöst werden. (Eine detaillierte Übersicht der biochemischen Wirkstoffe der Pflanzen befindet sich auf Seite 263ff.)
Löslichkeit von Wirkstoffen in Ethanol
Bei der Extraktion ist es wichtig, dass sowohl wasser- als auch alkohollösliche Stoffe ausgezogen werden. Ein hoher Ethanolgehalt lässt aber hauptsächlich nur die ätherischen Öle und ein niedriger Ethanolgehalt vor allem die wasserlöslichen Verbindungen wie Schleime oder Saponine in Lösung gehen. Hier scheint ein Kompromiss manchmal schwierig zu sein.
Es können also von einer Pflanze parallel mehrere Tinkturen mit unterschiedlichem Ethanolgehalt angesetzt werden. Somit befinden sich in der einen Tinktur eher die ätherischen Öle und in der anderen überwiegend die Saponine aus der gleichen Pflanze. Beide Fraktionen schüttet man zusammen und verarbeitet sie gemeinsam weiter (Formel siehe Seite 227). Beim teuren Ginseng empfiehlt es sich, im Anschluss an die erste Mazeration noch einen zweiten oder sogar dritten Auszug zur gründlicheren Erschöpfung des Ausgangsmaterials vorzunehmen.
Auch ist es manchmal überlegenswert, von einer Pflanze die Wurzel im Frühjahr und von einer anderen Pflanze der gleichen Art die Wurzel im Herbst zu sammeln. Die Wurzel vom Löwenzahn zum Beispiel (Ähnliches gilt auch für den Beinwell) enthält im Frühjahr mehr Taraxerin (das hat eher einen Bezug zur Leber), und im Herbst ist der Inulingehalt höher (Inulin pflegt die Milz). Nach der Auszugszeit werden auch hier beide Wurzelextrakte zu einer Tinktur vereinigt.
Alkohol
Welcher Alkohol wird verwendet? Für allgemeine Pflanzentinkturen kann man sich an das Deutsche oder das Europäische Arzneibuch halten und mischt in den meisten Fällen pauschal 5 oder 10 Teile Ethanol mit dem dort angegeben Prozentsatz und 1 Teil frische Pflanze im Verhältnis 1 : 5 oder 1 : 10, je nach Giftigkeit der Pflanze. Paracelsus arbeitete alchemistisch und verwendete wahrscheinlich hauptsächlich 40- bis 50-prozentigen Weingeist. In Heilpflanzenbüchern wie denen des Apothekers Pahlow,56 Maria Trebens,57 Andrew Chevalliers58 oder anderer steht, dass für Tinkturen pauschal 70- bzw. 25- bis 30-prozentiger Alkohol verwendet wird.
Für die Zubereitung der Urtinkturen in diesem Buch habe ich mich an den »roten Faden« des Europäischen Arzneibuchs, 7. Ausgabe, 2. Nachtrag gehalten. Dort gibt es spezielle Herstellungsvorschriften für Urtinkturen, Salben und Tabletten. Die gebräuchlichsten für die hier verwendeten Pflanzen sind in den Einzeldarstellungen (ab Seite 57) aufgeführt und im Anhang (siehe Seite 251) noch einmal zusammengestellt.
Um im richtigen Moment den Alkohol mit dem benötigten Prozentgehalt auch parat zu haben, ist es sinnvoll, schon vor der Pflanzensammlung 3 oder 4 verschiedene Alkohol-Wasser-Mischungen vorzubereiten.
Der Ethanolalkohol, den man in der Apotheke erhält, wird immer mit (v/v), also in Volumenprozent angegeben. Um verschiedene Ethanolstufen durch Mischen des gekauften Ethanols mit destilliertem Wasser herzustellen, wird das Volumenprozent (v/v) in Masseprozent (m/m) umgerechnet. Ethanol und Wasser haben dann die gleiche Maßeinheit. Die entsprechenden Prozente sind in der Ethanoltabelle aufgelistet.
Auszug aus der Ethanoltabelle des Deutschen Arzneibuchs
| Ethanol 96 % (v/v) | = | 93,0 % (m/m) – für ätherische Öle |
| Ethanol 94,7 % (v/v) | = | 92,0 % (m/m) |
| Ethanol 90 % (v/v) | = | 85,6 % (m/m) – für organische Substanzen, harte Samen und Harze |
| Ethanol 80 % (v/v) | = | 73,4 % (m/m) |
| Ethanol 77 % (v/v) | = | 70,0 % (m/m) |
| Ethanol 70 % (v/v) | = | 62,4 % (m/m) – für härtere Blätter, Rinden oder Wurzeln |
| Ethanol 67,8 % (v/v) | = | 60,0 % (m/m) |
| Ethanol 52,8 % (v/v) | = | 45,0 % (m/m) |
| Ethanol 50,6 % (v/v) | = | 43,0 % (m/m) – ist die gebräuchlichste Dilutionsgrundlage |
| Ethanol 36,3 % (v/v) | = | 30,1 % (m/m) – für Blüten und weiche Blätter |
| Ethanol 30,5 % (v/v) | = | 25,0 % (m/m) – ist die gebräuchlichste Reihenpotenzierungsgrundlage |
| Ethanol 18,6 % (v/v) | = | 15,0 % (m/m) |
Die Bereitstellung dieser Alkoholgemische wird pauschal nach der folgend beschriebenen Kreuzregel vorgenommen. Als Grundlage kann 70- oder 90-prozentiges Ethanol (v/v) aus der Apotheke und zum Verdünnen destilliertes Wasser verwendet werden. Als Alternative bietet sich auch die Möglichkeit der eigenen Alkohol- und Wasserdestillation an.
Für den gewünschten Alkohol kann ein guter ökologischer Rotwein hochdestilliert werden oder auch ein Grappa aus dem Handel. Dieser wird entweder pur verwendet oder zuerst gereinigt. Das heißt, das »schlechte« destillierte Wasser wird mit einer Destillation vom puren Alkohol wegdestilliert. Man hat dann in etwa 73-prozentigen Alkohol aus dem Grappa. Diesen kann man dann wieder mit »gutem« selbst hergestelltem destilliertem Wasser vermengen, um den gewünschten Ethanolgehalt für die weitere Verwendung zu erhalten.
Um destilliertes Wasser herzustellen, wird Regenwasser gesammelt, das an sich schon nahezu mineralfrei ist, und noch einmal destilliert. Auch hier gilt, dass – wegen der Luftverschmutzung – nicht das Regenwasser der ersten Stunde zu verwenden ist, sondern erst danach in Keramik- oder Glasbehältern aufgefangen wird.
Das Destillieren des Quellwassers erhöht die Qualität.
Kreuzregel
Herstellung von 30-prozentigem (m/m) Ethanol für Blüten und weiche Blätter
Wie viele Teile destilliertes Wasser gebe ich zu wie vielen Teilen 70-prozentigem (v/v) Ethanol (= 62 Prozent [m/m]) hinzu, um 30-prozentiges (m/m) Ethanol zu erhalten?
Ergebnis:
Wenn ich 30 Teile eines 62-prozentigen Ethanols (m/m) mit 32 Teilen destilliertem Wasser mische, erhalte ich 62 Teile eines 30-prozentigen Ethanols (m/m). Oder in ml ausgedrückt: Wenn ich 30 ml des 70-prozentigen (v/v) Ethanols (= 62 Prozent [m/m]) mit 32 ml destilliertem Wasser mische, erhalte ich insgesamt 62 ml des 50,6-prozentigen (v/v) Ethanols (= 43 Prozent [m/m]).
Herstellung von 62-prozentigem (m/m) Ethanol für härtere Blätter, Rinden oder Wurzeln
Wie viele Teile destilliertes Wasser gebe ich zu wie vielen Teilen 90-prozentigem (v/v) Ethanol (= 86 Prozent [m/m]) hinzu, um 62-prozentiges (m/m) Ethanol zu erhalten?
Ergebnis:
Wenn ich 62 Teile eines 86-prozentigen Ethanols (m/m) mit 24 Teilen destilliertem Wasser mische, erhalte ich 86 Teile eines 62-prozentigen Ethanols (m/m). Oder in ml ausgedrückt: Wenn ich 62 ml des 90-prozentigen (v/v) Ethanols (= 86 Prozent [m/m]) mit 24 ml destilliertem Wasser mische, erhalte ich insgesamt 86 ml des 70-prozentigen (v/v) Ethanols (= 62 Prozent [m/m]).
90-prozentiges (v/v) Ethanol
Das 90-prozentige (v/v) Ethanol entspricht 86 Prozent (m/m) und ist so verwendbar, wie es gekauft wird. Mit ihm als Grundlage können niedrigere Ethanolstufen angemischt werden. Man benötigt es recht selten. Es kann selbstverständlich jederzeit als Ausgangsethanol ein anderer Prozentgehalt verwendet werden. Man muss nur die gewünschten Werte an die richtige Stelle in die Kreuzregel einsetzen.
Umrechnungstabelle
Beispiel: Gesucht ist ein Zielethanol von 43 Prozent (m/m) aus einem Ausgangsethanol von 62 Prozent (m/m).
Ergebnis: 43 Teile eines 62-prozentigen (m/m) Ethanols, vermischt mit 19 Teilen destillierten Wassers, ergeben 62 Teile eines 43-prozentigen (m/m) Ethanols.