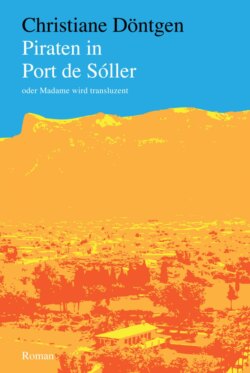Читать книгу Piraten in Port de Sóller - Christiane Döntgen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеMontag, 10. Mai 2010
Gesa und Paul nahmen ihre Rollen sehr ernst und marschierten wie Wanderer durch unwegsames Gelände – ein Anfängerparcours freilich, doch für Menschen, die es gewohnt waren, selbst für kurze Wege den Wagen zu nehmen, eine wirkliche Herausforderung. Paul, der gut und durchtrainiert aussah, hatte Mühe mit dem Atmen. Wenn er eine besonders hohe Steinstufe nehmen musste, hörte Gesa ihn aufstöhnen. Noch keine 40 und die Kondition eines 60-Jährigen. Ein Leben für die Karriere. Im Büro. Hier hatte er den Gipfel fast erklommen, eine Stufe unter dem Vorstand, unter Gesas Mann, dem Vorstandsvorsitzenden. Paul war ein Mann der Ideen, so hatte er es Gesa gegenüber oft betont.
Ideen hatte er tatsächlich unendlich viele, allein fehlte ihm die Fähigkeit, die guten von den schlechten zu unterscheiden. Nicht sein Intellekt hatte ihn aufsteigen lassen, sondern sein Charme, der andere dazu brachte, für ihn zu denken. Paul war ein Sonntagskind. Ein echter Sportsmann, jedoch mit begrenzter Kondition. Hatte sich eine „seiner“ Ideen als erfolgversprechend erwiesen, so war er aufgeregt wie ein kleiner Junge, den der Lehrer in der Schule gelobt hatte. Zu Anfang ihrer Affäre hatte Gesa diese Marotte noch liebenswert gefunden. Inzwischen fand sie es albern. Umso mehr hatte sie sich auf diesen Urlaub fernab jeglicher beruflicher Angelegenheiten gefreut. Doch seit sie auf Mallorca angekommen waren, gab Paul immer wieder den kleinen, fleißigen Schüler, dem etwas ganz Großes gelungen war oder bald gelingen würde. Dass dies ausgerechnet geschah, als sie beide hier alleine waren, beunruhigte Gesa. Er schien etwas im Schilde zu führen und sie hoffte, dass es nichts mit ihr zu tun haben würde. Für mehr als einer Affäre war sie nicht zu haben.
Gesa war leichtfüßiger und hatte ihn beim serpentinenartigen Aufstieg über den steinigen Pfad bald abgehängt. Die leichte Jacke hatte sie bereits um die Hüften gebunden. Sie schwitzte in der neuen Funktionsunterwäsche, die laut Herstellerangaben alle Feuchtigkeit sofort nach außen transportieren sollte. Ihre karierte Outdoorbluse zeigte dunkle Flecken unter den Achseln. Nach einer halben Stunde erreichten sie den ersten im Wanderführer beschriebenen markanten Punkt, eine Finca, die frisch gepressten Orangensaft anbot. Da schon einige Wanderer um den großen Holztisch saßen, gingen die beiden weiter, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Auch wenn es unwahrscheinlich war, hier auf Bekannte zu treffen, wollten sie kein Risiko eingehen.
Gesa und ihr Mann hatten ein »Gentlemen-Agreement«. Es war sogar im Ehevertrag festgehalten, was der eigentlichen Bedeutung des Wortes als mündlicher Vereinbarung zuwider lief. Ein umständlich formulierter Paragraph erlaubte es ihnen, außereheliche Beziehungen zu pflegen, dies jedoch nur diskret und nicht in der Öffentlichkeit. Wenn Gesa hier und da mit einem anderen Mann beim Abendessen gesehen wurde, war das in Ordnung. Und wenn ihr Mann wieder einmal eine firmeninterne Affäre pflegte, so hatte auch das keine Auswirkungen auf ihre gut begründete Ehe. Ein gemeinsamer Urlaub mit einem Mitarbeiter ihres Mannes ging jedoch zu weit, da würden Liebe und Agreement aufhören.
Ihr Mann hatte sie wegen ihres Namens, ihrer Schönheit und ihrer Jugend geheiratet. Ihr Großvater war ein berühmter Dichter gewesen, der Jahr für Jahr als ernst zu nehmender Anwärter auf den Literaturnobelpreis gegolten hatte, ihn jedoch niemals erhielt. Er war in Intellektuellenkreisen geachtet, als es diese noch gab. Hans Sielka, Gesas Mann, sah in der Dichter-Enkelin, deren Vater er hätte sein können, den Glanz jener vergangenen Zeit. Sie war inzwischen der letzte noch lebende Spross dieser in seinen Augen so geistreichen Familie, ein Einzelkind.
In der Welt der großen Unternehmenslenker galt Sielka bis heute als Schöngeist und Förderer der Kunst – eine Art Ablass für das raue Leben als Entscheider. Positiver Nebeneffekt: Er sparte Steuern – freilich weitaus weniger als durch den von ihm gepflegten Transfer größerer Summen ins Ausland. Die Liebe zur Kultur umgab ihn wie eine unsichtbare Hülle. Sie schuf eine Aura, die jeder, der ihn kennenlernte, spürte – auch die junge Gesa Layenbriefer. Sie war ihm zum ersten Mal auf der Vernissage eines aufgehenden Sterns am Kunsthimmel (der bald darauf verglühte) begegnet und hatte sich in diese Mischung aus männlicher Durchsetzungsmacht und feingeistiger Sensibilität verliebt. Beide waren damals gleichermaßen fasziniert voneinander gewesen, ein Schlüssel-Schloss-Erlebnis.
Zu diesem Zeitpunkt war Sielka Mitte 40 und in Liebesdingen abgebrüht. Seine erste Frau hatte ihn in der Hochzeitsnacht sitzen lassen. Vielleicht, weil er in der Zeit vor jener Nacht keinen Rock hatte ungehoben lassen können im sicheren Bewusstsein, bald nur noch unter den einen kriechen zu dürfen. Er hatte sich bei der zweiten Ehe keine Illusionen gemacht. Weder Frauen noch Männern war zu trauen und man konnte sich nur auf eines verlassen – das gute alte Vertragsrecht.
Die damals kaum zwanzigjährige Gesa war demgegenüber sicher, dass der Seitensprung-Paragraph keine Bedeutung haben würde. Sie war verliebt. Obwohl er keinen Zentimeter größer war als sie selbst, hatte sie zu ihm aufgesehen und sich zum Zeitpunkt der Eheschließung alles vorstellen können, nur nicht, jemals wieder einen anderen Mann zu lieben. Noch am Tag der Unterschrift unter den Vertrag hatte sie ihm dies erklärt, und er hatte ihr sanft über das Haar gestrichen, ihr einen Kuss auf die Stirn gegeben und – mit dem Verweis auf die Ungewissheit der Zukunft – den teuren Füllfederhalter in die Hand gelegt. Sie hatte unterzeichnet. Zum ersten Mal mit ihrem neuen Doppelnamen.
Das war ein unerhörter Vorgang für sie, verabschiedete sie doch etwas, das sie gerade erst gewonnen hatte. Denn eines Tages, sie war 17 oder vielleicht 18 Jahre alt gewesen, hatte sie eine Identität bekommen oder vielmehr: sie war ihr gewachsen. Um sie auszuprobieren, hinterließ sie ihre Signatur auf allem, was sich beschriften ließ, auf der ersten Seite jedes neuen Buchs, das sie erwarb, stand nun ihre Unterschrift ebenso wie einst auf den Schulheften, wie auf den Hüllen der Schallplatten und später der CDs. Gesa Layenbriefer. Sie schrieb ganze Seiten in Notizbüchern voll mit diesem Identitätsstifter und testete unterschiedliche Variationen, von streng und geradlinig bis raumgreifend und geschwungen. Für sie war es keine einfache Unterschrift für amtliche Dokumente oder Schecks. Es war ihr elfter Fingerabdruck, ebenso unverwechselbar einzigartig wie die zehn anderen. Sie war kein Kind mehr, aber eben noch nicht erwachsen. Und als sie diese neue Attitüde eingeübt hatte, heiratete sie einen Mann, der noch nicht alt war, aber eben nicht mehr jung. Gerade als die alles umwendende Pubertät sie in neuer Form ausgespuckt und sie gelernt hatte, Ich zu sagen und alles, was sie besaß, mit diesem Ich zu markieren, da spülten große Gefühle dieses Einssein mit sich weg und ihre Grenzen wurden fließend. Doch das war lange her. Heute war sie selbstbewusst, standfest und, was ihre Identität betraf, ebenso sorgen- wie gedankenfrei.
Der Aufstieg war beendet und Gesa erwachte aus ihren Gedanken. Sie erreichte einen breiten Schotterweg, der zwischen Olivenhainen verlief. Hier fehlten die Bäume, die auf dem ansteigenden Pfad Schatten gespendet hatten. Die vormittägliche Sonne empfing die Wanderer mit ihren warmen Strahlen. Paul holte sie ein und griff nach seinem Stofftuch, das er ursprünglich einem Pfadfinder gleich um den Hals gebunden und während des Aufstiegs zum Abwischen des Schweißes aus dem Gesicht genutzt hatte. Wieder zog er es über seine Stirn. Der feuchte, kühle Stoff musste ihm unangenehm sein. Doch er verzog keine Miene. Er atmete tief ein.
»Es ist doch schön hier«, brachte er hervor, als habe jemand das Gegenteil behauptet.
»Was man nicht alles erleben kann, wenn man incognito reist. Diese wilde Landschaft. Ich wusste vorher gar nicht, was Steineichen sind oder dass es sie überhaupt gibt, bevor wir dieses Wäldchen durchwandert haben. Hans wäre begeistert.«
»Ich fände es besser, ihn nicht zu erwähnen. Wir sind hier unterwegs, um von allem Abstand zu nehmen. Auch von meinem Chef«, sagte Paul.
»Entschuldigung. Du wirst doch jetzt nicht etwa eifersüchtig?«, fragte Gesa lachend. »Gibst Du mir die Wasserflasche? Ich muss etwas trinken. Wir haben noch ein gutes Stück vor uns, bis wir den Ort erreichen.«
Paul setzte seinen Rucksack ab, holte die Flasche heraus, öffnete sie und nahm einen kräftigen Schluck. Dann reichte er sie an Gesa weiter.
»Ich hoffe, wir halten es in dieser Absteige bis zum Ende der Woche aus«, sagte er. »Die nächtliche Geräuschkulisse ist grauenvoll. Ich war gerade eingeschlafen, als dieser Bauarbeiter im Zimmer neben uns aufgestanden ist. Da war es erst halb sechs. Und dann dieser Aufzug! Wir hätten uns sofort beschweren sollen. Eine Unverschämtheit, dass die Frau uns das Zimmer direkt neben dem Schacht gegeben hat.«
»Du hast den Schimmel zwischen den Kacheln im Bad und am Duschvorhang vergessen. Und das schlechte Abendessen, das wir zum Glück nur aus der Ferne gesehen haben. Vom Frühstück ganz zu schweigen. Spartanisch ist üppig dagegen.« Gesa nahm einen weiteren Schluck aus der Plastikflasche. »All das ist die einhundertprozentige Garantie dafür, dass wir hier niemanden treffen, der uns kennt. Der Preis dafür ist hoch, was den Komfort betrifft. Ich musste mich beinahe übergeben, als ich gestern Abend dieses lange schwarze Haar in der Dusche entdeckt habe. Da war der Schimmel an der Wand fast verzeihlich. Nichts ist schlimmer als fremde Haare im Sanitärbereich. Zum Glück hast Du da weniger Probleme und konntest es wegmachen.«
Paul nahm die Wasserflasche entgegen und lächelte souverän. Seine Hand ging zur Brusttasche, in der die Zigarettenpackung steckte, doch schien er sich’s anders zu überlegen und strich sich die Haare nach hinten. Sie waren mit einer klebrigen Schicht aus Gel und Schweiß überzogen waren. Es konnte weitergehen.
Gesa hatte sich mit der Erinnerung an das Haar im Bad ein wenig die gute Stimmung verdorben. Gerade hatte sie noch gelacht. Jetzt empfand sie die Sonne als heißer, den Weg als steiniger und die Blase, die sie seit ein paar Minuten an ihrer Ferse spürte, als schmerzhafter. Dass die Aussicht auf ein kleines Abenteuer mit einem Mann sie zu der Dummheit getrieben hatte, in diesem schäbigen Hotel abzusteigen, erschien ihr unwirklich.
»Hans würde Dich umbringen, wenn er wüsste, dass Du etwas mit mir angefangen hast. Er schätzt es nicht, wenn seine Mitarbeiter in seinem Revier wildern«, sagte sie.
»Das weiß ich. Warum fängst Du wieder davon an? Es war uns beiden von Anfang an klar. Das mit uns ist nun einmal so gekommen, wie es nicht kommen durfte.«
»Für Dich könnte das der Karrierekiller sein, wenn wir auffliegen. Für mich bedeutet es das Ende meiner Ehe ohne einen Cent Abfindung. Andererseits kann Dir eine unentdeckte Beziehung zu mir natürlich auch große Vorteile bringen. Du weißt, wie sehr Hans meine Meinung schätzt.«
»Das ist für mich nicht von Bedeutung, und das weißt Du.« Paul blieb stehen, griff nach ihrem Arm und suchte den direkten Augenkontakt, indem er ihr Kinn mit seiner linken Hand leicht anhob. Was sollte sie in seinen Augen entdecken? Aufrichtigkeit? In diesem Moment schaute er, als stünde er kurz davor, etwas Wichtiges zu sagen oder zu tun, doch müsse es sich im letzten Augenblick verkneifen. Welche Überraschung mochte er für sie bereithalten? Jedenfalls hörte es sich nicht danach an, als verspräche er sich mehr von ihrer Beziehung.
»Weiß ich das!«, sagte Gesa und schüttelte den Kopf, um seinem Griff zu entkommen.
»So mag ich Dich. Immer ein bisschen zickig.«
Gesa wendete sich ab und ging weiter.
»Ach, komm schon, Süße!«
»Weiter geht’s. Da vorne ist die Muleta Gran. An diesem Gehöft müssen wir in einer großen Rechtskurve vorbei und dann nach links abbiegen«, sagte Gesa, die den Text des Wanderführers an jeder Stelle des Wegs aus dem Gedächtnis zitieren konnte. Die Fähigkeit des mühelosen, fast automatischen Auswendiglernens hatte ihr während des Studiums der Rechtswissenschaft gute Dienste geleistet. Sie hatte sich eingeschrieben, als sich nach über einem Jahr Ehe noch immer kein Nachwuchs einstellen wollte. Eine Untersuchung ergab, dass es nicht an ihr lag. Um Abwechslung in ihr Leben zu bringen, entschloss sie sich, zu studieren. Privilegiert durch hohe Intelligenz und Wohlstand schaffte sie es in Rekordzeit, obwohl sie nebenbei noch Wirtschaftswissenschaften belegte. Sie musste sich um nichts anderes kümmern als um ihre gesellschaftlichen Pflichten an der Seite ihres Mannes. Den Haushalt besorgte seit jeher ein Ehepaar, das in der Einliegerwohnung der Villa lebte. Nach einem Auslandssemester in Madrid beendete sie ihr Studium erfolgreich. Das Referendariat schloss sie mit einem hervorragenden zweiten Staatsexamen ab. Die Doktorarbeit bereitete ihr wenig Mühe, sie war unter 30, als sie den Titel schließlich führen durfte. Ihr Mann besorgte ihr eine Anstellung in der Rechtsabteilung eines großen Mittelständlers. Nachdem sie den Nimbus des Protegés verloren hatte, brachte sie es durch hervorragende Arbeit recht schnell zu einer leitenden Position – ganz ohne Ehrgeiz.
»Kann ich Dir trauen?«, fragte Gesa unvermittelt. Ohne Paul anzusehen, ging sie weiter. Er folgte. Die Affäre dauerte nun schon über sechs Monate. Leidenschaft empfand sie, wenn sie miteinander schliefen. Kurz davor, kurz danach. Das Gefühl war nicht zu konservieren.
»Natürlich kannst Du mir trauen. Warum auch nicht? Wie sollte ich Dein Vertrauen missbrauchen? Wir haben Spaß miteinander. Was soll das Gerede?«
Ihre Antwort auf seine Fragen interessierte ihn nicht. Paul schob den Grund für ihre Launen offensichtlich wie immer auf die allenthalben bekannte Komplexität weiblicher Gedankengänge. Es war sein Glaube an ein Klischee, der ihm in einer unüberschaubaren Welt das Denken erleichterte oder es gleich überflüssig machte.
»Vielleicht bist Du mit mir zusammen, weil ich Dich in den Vorstand bringen soll. Das ist überhaupt nicht so abwegig.«
»Nicht schon wieder, Gesa. Wie solltest Du mich in den Vorstand bringen? Du arbeitest in einem anderen Unternehmen, und wenn Du mich bei Deinem Mann über die Maßen lobst, riecht er Lunte und wir beide können einpacken. Nein, für meine Karriere bist Du nicht wichtig. Im Gegenteil. Durch Dich könnte sie in schwere See geraten und vom Kurs abkommen.«
»Schiffbruch. Ein schöner Vergleich«, sagte Gesa und zog die Augenbrauen hoch. »Manchmal wirkt es so, als wolltest Du mehr von mir. Was auch immer das sein mag.«
»Wieso mehr? Ich bitte Dich! Wir haben eine Affäre. Wir haben Spaß. Wir sind uns einig. Und wir wollten ein paar Tage hier ausspannen und uns vergnügen. Es gibt kein Mehr, Gesa. Du spinnst«, sagte er und versuchte dabei, gelassener zu wirken, als er war. Seine Antwort beruhigte sie. Was auch immer er vorhaben mochte, mit ihrem Verhältnis hatte es nichts zu tun.
Der Schotterweg endete an einer kleinen Straße. Von hier aus hatten sie eine herrliche Aussicht über die Küste in Richtung Deià. Dieser Anblick traf Gesa so unvermittelt, dass sie die Meinungsverschiedenheit mit Paul einfach vergaß.
»Gott, ist das schön«, sagte sie ganz gegen ihre Gewohnheit völlig unbedacht. Sie schaute über die grünen Wipfel der Aleppokiefern, Steineichen und Zypressen hinweg auf das tiefblaue Mittelmeer, das weit am Horizont mit dem Himmel verschmolz. Paul atmete tief durch und richtete seinen Blick ebenfalls auf die steil ins Wasser abfallenden, dicht bewachsenen Hänge und kargen Felsen.
Sie gingen bis zum Ende einer schmalen Teerstraße. Hier bogen sie nach links auf die Landstraße ab. Wenn ihnen ein Auto oder einer der großen Reisebusse entgegenkam, stoppten sie kurz und traten noch etwas mehr zur Seite. Als sie am höchsten Punkt des Teilstücks angekommen waren, erreichten sie auf der gegenüberliegenden Seite den Eingang zum Wanderweg, der weiter bergauf führte.
Pauls Keuchen wurde vom Summen der Bienen in den Ginsterbüschen und Feigenbäumen übertönt, die den Weg säumten. Die Insekten, die ihren Ohren immer wieder bedrohlich nahe kamen, ließen Gesa das Tempo erhöhen. Sie hatte panische Angst vor diesem Summen. Paul konnte kaum mithalten. An einer kleinen verfallenen Kapelle blieb Gesa stehen. Unruhig wartete sie auf Paul, der sich wahrscheinlich auf eine kurze Verschnaufpause freute und enttäuscht feststellen musste, dass es gleich weiter ging, als er sie eingeholt hatte.
»Hier geht’s nach links über den Camí des Castello nach Sóller. Rechts könnten wir eine Finca besuchen, die sehr schön sein soll. Aber das lassen wir wohl heute besser. Lass uns gehen! Diese Biester machen mich verrückt. Vielleicht gehen wir diesen Weg noch einmal, dann biegen wir hier nach Deià ab. Das dauert deutlich länger. «
Nach einer halben Stunde bogen sie nach rechts ab auf den Camí des Rost, einen historischen Steinpflasterweg, der bergab Richtung Sóller führte. Gesa fragte sich, wie in früheren Zeiten Eselskarren auf diesen Steinen hatten rollen können. Welche Mühsal. Der Weg war alles andere als eben und die Steine vom Regen rund geschliffen. Gesa ging abwärts deutlich langsamer als Paul, der sie weit ausschreitend überholt hatte. Sie konzentrierte sich auf jeden einzelnen Schritt, um nicht ins Rutschen zu geraten, stoppte von Zeit zu Zeit und vermied es so, in einen Rhythmus zu kommen, der sie immer schneller werden lassen würde, bis sie nicht mehr hätte anhalten können und den Berg hinunter rennen müsste. Eine atemlose Vorstellung, die sie gierig Luft schnappen und einen ungewöhnlichen Duft einatmen ließ.
Den vom weichen Waldboden aufsteigenden Geruch trockener Kiefernnadeln kannte sie ebenso wie den der blühenden Büsche am Wegesrand. Doch der süßliche, fast betörende Duft reifer Orangen nahm ihr den Atem und ließ sie innehalten. Ihr war, als wäre ihr eigener Film für kurze Zeit angehalten worden. Gesa war Mitte vierzig und wenn nichts Außergewöhnliches passierte, würde alles immer so weiter gehen. Ihr Leben war leicht. Sie nahm es nicht ernst. Sie machte ihre Arbeit. Sie erledigte sie gut, ohne allzu große Anstrengung. So wie ihre Ehe. Als sie dies dachte, tat sie es mit Gleichmut und großer Gelassenheit. Wie eine Zuschauerin, die eine Aufführung verfolgt und sich fragt, was aus all dem wird. Wenn aber nichts passierte, so wäre es auch gut. Sie stellte keine großen Erwartungen an die Aufführung. Der Film konnte fortfahren.
Gesa ging weiter und prompt rutschte sie ein wenig, ihr rechter Fuß glitt nur ein paar Zentimeter über lockeren Schotter. Doch sie erschrak und schrie kurz auf. Paul hörte sie, drehte sich um und erkannte sogleich, dass nichts passiert war. Er ging weiter.
Gesa atmete tief ein und blickte auf. Vor ihr öffnete sich der Blick auf das Orangental, das von den Bergen der Serra Tramuntana eingefasst war. Sie fragte sich, wieso sie eine Landschaft auf einmal so berühren konnte, kümmerte sich jedoch nicht um die Suche nach einer Antwort und setzte ihren Weg fort.
Die ersten Häuser von Sóller kamen in Sicht. Sie überquerten einen der Tunnel, durch die der »Rote Blitz« fuhr, eine altertümliche Eisenbahn, die Sóller und Palma verband. Es war Mittagszeit. Bei den Häusern, die sie passierten, war keine Menschenseele zu sehen. Nach einer scharfen Rechtskurve fanden sie sich unter einer von wildem Wein überrankten Pergola wieder. Sie war auf der einen Seite an der Mauer eines Hauses und auf der anderen Seite auf steinernen Säulen befestigt. Der öffentliche Weg führte über diese fast privat anmutende Terrasse. Die Pergola endete vor einer Linkskehre, wo sie ein älterer Mann erwartete. Neben ihm stand eine große, alte Badewanne voller Orangen. Der Mann begrüßte die Wanderer mit einem freundlich genuschelten »Buenos días«, das diese mit dem für Touristen üblichen »Hola« erwiderten. »Naranja dulce«, sagte er, fügte ein »buy« hinzu und grinste, wobei sich in seinem Gesicht zwischen den grauen Bartstoppeln tiefe Furchen zeigten.
»No, gracias«, sagte Gesa, während Paul unbeeindruckt weitergegangen war und dem Mann keine Beachtung schenkte.
»Sie haben eine schöne Terrasse«, fuhr Gesa auf Spanisch fort.
Der Mann war überrascht. Von Touristen erwartete er das wohl schon lange nicht mehr, wahrscheinlich schon gar nicht von einer Deutschen, die zwar nicht mehr ganz so jung, aber trotzdem dem Klischee einer typischen Blondine entsprechen könnte.
Die Situation war für ihn sicherlich ungewöhnlich. Normalerweise sprach er wahrscheinlich die Touristen kurz an, die meisten gingen weiter und er konnte sich wieder auf seinem weißen Plastikstuhl niederlassen. Manchmal kaufte einer etwas, dann konnte man sich mit Gesten verständigen, denn er sprach offensichtlich nur Spanisch und den Inseldialekt. Sie hatte das Gefühl, ihn sehr beeindruckt zu haben.
»Danke. Mein Vater hat die Pergola angelegt. Im Sommer sind die Blätter des Weins ein wahrer Segen, und im Herbst ernten wir wunderbare Trauben.«
»Und Sie haben viele Orangenbäume, nehme ich an.«
»Wie man’s nimmt. Zu viel und zu wenig. Meine Abnehmer sind ein paar Hotels im Hafen. Dafür ist meine Ernte mehr als groß genug. Ich versuche immer noch, zusätzlich ein paar Orangen an Touristen zu verkaufen, doch die bekommen schon mehr als genug in Hotels und Restaurants, wie Sie vielleicht schon gesehen haben. Für den Export ist meine Plantage zu klein. Seit zwei Jahren bin ich Mitglied der Kooperative, die Früchte von hier über das Internet in Deutschland vertreibt. – Und Sie? Was bringt Sie ins Orangental? Das Wandern?«
»Nun ja, bisher bin ich nicht viel gewandert in meinem Leben«, sagte Gesa und schaute zu Paul, der weiter entfernt stehen geblieben war. »Wir wollten mal wirklich ganz in Ruhe vom Alltag entspannen. Deshalb sind wir hier.«
»Erholen kann man sich bei uns gut. In welchem Hotel wohnen Sie denn?«
»Im Borrasca in Port de Sóller, das letzte Hotel auf der linken Seite der Bucht, oberhalb vom Strand ...«
»Oh, ja, ja, ich kenne das Borrasca. Es gehört einem Freund von mir. Oder besser: seiner Frau. Die Orangen dort sind von mir. Ein sehr einfaches Haus. Ihr Mann sieht gar nicht danach aus.« Jetzt schaute der Mallorquiner in Pauls Richtung.
»Doch. Wir mögen das Einfache. Ab und zu. Er ist nicht mein Mann.«
Der Mallorquiner grinste nur.
»Gesa! Was ist jetzt? Gehen wir weiter?«, rief Paul laut, er konnte sich wohl nicht vorstellen, dass Gesa sich freiwillig mit diesem Menschen unterhielt, und wollte sie retten.
»Entschuldigen Sie, ich muss weiter«, sagte Gesa und wollte ihrem Gegenüber die Hand schütteln. Dieser gab ihr zum Abschied eine Orange mit auf den Weg.
»Sie sind wirklich sehr süß. Und gesund. Vielleicht brauchen Sie ein wenig Kraft für das Fest heute. Essen Sie die guten Orangen aus unserem Tal, schöne Frau, und kommen Sie einmal wieder.«
Gesa sagte, das werde sie bestimmt tun, glaubte sogar daran, verabschiedete sich und ging zu Paul.
»Was wollte der Kerl denn noch von Dir? Konnte der doch Deutsch oder was?« Er nahm ihr die Orange aus der Hand und begann, sie zu schälen.
»Ja, ein wenig«, sagte sie. Mehr wollte sie ihm nicht erklären. »Wir haben über Orangen gesprochen.«
»Meine Güte, ein anderes Thema haben die hier ja auch nicht, die Orangentaler.«
Paul lachte über seine Wortschöpfung und legte Gesa den Arm um die Schulter, entfernte ihn aber sofort wieder. Offensichtlich war ihm die körperliche Nähe angesichts der Hitze zu warm. Er gab ihr die Hälfte der Orange.
Paul beschleunigte seinen Schritt vorbei am botanischen Garten der Stadt. Von der Natur hatte er für heute wohl genug. Sie sah ihm an, dass er eine Zigarette brauchte und ein Bier, dann eine Dusche, ein gemütliches Abendessen in einem guten Restaurant und eine lustvolle Nacht. Er war einfach zu berechnen. Das gefiel ihr in diesem Moment.
Die Häuser in der Straße, die zum Stadtkern führte, waren mit zwei Sorten von Fahnen geschmückt. Auf der rotgrundigen war ein Halbmond zu sehen, die andere war weiß mit rotem Quer- und Längsbalken.
Auf der Plaza Constitución, dem Marktplatz von Sóller, herrschte ein buntes Treiben. Er war voller Piraten und altertümlich gekleideter Menschen. Nur vereinzelt waren Wanderer oder andere Touristen zu sehen. Der von der Kopfseite her leicht abfallende Platz war umrahmt von Cafés und Restaurants sowie vom historischen Gebäude einer Bank (die aus noch nicht geklärten Gründen die Finanzkrise überstanden hatte), dem Rathaus und Sant Bartomeu, einer Kirche, die im 15. Jahrhundert auf den Grundmauern einer Moschee errichtet worden war. So stand es zumindest im Reiseführer, den Gesa nun für Paul zum Vortrag brachte. Er hörte nicht zu. Zielsicher steuerte er auf einen der vielen freien Tische auf der Terrasse des Café Central zu, ließ sich in den Stuhl fallen, winkte dem Kellner zu und sagte: »Chef, ein Bier bitte!«. Dann wandte er sich an Gesa: »Und Du, vielleicht einen Kaffee?«
»Sangría und ein Wasser, bitte«, sagte sie ebenfalls auf Deutsch zum Kellner und versuchte, mit einem Lächeln das schlechte Benehmen ihres Begleiters wegzuzaubern.
Der Kellner lächelte zurück und sagte dann auf Spanisch: »Es tut mir leid, aber wir schließen gleich. Heute feiern wir Es Firó, den Sieg der Sollérics über die Mauren.«
Paul sah ihn fragend an.
»Wir schließen. Wir feiern ein Fest. Wie jedes Jahr. Heute ist ein großes Spektakel im Hafen. Alle fahren hin«, erklärte der Kellner auf Deutsch.
»Das darf doch nicht wahr sein«, rief Paul und zündete sich eine Zigarette an. Der Kellner zuckte entschuldigend mit den Schultern, lächelte schief und räumte die letzten Tische ab.
»Dann müssen wir wohl wieder zurück in den Hafen«, sagte Gesa. »Am besten, wir fahren mit der alten Straßenbahn. Die fährt hier gleich um die Ecke ab.«
Paul griff in den Rucksack, holte die Wasserflasche hervor, öffnete sie und leerte sie in einem Zug. Die Flasche stellte er auf den Tisch. Dann stand er auf und schoss an Gesa vorbei in die Richtung, in die sie gezeigt hatte. Gesa verdrehte die Augen und seufzte laut. Sie lief ihm nach. Als sie die Ecke an der großen Kirche erreicht hatten, an der sie zum Bahnhof abbiegen wollten, erblickten sie eine große Menge verkleideter Menschen. Viele hatten mit Ruß geschwärzte Gesichter und waren mit Spielzeugkrummsäbeln ausgestattet, sie trugen mittelalterliche Gewänder oder praktische Piratenkleidung. Manche Frauen hatten trachtenartige Kleider und Kopftücher angelegt. Allen gemeinsam war die ausgelassene Stimmung.
Pauls Blick zeigte sein Entsetzen, Gesa war begeistert. Ihr fielen nun die Worte aus dem Reiseführer zu diesem alljährlich stattfindenden Fest ein, die sie zwar gelesen, jedoch nicht auf den heutigen Montag bezogen hatte. Sie hatte nicht nachgerechnet. Als sie Paul gerade die Hintergründe erklären wollte, begann dieser damit, sich durch die Menge zur Bahnstation zu kämpfen, indem er sich mit den Ellenbogen Platz verschaffte. Gesa folgte ihm durch die geschlagene Schneise, die Blase an der Ferse ihres rechten Fußes begann unangenehm zu brennen. Sie wünschte, Paul wäre nicht hier. Sie hätte vorher nachdenken sollen. Überhaupt hätte sie irgendwann einmal irgendetwas denken sollen. Ihren Verstand einsetzen, statt jetzt hinter diesem Mann her zu schieben und die dumme Touristin zu geben, die man mit unflätigen Bemerkungen dazu aufforderte, sich wie alle anderen hinten anzustellen. Schließlich warteten sie alle auf die Züge, die sie zum Hafen bringen sollten, bevor die Bahn den Betrieb für den Nachmittag komplett einstellte. Sie hatte nicht übel Lust, Paul die Beschimpfungen ins Deutsche zu übersetzen, unterließ es aber dann aus Trägheit.
Als er fast am Haltestellenschild angekommen war, blieb er endlich stehen. »So, das dürfte reichen. Von hier aus haben wir eine strategisch günstige Position, um mitgenommen zu werden. Das ist ja wie Karneval. Stand das nicht im Reiseführer?«
»Nein, es wurde mit keinem Wort erwähnt«, log Gesa.
»Was? Obwohl das angeblich jedes Jahr stattfindet? Entweder der saubere Herr Kellner hat uns einen Bären aufgebunden oder der Reiseführer ist Mist. Da vorne kommt die Bahn aus dem Depot gerollt. Was ist das denn für ein Gerät?«
Die holzverkleideten, an den Seiten offenen Wagen, die nun auf sie zurollten, dürften für Paul in einen Freizeitpark gehören. Das sagte sein unwilliges Kopfschütteln. Obwohl Mitglieder der EU, seien die südlichen Länder sehr weit zurück, dozierte er und Gesa war froh, dass ihn außer ihr scheinbar niemand verstehen konnte, als er von faulen Gesellen und Schmarotzern sprach.
Als die Bahn am Bordstein zum Stehen kam, schoben sich die Fahrgäste hinein. Die beiden Deutschen wurden mitgespült und fanden sich in engem Körperkontakt mit den Einheimischen wieder, die sie als Fremdkörper nicht beachteten und sich über sie hinweg oder an ihnen vorbei weiter unterhielten. Paul zog Gesa näher zu sich heran, musste sie aber sofort wieder loslassen, weil sich die Bahn heftig schwankend in Bewegung setzte. Er griff nach einer Leine, die sich unter der niedrigen Decke durch den gesamten Wagen zog, zuckte aber augenblicklich zurück, da sie keinen Halt bot, sondern nur ein Glöckchen zum Klingen brachte. Die Umstehenden lachten, weil mal wieder ein Tourist das Signal zum Anhalten gegeben hatte.
In der nächsten Kurve bekam der Wagen eine solche Schieflage, dass Gesa heftig zur Seite geworfen wurde. Ein Seeräuber hielt sie fest, indem er mit seiner großen schwarzen Hand nach ihrem Hintern griff. Er grinste, seine Zähne leuchteten im Kontrast zur geschwärzten Gesichtsfarbe gelblich. Seine Augen waren hinter der großen verspiegelten Sonnenbrille nicht zu sehen. Er sah aus wie ein Wüstenbewohner. Das lange weiße Bettlaken war an seinem Kopf mit einem roten Band befestigt. Über seinem schwarzen T-Shirt trug er eine orangefarbene Bauchbinde, einem Kummerbund ähnlich, dazu eine dunkelblaue Pluderhose. Gesa richtete sich sofort wieder auf und drängte zu Paul. Der Pirat ließ seinen Plastikkrummsäbel, den er in der anderen Hand hielt, wie ungewollt zwischen ihre Beine gleiten und wendete sich dann ab. Paul, der immer noch nach Halt suchte, hatte von all dem nichts mitbekommen und fühlte sich nun von Gesa bedrängt.
»Was sind das für ekelhafte Typen«, zischte sie.
»Rück etwas zur Seite. So kann ich uns nicht halten«, sagte Paul unwirsch und streckte den linken Arm über eine Sitzbank hinweg zur Wand über dem Fenster. Seine Handfläche fand notdürftigen Halt. Doch als die Bahn scharf bremste, kippte er nach hinten. Gleich mehrere Fahrgäste schoben ihn wieder in die aufrechte Haltung zurück. Er fluchte.
»Dreckige Hände, verklebt von Schweiß und was weiß ich noch allem. Das ist doch widerlich. Es ist Mittag und sie stinken wie die Schweine«, fauchte er entrüstet und umklammerte Gesas Schulter, die sich an der Rückenlehne einer Sitzbank festhielt.
Sie fuhren an Hinterhöfen vorbei, hielten nur noch einmal auf scheinbar freier Strecke. Ob jemand ein- oder ausstieg, konnten Gesa und Paul von ihrem Standort nicht erkennen. Gesa fühlte sich beobachtet, und als sie sich umdrehte, sah sie, wie der Wüstenpirat sie mit ernster Miene anstarrte. Als sie zu ihm schaute, stülpte er die Lippen unmerklich nach vorne. Gesas Herz trommelte in Panik. Obwohl ihr unter all diesen Menschen zusammen mit Paul nichts passieren konnte, fühlte sie sich ausgeliefert. Es mussten die Nerven sein. Die ungewohnte Anstrengung. Die vielen neuen Eindrücke. Paul, der sich seltsam nervös aufführte. Und dann diese Hitze. Sie wollte jetzt nicht überreagieren. Bald würden sie ankommen und dann ins Hotel gehen. Bei dem Gedanken, dass sie sich auf dieses Loch freute, musste sie lächeln. Vielleicht sollten sie abends das Essen dort probieren, wenn alle anderen Lokale geschlossen waren. Schließlich hatten sie Halbpension gebucht. Der Unterschied zur Übernachtung mit Frühstück hatte für die ganze Woche 20 Euro betragen. Die Qualität des Essens musste unterirdisch sein. Bis dahin waren es allerdings noch ganze sechseinhalb Stunden.