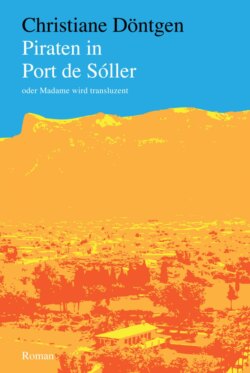Читать книгу Piraten in Port de Sóller - Christiane Döntgen - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеAuf der Terrasse, die durch die Straße vom Hotel Borrasca getrennt war, standen Klappstühle und -tische aus einfachem Blech in bunten Farben. Im Moment saß hier niemand. Die Wanderarbeiter, die an diesem Nachmittag frei hatten, standen am weißen Geländer der Terrasse mit dem Rücken zum Hotel und beobachteten den Angriff der Mauren auf den Hafen von Sóller. Kanonenschüsse erschütterten die kleine Bucht. Auf der gegenüberliegenden Seite stiegen orangefarbene Rauchwolken auf. Unterhalb ihres Standorts konnten sie auf der rechten Seite das gespielte Kampfgetümmel der Truppen von Mauren und Christen am Strand beobachten. Woran man erkennen sollte, wer zu wem gehörte und wer den Sieg davontrug, wussten sie nicht.
Unter den Schaulustigen war auch Luis Rodriguez, Polier aus Valencia. Er war froh, heute Nachmittag nicht in der Hitze arbeiten zu müssen. Nach der kurzen Frühschicht hatte er geduscht, ein weißes T-Shirt und eine khakifarbene Hose angezogen und anschließend eine Kleinigkeit zu Mittag gegessen. Er liebte diesen Blick über die Bucht und die dahinter liegenden Berge. Die Ruhe. Das Spektakel am Strand interessierte ihn nicht. Als er genug gesehen hatte, zog er ein Buch aus der Seitentasche seiner Hose und setzte sich an einen Tisch. Auf dem kleinen Stuhl wirkte sein kräftiger Körper so deplatziert, wie es das Buch in seinen Händen tat. Hier im Schatten konnte er die freie Zeit entspannt verbringen, während seine Kollegen sich anschickten, den üblichen Zug durch die Gemeinde zu machen. Nach und nach verabschiedeten sie sich. An seine Marotten hatten sie sich inzwischen gewöhnt. Viele kannten ihn von anderen Baustellen. Luis las, hörte klassische Musik und konnte sogar dem kleinen Skulpturengarten des neuen Luxushotels etwas abgewinnen, in dem die anderen nur Häufchen deformierter und zerstückelter Eisenträger sahen.
Luis las gerade das Werk eines südamerikanischen Autors. Die Struktur des Romans Stück für Stück zu erkennen, hinter die Fassade aus Worten und vordergründiger Handlung zu blicken, bereitete ihm bei diesem Buch eine besondere Freude. Es war genauso schön, wie der Vollendung eines Bauwerks beizuwohnen. In seinen Augen war der Autor ein großer Baumeister, denn was machten Schriftsteller anderes, als zu bauen! Die Worte waren wie Steine, die nach und nach ein Haus entstehen ließen, manchmal bloß eine wacklige Hütte, zuweilen eine imposante Brücke, die unbekannte Inseln der Erkenntnis für den menschlichen Geist erschloss.
Lesen war eine große Lust, und er wollte eines Tages so viel gelesen haben, dass er selbst in der Lage war, Bücher zu schreiben. Bis dahin nährte er sich mit den Werken anderer. Um sich den Traum vom Schreiben erfüllen zu können, sparte er einen großen Teil seines Einkommens, dafür nahm er die Strapazen weltweiter Arbeit auf sich. Es würde nicht mehr lange dauern, dann könnte er das Leben des Wanderarbeiters gegen das eines Schriftstellers tauschen. Vielleicht sogar noch vor seinem fünfzigsten Geburtstag in drei Jahren. Sein einziges Problem dabei: Luis war Legastheniker. Als Kind hatte er sehr spät mit dem Sprechen angefangen und auch nur wenige Worte zur Verfügung gehabt. Während seiner Schulzeit hatte er dann viel gelesen. Seine Rechtschreibung blieb jedoch verheerend und rief – je nachdem, wie der Leser zu ihm stand – Belustigung, Mitleid, Entsetzen oder Gleichgültigkeit hervor. Und so war er in der seltsamen Lage dessen, der in seinem Kopf zwar Geschichten erdenken und in schönen Sätze formulieren, sie jedoch, was die Orthographie betraf, nicht in gleicher Schönheit zu Papier bringen konnte.
Der Polier seufzte und sah hinaus aufs Meer. Nur selten hatte er das Glück, seiner Heimat Valencia so nahe zu sein wie jetzt. Dort zog es ihn von Zeit zu Zeit immer wieder hin, weil er der festen Überzeugung war, dass jeder sich seiner Herkunft und seiner Wurzeln bewusst sein sollte. Wenn er oben von der Baustelle nach Westen schaute, ging sein Blick direkt nach zur Stadt seiner Kindheit. Auch wenn über 250 Kilometer Mittelmeer dazwischen lagen, hatte er in solchen Augenblicken das Gefühl, seinem Ursprung nahe zu sein. Wenn das Hotel fertig war, würde er mit der Fähre übersetzen und seine Mutter, die vier Geschwister und ihre Familien wiedersehen. Bis dahin dauerte es noch ein paar Monate. Sie würden bis zum Herbst hier bleiben müssen, er und seine Leute, die aus aller Herren Länder kamen.
Luis war sehr ruhig und verschlossen. Er mochte es nicht, viele Worte zu machen. Die meisten waren seiner Meinung nach nur daher gesagt und ohne Bedeutung. Umso erstaunlicher waren seine sprachlichen Fähigkeiten. Neben dem Spanischen als Muttersprache beherrschte er noch das Französische perfekt – zumindest was das Sprechen betraf, denn die Rechtschreibung war hier noch verheerender. Außerdem konnte er sich auf Deutsch, Türkisch und Griechisch unterhalten. Polnisch und Englisch verstand er ebenso wie Persisch. Er saugte andere Sprachen auf wie ein Schwamm und verstand recht schnell. Wenn der Schwamm sich vollgesogen hatte, konnte er ihn auswringen und sprach fast mühelos mit den Einheimischen im Gastland. Für seinen Job war diese Gabe von unschätzbarem Wert. Als Polier musste er zwischen der Baustellenleitung und seinen Leuten vermitteln.
Am Strand wurde es langsam ruhiger. Die Kanonensalven waren beendet. Nur die Spielzeugpistolen knallten hier und da. Als Luis ein weiteres Kapitel gelesen hatte, schaute er sich um. Vor ihm lag der Eingang des Hotels. Die schmale Straße davor war auf der einen Seite mit den Mietwagen der Gäste zugeparkt. Auch der silberne Kleinwagen von Madame, der kauzigen Hotelchefin, stand dort.
In diesem Augenblick kehrte das deutsche Paar zurück, das im Zimmer neben seinem untergebracht war. Er hatte sie am Abend zuvor kurz im Flur gesehen. Das Hotel war hellhörig, und die beiden waren nicht die ersten, deren sehr private Geräusche Luis in den letzten Wochen zu hören bekommen hatte. Jetzt allerdings wirkten sie alles andere als vergnügt. Luis winkte ihnen zu, sie übersahen ihn. Auch gut. Sie gingen hinein, doch aus irgendeinem Grund blieb das Bild der Frau auf seiner Netzhaut haften, sodass Luis sie in seinem Innern betrachten konnte. Er musste den Kopf schütteln, um es wieder loszuwerden. Es fiel hinab und hinterließ ein leichtes Kitzeln in der Magengrube.
Luis stand auf und wollte gerade zu seinem gewohnten Spaziergang zum Leuchtturm aufbrechen, als ein alter Mann mit zwei Flaschen Bier in der Hand vor das Hotel trat und auf ihn zukam. Luis setzte sich wieder und legte das Buch vor sich auf den Tisch.
»Auch kein Freund von großen Feiern«, stellte der Mann auf Französisch fest und reichte Luis eine Flasche. »Voilà!«
»Danke.«
»Ich schaue gerne zu. Aber zum Mitmachen bin ich zu alt«, sagte der Alte, nahm einen Schluck und Luis tat es ihm gleich.
Mit einem Nicken stellte er sich vor. »Eduard Ziguré, einfach Eduard.«
»Luis Rodriguez.«
»Wie der Boxer?«
»Ja, und wie der Fußballspieler, der US-Autor und wahrscheinlich noch Tausende andere mit diesem Allerweltsnamen.«
»Ein spanischer Name, ein spanisches Buch. Aber Du kommst aus Frankreich, oder?«
»Nein, ich bin Spanier. Mein Vater war Algerier und ist in Frankreich aufgewachsen. Daher die Sprache und die Farbe. Der Name kommt von meiner Mutter.«
»Hm, ich spreche nur Französisch, kann aber Spanisch ganz gut verstehen«, brummte Eduard.
»Mit Madame verwandt?«
»Ich bin ihr Vater.«
»Und jetzt zu Besuch?«
»Jetzt zu Besuch.«
Damit war die Unterhaltung der Wortkargen erschöpft. Sie saßen da und schauten ins Weite. Offensichtlich war ihnen ihre Gesellschaft nicht unangenehm. Obwohl lautes Stimmengewirr vom Strand heraufklang, war es durch das einvernehmliche Schweigen deutlich ruhiger geworden, als wenn einer der beiden hier alleine gesessen hätte.
Vom Strand her zog eine Gruppe von vier Mauren die Straße zum Hotel herauf. Alle vier trugen sie dunkle Sonnenbrillen. Ihre Gesichter waren geschwärzt. Vor dem Eingang blieben sie kurz stehen, zwei gingen hinein, die anderen beiden schlenderten über die Straße, um sich am Geländer der Terrasse stehend einen Überblick über die Reste der Schlacht zu gönnen. Wenig später kamen ihre beiden Freunde wieder aus dem Hotel heraus und winkten ihnen mit vier Bierflaschen zu. Sie hatten gerade die andere Straßenseite erreicht, da erschien Madame in der Tür.
»Bildet Euch ja nicht ein, die Flaschen mitnehmen zu können«, schimpfte sie laut hinter ihnen her. »Und wehe, Ihr werft sie aus lauter Vergnügen über das Geländer gegen die Felsen! Normalerweise verkaufen wir hier ausschließlich an Gäste. Damit Burschen wie Ihr uns nicht das Geschäft versaut.«
Die Mauren winkten ihr lachend zu und lieferten das Bier bei ihren Kameraden ab.
Hinter Madame stand das Zimmermädchen Gabriella, das sich nach dem Putzen der Zimmer ein Glas Rotwein gönnte und bei dieser Gelegenheit gerne ein Schwätzchen mit Madame hielt. Jetzt allerdings wollte sich Gabriella der Laune von Madame entziehen und kam auf die Terrasse.
»Bei Euch ist sicher noch Platz für mich«, sagte sie und griff nach einem Stuhl vom Nebentisch. Metall rieb über Stein. Sie positionierte den Stuhl so, dass sie die Bucht im Blick und das Hotel im Rücken hatte, und ließ sich seufzend nieder. Niemals hätte sie sich mit echten Hotelgästen an einen Tisch gesetzt. Das hatte sie Luis gleich bei ihrem ersten Zusammentreffen erzählt. Erstens gehörte es sich nicht und zweitens hätten sie die Gelegenheit schamlos ausgenutzt, um mit ihr über den Zustand der Zimmer zu reden. Jetzt hatte sie frei. Diese beiden Männer hier sah sie als Ihresgleichen. Die Wanderarbeiter waren keine Gäste, eher normale Mieter, deren Zimmer sie nur alle zwei oder drei Tage reinigen musste.
Gabriella wunderte sich darüber, dass der Neue seit gestern auf dem Notbett im Geräteschuppen schlief. Die Nächte waren noch recht kalt und überhaupt: In seinem Alter konnte er doch eigentlich nicht mehr auf dem Bau arbeiten. Als sie Madame vorhin darauf angesprochen hatte, erhielt sie nur heftiges Kopfschütteln als Antwort, was Gabriella wiederum als Zustimmung interpretierte: Eine Schande, dass der Alte noch arbeiten musste, dazu noch körperlich schwer.
Sie wusste, wovon sie sprach. In einem Alter, in dem andere von den Früchten ihrer jahrzehntelangen Arbeit lebten, schuftete Gabriella immer noch tagein tagaus im Hotel. Nur von dem bisschen Rente konnte sie schließlich nicht leben. Die einzigen kleinen Laster, die sie sich gönnte, waren das Rauchen und das Trinken. Sie machten den Tag erträglicher und die Nacht ruhiger. Natürlich hatten Ein- bis Vier-Sterne-Gäste schon so manches Mal versucht, ihr Zimmer rauchfrei zu halten, und Gabriella zur Rede stellen wollen. Doch in diesen Fällen sprach sie ausschließlich Mallorquí, den inselweiten Dialekt des Katalanischen, und lächelte den Beschwerdeführer mit einer Herzlichkeit an, die keinen Zweifel darüber ließ, auf wessen Seite die moralische Verfehlung lag. Der Gast blickte beschämt zu Boden und beließ es bei einem kräftigen Durchlüften seines Zimmers. Dass Gabriella süchtig nach Rotwein war, bemerkten die meisten Gäste dagegen nicht, da der Geruch von Rauch und Putzmitteln alles überdeckte. Was sie allerdings mit den Putzmitteln machte, war selbst bei genauem Hinsehen nicht zu erkennen. So sehr man sich auch bemühte – selten war ein sauberes Bad oder gar ein unter dem Bett geputzter Boden vorzufinden. Wenn Gäste ihren leeren Koffer zu Beginn des Urlaubs an einen bestimmten Platz stellten und diesen fortan nicht mehr nutzten, so fanden sie in jenem Bereich am Ende des Urlaubs Unmengen an Staub und Haaren. Gabriella hatte feinsäuberlich um den Koffer herum gewischt. Schließlich hatte sie mehr als ein Zimmer zu reinigen und konnte sich nicht mit solchen Kleinigkeiten aufhalten.
Ihre Nichte Magda half ihr ab und zu, wenn das Hotel so gut belegt war, dass Gabriella es wirklich nicht mehr alleine schaffen konnte. Aber ob Nichte oder Tante, das Ergebnis war nahezu identisch. Darauf legte Gabriella großen Wert, und Magda bereitete es keine Mühe. Lediglich einmal glaubte die Tante, ihre Nichte bei einem Faux-pas überrascht zu haben. Magda mühte sich unter einem Bett ab, sie war zur Hälfte darunter verschwunden, so dass ihr Hinterteil zwischen Bettkante und Boden eingeklemmt war. Gabriella entwich ein ungläubiges, fast nur gehauchtes „Magda?“ und die Nichte robbte wieder unter dem Bett hervor. Obwohl sie nun ganz und gar verstaubt war, hielt sie voller Freude grinsend einen Ohrring empor. Es war selbstverständlich ihr eigener, für Gäste-Geschmeide bückte man sich nicht einmal. Fand man einmal einen Ring oder eine Kette auf dem Boden, so schob man das Fundstück mit dem Besen in die Mitte des Zimmers, denn dort würde es die Besitzerin schon finden. Ihren eigenen Ohrclip hatte Magda mit Schwung unter das Bett befördert, als sie sich das Staubtuch lässig über die Schulter geworfen hatte. So hatte sie sich ausnahmsweise in unbekanntes Terrain vorwagen müssen. Erleichtert hatte Tante Gabriella anschließend den Staub von Magdas Kittel geklopft und scherzend verließen beide das Zimmer – ohne den Staub wieder unter das Bett zu pusten.
»Wir freuen uns, wenn Du bei uns sitzt«, sagte Luis zu Ga-briella. Mit ihr sprach er selbstverständlich Spanisch. Er war es gewohnt, zwischen verschiedenen Sprachen zu wechseln und es bereitete ihm keine große Mühe. Er war darauf bedacht, alle Beteiligten in eine Unterhaltung mit ein zu beziehen. In diesem Fall erübrigte sich jedoch eine Übersetzung für seinen Tischnachbarn, da dieser bekundet hatte, Spanisch wenigstens zu verstehen. Für ihn sprach er es jedoch etwas langsamer.
»Warum ist Madame so ungehalten? Bloß wegen der Piraten?« Luis zeigte mit dem Kopf auf die vier jungen Männer, die am Geländer standen.
»Es ist meine Schuld, natürlich, wie immer. Sie war hinten in der Küche, als die da reingekommen sind. Normalerweise heißt es: Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Egal ob Hotelgast oder Fremder. Also habe ich ihnen Bier verkauft. Mit Preisaufschlag. Wie immer. Leider waren sie noch nicht zur Tür hinaus, als Madame aus der Küche kam. Sie keifte: ‚Wie kannst Du denen was verkaufen?’ und stürmte hinter ihnen her. Man kann es ihr nicht recht machen. Nie, nie, nie!« Gabriella verdrehte die Augen und nahm einen kräftigen Schluck aus ihrem Glas.
»So ist sie nun mal«, murmelte Eduard auf Französisch. »Wenn sie wütend ist, hält man sich am besten fern von ihr. Kein vernünftiger Mensch schüttelt eine Champagnerflasche, bis der Korken fliegt.«
Gabriella lächelte freundlich. Sie stimmte in das rege Schweigen ihrer Tischherren ein und genoss es offensichtlich, unbehelligt zu rauchen und zu trinken.
Nach einer Weile erschien das deutsche Paar in der Tür des Hotels. Luis sah aufmerksam hinüber, sie hatten sich offensichtlich kurz frisch gemacht. Die Frau trug ein sommerliches, weißes Kleid mit zart rosafarbenen Blüten. Über ihre Schultern hatte sie eine weiße, leichte Strickjacke gelegt. Ihr Mann hatte sein rosafarbenes Hemd mit dunkelroten Bermudas kombiniert, die den Blick auf seine dicht behaarten Beine freigaben. Seine Füße steckten in weißen Bootsschuhen. Reflexartig hob Luis erneut die Hand zu einem Gruß, ließ sie aber dann wieder sinken.
Er wunderte sich darüber, dass die Frau die vier jungen Männer auf der Terrasse mit großen Augen anstarrte. Einer von ihnen, dessen Umhang von einer orangefarbenen Bauchbinde zusammengehalten wurde, nickte ihr fast unmerklich zu. Sie kannten sich. Ihr Begleiter bekam davon nichts mit. Er blickte nach rechts und sprach mit ihr, ohne sich ihr zuzuwenden. Sie antwortete etwas, ebenfalls, ohne den Kopf in seine Richtung zu bewegen. Zwischen ihr und dem jungen Piraten lagen mindestens 20 Jahre und eine völlig andere Kultur. Vielleicht war es das, was sie zueinander zog. Luis’ Theorie scheiterte am beinahe angstvollen Blick der Frau zu den Mauren. Was ging hier vor? Er würde es jetzt nicht herausfinden, denn das Paar machte sich auf den Weg zum Strand.
Die vier Männer taten es ihm gleich. Der Pirat, der sie scheinbar gegrüßt hatte, blieb kurz stehen und zog ein Handy unter seinem Umhang hervor. Nach einem kurzen Telefonat folgte er seinen Freunden zum Strand. Dort befand sich mit der Strandbar eines der wenigen Lokale, die geöffnet hatten. Die meisten anderen Restaurants und Cafés legten keinen Wert auf den Besuch marodierender Mauren- und Christenbanden.
Luis lies seinen Blick über das Treiben in der Bucht streifen und schüttelte den Kopf. »Wie lange sich Geschichte doch hält, wenn man die Ereignisse feiert«, sagte er nachdenklich auf Spanisch. »Und wie sich unser Bild von der Geschichte unterscheidet von dem, was andere darin sehen. Das ist alles schon so ewig her und eigentlich völlig bedeutungslos. Im achten Jahrhundert hat irgendein arabischer Feldherr begonnen, die iberische Halbinsel zu erobern. Die Provinz nannten die neuen Herrscher Al-Andalus, das Land der Vandalen. Erst knapp 800 Jahre später gelang den katholischen Königen die vollständige Reconquista. Wiedereroberung. Nach so langer Zeit. Manche Moslems sehen Spanien bis jetzt als ihr Land, das man ihnen widerrechtlich genommen hat.«
»Aber sie hatten es uns doch vorher abgenommen«, sagte Gabriella, als habe sie es selbst miterlebt.
»Alles eine Frage der Perspektive. Bin Laden hat in seiner Video-Botschaft zu den Anschlägen vom 11. September davon gesprochen. Der Stachel sitzt tief. Die betreffende Passage wurde in vielen Übersetzungen allerdings gar nicht erwähnt.«
»New York, Spanien – Zusammenhang?«, fragte Eduard in holperndem Spanisch.
»Der Zusammenhang? Den kennen wir seit den Anschlägen von Madrid.«
»Und? Was hat dieser Schwachkopf denn nun gesagt?«, fragte Gabriella.
»Er sagte, die ganze Welt solle wissen, dass er und seine Leute es nicht akzeptierten würden, dass sich die Tragödie von Andalusien in Palästina wiederhole.«
Eduard fror. Der Wind war recht kühl geworden. »Du willst Spanien mit Palästina vergleichen?« Er kniff die Augen zusammen, sodass nur noch schmale Schlitze unter den Schlupflidern zu sehen waren.
»Nicht ich! Für Leute wie bin Laden und die Attentäter liegt nichts als Zeit zwischen Spanien und Palästina. Die im 11. Jahrhundert begonnene, massive Verdrängung der Muslime aus Al-Andalus. Sie dauerte Jahrhunderte und ist für sie die Blaupause für das Geschehen in Palästina.«
»Was Du wieder für einen Unsinn weißt! Am Ende wollen die Italiener Mallorca zurück haben, weil es mal römische Provinz war. Und davor war es eine Pirateninsel. Wie jetzt«, sagte Gabriella und lachte kurz auf. »Die Italiener haben die älteren Rechte. Sie haben den Hafen hier angelegt und die ersten Weinberge, für mich persönlich das Wichtigste. Aber ich kann Berlusconi nicht ausstehen. Er versteht nichts von der Wirtschaft. Und er ist auch nur ein Macho wie all die Moros«, fügte sie hinzu, wobei sie ganz selbstverständlich den abfälligen Ausdruck für Mauren benutzte. »Die Welt ist verrückt. Und überhaupt, das Spektakel da unten hat damit nichts zu tun. Es spielt im Mai 1561 und zeigt, wie die mutigen Sollerics ein ganzes Piratenheer verjagt haben.«
»Wenn sie damals schon alle so waren wie Du, musste man sich um die Insel keine Sorgen machen«, sagte Luis lachend. Sein Blick ging zum Himmel, an dem er den Rand einer hellgrauen Wolkendecke über den Bergen entdeckte. Sie kroch in Richtung Hafen. Bis jetzt war der Himmel strahlend blau gewesen. Wäre Winter, hielte er die Wolken für schneebeladen.
»Für einen Bauarbeiter weißt Du viel«, sagte Eduard.
»Das ist keine Frage des Berufs«, entgegnete Luis, der sich daran gewöhnt hatte, dass man über sein Wissen staunte. Es ärgerte ihn immer ein wenig.
»Dein neuer Kollege kennt Dich noch nicht, wie?«, fragte Gabriella, die zwar die französische Frage nicht verstanden hatte, aber ahnte, worum es ging.
»Kollege? Monsieur Ziguré ist kein Kollege. Hat Madame ihn Dir nicht vorgestellt?«
»Meine Tochter redet nicht gerne über Familie«, sagte Eduard. »Sie hat ihren eigenen Kopf. Hatte sie immer.« Er zuckte mit den Achseln. »Gestatten, Eduard Zigure, Vater von Madame.«, sagte er auf Spanisch und verbeugte sich leicht.
»Erfeut, Sie kennenzulernen, sehr erfreut. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Madame überhaupt keine Familie hat. Natürlich ist das unmöglich. Oder dass irgendein schreckliches Unglück alle ihre Verwandten dahingerafft hatte. So etwas gibt es. Eine Feuersbrunst. Eine schlimme Krankheit. Etwas unaussprechlich Fürchterliches. Kein Wunder, dass sie Dich im Schuppen unterbringt. Immerhin scheinst Du für sie nicht wirklich zu existieren.« Gabriella sah Eduard staunend an und fuhr dann fort: »Mach Dir nichts draus! Madame ist verrückt. Trotzdem mag ich sie. Woanders hätte ich keine solche Arbeit bekommen. Ich bin eine überzeugte Zwei-Sterne-Putzfrau. Zu mehr tauge ich nicht.«
Die kleine Gruppe hüllte sich erneut in Schweigen.
Eduard lächelte zufrieden. Er fühlte endlich einen warmen Empfang oder wenigstens eine Verbrüderung Gleichgesinnter, die sich darin einig waren, dass sie die Erde irgendwann so verlassen würden, wie sie gekommen waren, moi tout seul, oder um es mit der unbeholfenen Eindeutschung zu sagen mutterseelenallein, die letztmögliche Steigerung aller Einsamkeit, wie sie nur der Tod mit sich bringt. Dieses und viele andere Worte hatte er in deutscher Kriegsgefangenschaft von einem Wachsoldaten gelernt. Er hatte seither nicht mehr so viele Deutsche auf einem Fleck gesehen wie in den letzten zwei Tagen auf dieser Insel. Vielleicht erinnerte er sich deshalb gerade jetzt an früher.
Doch was ihn viel mehr beschäftigte, war die Gegenwart. Er wollte das Unmögliche: ein gutes Verhältnis zu Eleonore oder wenigstens eines, das ihm irgendwann erlauben würde, seine Enkelin kennenzulernen. Es gehörte zu den Besonderheiten der Beziehung zu seiner Tochter, dass Eduard seine Enkelin noch niemals gesehen hatte. Er wusste, dass es sie gab. Das kalte Herz von Madame erglühte, was ihn betraf, nur vor Wut und immer dann, wenn es darum ging, ihn fernzuhalten. Unzählige Male hatte er sich gefragt, woran es lag, ob er Schuld an ihrem Verhalten haben könnte und was er vielleicht falsch gemacht hatte. Diese Frage hatte er nie beantworten können.
Er leerte seine Flasche und hielt sie fragend hoch. Luis schüttelte den Kopf.