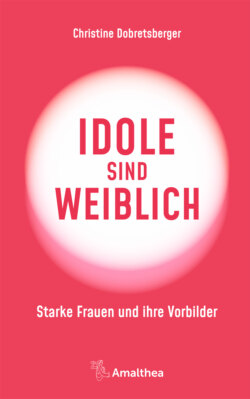Читать книгу Idole sind weiblich - Christine Dobretsberger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Helga Rabl-Stadler »Ich habe kein Talent zur Frustration«
ОглавлениеDie Freude am Tun, an der Realisierung von Zielen und Projekten ist der Motor ihrer Schaffenskraft. Nicht aufzuhören, wenn es am schönsten ist, sondern weiterzumachen. Nicht die Flinte ins Korn zu werfen, wenn sich Probleme auftürmen, sondern sich guten Mutes diesen Herausforderungen zu stellen. Helga Rabl-Stadler kann kämpfen »wie eine Löwin«, wenn sie etwas für richtig und erstrebenswert erkennt, und kalmierend einwirken, wenn es auf zwischenmenschlicher Ebene Wogen zum Glätten gibt. Ihrer starken Persönlichkeit ist es geschuldet, dass sie seit 1995 im Direktorium der Salzburger Festspiele »der Fels in der Brandung« ist, wobei sie speziell in den Anfangsjahren ihrer Präsidentschaft mit heftigem Gegenwind konfrontiert war. Der größte Mutmacher in ihrem Leben war ihr Vater Gerd Bacher. Dank seines motivierenden Zuspruchs »wagte« sie es bereits als junge Frau, tonangebende Positionen anzustreben. Dass es gerade in schwierigen Zeiten gesellschaftspolitisch von großer Bedeutung ist, mit der Kraft von Kunst und Kultur Zeichen zu setzen, zählt ebenso zu ihren innersten Überzeugungen wie ihre positive Grundhaltung, »dass es nie zu spät ist, um glücklich zu sein«.
Ich habe keine Vorbilder und will auch selbst keines sein. Jeder Mensch ist einzigartig. Den Wunsch zu hegen, genauso sein zu wollen wie jemand anderer, finde ich geradezu gefährlich. Er macht sicher nicht glücklich. Aber es gibt Eigenschaften und Verhaltensweisen, die vorgelebt zu bekommen der eigenen Persönlichkeitsentwicklung helfen kann. Ich hatte das große Glück, eine Mutter, einen Stiefvater, einen Vater gehabt zu haben – leider sind alle tot –, die mir durch ihr Verhalten wichtige Leitlinien für mein Leben gegeben haben.
Meine Mutter hat mir zum Beispiel unbegrenzte Belastbarkeit vorgelebt. Bei uns zu Hause wurde das Leistungsprinzip ganz großgeschrieben. Mir wurde vermittelt, wenn man etwas wirklich will, schafft man es. Wie schrieb der Gründer der Salzburger Festspiele Hugo von Hofmannsthal: »Wenn der Wille nur erwacht, ist schon fast etwas erreicht.«
Meine Mutter hat in Salzburg ein Geschäft aufgebaut, das zu einer der ersten Modeadressen Europas wurde. Man wusste in Paris ebenso wie in Düsseldorf oder Rom, wer die Frau Resmann ist. Als Kind kam mir überhaupt nie in den Sinn, dass Familie und Beruf nicht miteinander zu vereinbaren sein könnten. Erst als ich selbst mein erstes Kind hatte, merkte ich, welche Arbeit meine Mutter geleistet hat. Wir hatten eine Haushaltshilfe, aber selbstverständlich gab es trotzdem noch unzählige Dinge, die sie für uns erledigen musste. Die Frage, ob ihre eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kamen, hat sie sich nicht gestellt, weil sie einfach rund um die Uhr gefordert war. Gott sei Dank hatte sie eine gute Kondition, die ich offensichtlich geerbt habe.
MUTMACHER GERD BACHERDer größte Mutmacher in meinem Leben war allerdings mein Vater Gerd Bacher. Ohne ihn hätte ich nie den Mut gehabt, zu allen beruflichen Herausforderungen, die mir reizvoll und interessant erschienen, Ja zu sagen, denn ich bin sehr bescheiden erzogen worden. Dass Gerd Bacher mein leiblicher Vater ist, erfuhr ich erst mit 21 Jahren, aber als wir uns kennenlernten, war das auf beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick. Er hat sich sicherlich in sein Spiegelbild verliebt und ich mich in mein großes Ziel.
Ich hatte eine wunderschöne Kindheit, ein sehr harmonisches Elternhaus und zwei sehr liebe jüngere Geschwister. Mein Bruder Wilfried ist Banker und meine Schwester Susi Architektin in Amerika. Wir drei sind nicht nur verwandt, wir sind auch sehr befreundet. Ich bekam eine tolle seelische Ausstattung von zu Hause mit, aber dass ich beruflich einmal etwas Besonderes werden würde, auf diese Idee wäre ich nie gekommen, weil es von daheim nicht gewünscht war, dass man auffällt oder gar sich vordrängt.
Ich war immer ein auf Vermeidung und Ausgleich von Konflikten gerichteter Mensch. Das bin ich heute noch, und das hat seine Ursprünge wohl ebenfalls in der Kindheit. Sowohl meine Mutter als auch mein Großvater waren ziemlich cholerisch, und es war eher gefragt, ausgleichend einzuwirken. Dann lernte ich meinen Vater kennen, der des Öfteren den Kampf bereits aufgenommen hatte, bevor er notwendig war. Er hat mir bis zum Schluss meine Harmoniesucht vorgeworfen. Noch im hohen Alter sagte er: »Ich weiß nicht, von wem du das hast. Die Rosl war eine Kämpferin, ich bin ein Kämpfer, und du mit deiner Harmoniesucht!« Ich selbst würde mich weder als kampfeslustig noch als harmoniesüchtig bezeichnen. Aber wenn ich etwas als richtig und wichtig erkenne, dann setze ich dieses Vorhaben sehr konsequent durch und kämpfe für diese Sache. »Wie eine Löwin«, stand in den Zeitungen über mich, als ich die Festspiele trotz Corona durchkämpfte. Aber ich bin doch sehr anders als mein Vater, dessen Lebensmotto schon auch war: »Viel Feind, viel Ehr.« Er war auch der Einzige, der mit Kreisky »gerauft« hat.
TRAUMBERUF JOURNALISMUSNach unserem Kennenlernen »prüfte« mich mein Vater ein bisschen ab, nach dem Motto: Was weiß meine Tochter, die in Salzburg aufgewachsen ist und nicht in Wien? Gerd Bacher war ein Riesen-Wien-Fan. Ob ich Edmund Husserl kenne, fragte er mich beispielsweise, und dann diskutierten wir über dessen Buch Ideen zu einer reinen Phänomenologie, das damals diskursbestimmend war. Das gefiel ihm. Es war charakteristisch für ihn, dass er in seinem Umfeld großen Wert auf gebildete Menschen legte. Er sagte immer: »Erstklassige Chefs holen sich erstklassige Leute, zweitklassige holen sich drittklassige Mitarbeiter.« Ein Rat, den ich im Laufe meines Berufslebens immer zu beherzigen versuchte. Denn man muss gefordert sein durch seine unmittelbare Umgebung!
Als ich Anfang der 1970er-Jahre beschloss, Journalistin zu werden, war mein Vater überzeugt davon, dass ich es einmal schaffen würde, Chefredakteurin zu werden. Dank seines motivierenden Zuspruchs fand ich es plötzlich auch »normal«, tonangebende Positionen anzustreben. Diesen Mut und die Leidenschaft für eine Sache hat er mir gegeben. Einer meiner Lieblingssprüche von ihm lautet: »Aufhören, wenn es am schönsten ist, ist spießig. Man muss weitertun, wenn es am schönsten ist!«
Die Journalistik war mein Traumberuf. Allerdings musste ich 1983 der Familie zuliebe nach Salzburg zurück, weil es meiner Mutter gesundheitlich nicht gut ging und sie meine Unterstützung im Geschäft benötigte. Diesen Schritt setzte ich ungern. Weil ich im Journalismus so glücklich war und mich die Mode nicht wirklich interessierte. Und weil ich die richtige Vorahnung hatte, dass die räumliche Trennung, Wien–Salzburg, unserer jungen Ehe, nicht guttun würde. »Braves Kindverhalten« nenne ich dieses Verhaltensmuster aus meiner Kindheit. Ich ging nach Salzburg zurück, um meine Mutter nicht zu kränken. Mein Vater nannte das Harmoniesucht. Zum Glück habe ich die Gabe, mein Interesse und meine Leidenschaft für eine Sache zu wecken, sobald ich mich näher mit ihr befasse. So war es auch mit der Mode und der Kauffrau.
TALENT ZUM GLÜCKLICHSEINDass ich Familie und Karriere unter einen Hut bringen konnte, verdanke ich zwei Frauen: meiner Mutter, denn ohne ihre Unterstützung hätte ich mir, wie meine beiden Söhne klein waren, keine Wirtschafterin leisten können. Dafür reichte damals mein Einkommen nicht aus. Und der wunderbaren Elfriede, die 17 Jahre die kompetente, liebevolle, aber auch selbstbewusste Herrscherin im Haus war. Deshalb will ich auch nicht, dass ich in Sachen Kinder und Karriere als Vorbild für andere Frauen bezeichnet werde, denn mir wurde finanziell geholfen. Ich glaube, vielen Frauen ist heute gar nicht bewusst, welchen Vorteil sie haben, dass Kinderkrippen und Kindertagesstätten nicht nur zur Verfügung stehen, sondern mittlerweile auch gesellschaftlich akzeptiert sind. Wir wären damals öffentlich hingerichtet worden, hätten wir ein eineinhalbjähriges Kind in eine Kita gegeben.
Je älter ich werde, desto mehr Freude bereitet es mir, anderen Frauen Mut zu machen. Den Jungen, aber auch den Älteren. Es ist nie zu spät, um glücklich zu sein. Ich bin sicher auch dahingehend eine Mutmacherin, dass ich vorzeige, Frau kann auch mit 70 noch mitgestalten, muss nicht von der Bildfläche verschwinden.
Das Alter wird meiner Meinung nach völlig falsch diskutiert. »Sexy mit 60« wird vorgegaukelt. Das Leben kann Sinn ergeben, gleich welches Alter ich habe, wenn ich daran arbeite. Natürlich wäre ich immer noch gerne 50, aber es bringt nichts, sich über Unabänderliches Gedanken zu machen. Ich hadere nicht mit dem Älterwerden, ich bin einfach so alt, wie ich bin, und fühle mich wohl in meiner Haut. Das ist etwas, das ich gerne den Frauen vermitteln würde: Versucht euch in eurer Haut wohlzufühlen, nicht zu überlegen, was euch fehlt, sondern wertzuschätzen, was ihr habt. Eine Frau, die nicht berufstätig ist, aber eine tolle Familie hat, kann doch aus tiefstem Herzen sagen: Ich war immer sehr wichtig für die Familie. Das ist mindestens so viel wert, als wäre ich in einer Firma Abteilungsleiterin. Und eine berufstätige Frau, die nicht verheiratet ist und derzeit vielleicht auch keinen Lebensgefährten hat, sollte nicht den Fokus darauf legen, dass sie keine Partnerschaft hat, sondern stolz auf ihre Berufslaufbahn sein und darauf, wie fabelhaft sie allein ihr Leben meistert.
Ich denke, dass ich ein gewisses Talent zum Glücklichsein habe, weil ich mich über das freue, was ich weitergebracht habe und nicht eifersüchtig auf die Erfolge und Leistungen anderer Menschen bin. Ich sehe es allerdings als einen gewissen Fehlschlag an, dass ich es nicht geschafft habe, verheiratet zu bleiben. Das empfinde ich als Niederlage. Ich wollte immer die beste Mutter, die beste Ehefrau, die beste Journalistin sein. Die beste Ehefrau war ich ganz offensichtlich nicht, und daran kann nicht nur derjenige schuld sein, der nicht der beste Ehemann war. Aber davon abgesehen freue ich mich einfach über jene Dinge, die in meinem Leben gut gelaufen sind.
»EHRE, FREUDE, AUSZEICHNUNG!«Auf die Idee, in die Politik zu gehen, brachte mich der damalige Präsident der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft Rudolf Sallinger. Ich erinnere mich noch sehr genau an dieses völlig überraschende Angebot. Es war Muttertag im Jahr 1982, mein Mann und ich waren eingeladen. Plötzlich sagte Sallinger beim Essen ganz unvermittelt: »Helga, möchtest du nicht ins Parlament gehen?«, und ich antwortete mit denselben Worten wie Anneliese Albrecht (SPÖ) bei ihrer Angelobung 1979 als Staatssekretärin in der Regierung Kreisky: »Ehre, Freude, Auszeichnung!«
Sallinger erkannte, dass damals die Zeit reif war für Frauen in der Politik. In der Folge begann für mich die sicher arbeitsreichste Zeit meines Lebens. Im März 1983 organisierte ich im Landestheater zum 60-Jahr-Jubiläum der Firma Resmann eine Modeschau mit 24 internationalen Mannequins, bestritt meinen ersten Nationalratswahlkampf und hatte zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren. Ich weiß rückblickend nicht, wie ich das durchgestanden habe. Wahrscheinlich, weil ich gar keine Zeit hatte, über diese Frage überhaupt nachzudenken. Ja, es war die arbeitsreichste Zeit, aber nicht die härteste, denn ich war getragen von der Zuneigung meiner Familie und der Wertschätzung meiner Umgebung.
PERSÖNLICHE LERNPROZESSEWas für mich der Reiz an der Politik war? Dass man mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten zu tun hat. In der Politik lernte ich am meisten über die Menschen, wobei ich generell immer von jeder meiner beruflichen Stationen viel für die nächste Aufgabe profitiert habe. Ich sehe es als einen Riesenvorteil an, Jus studiert zu haben. Da lernte ich, dass Recht nicht unbedingt Gerechtigkeit ist. Vom Journalismus lernte ich, kurz und prägnant zu formulieren beziehungsweise gründlich zu recherchieren. Audiatur et altera pars – immer auch die andere Seite zu hören. Einer meiner Lehrer war Hugo Portisch. Seinen Ausspruch »Die Wahrheit ist unser Gag« hatte ich eingerahmt auf meinem Schreibtisch stehen. Aus der Modebranche nahm ich wiederum mit, Veränderung nicht als Last, sondern als Chance zu sehen. Denn würde sich in der Mode nicht ständig etwas ändern, würde die ganze Branche stagnieren. Und die Politik brachte viele unterschiedliche Begegnungen mit sich, von der Bäuerin im Lungau bis zum Universitätsprofessor in Wien. Aus diesen Gesprächen lernte ich, was für die Menschen wichtig ist. Als Politikerin bekam ich aber auch die Nachteile für uns Frauen zu spüren. Eine Politikerin, die für eine Nationalratsliste kandidiert, gleich für welche Partei, muss allen Frauen gefallen, der städtischen Unternehmerin ebenso wie der Lehrerin oder der Landwirtin – ein Ding der Unmöglichkeit. Kein Mensch käme auf die Idee, dass der Bauernbundfunktionär gleichzeitig den Arzt oder den Hochschulprofessor repräsentieren muss. Wir Frauen müssen offenbar immer diese eierlegende Wollmilchsau sein.
SALZBURGER FESTSPIELE: HARTE ANFANGSJAHREDie Festspiele lernte ich 1993 als Wirtschaftskammerpräsidentin und Vertreterin des Tourismusförderungsfonds im Kuratorium von innen kennen. Als 1994 ein neuer Präsident gesucht wurde, ermunterte mich mein damaliger Mann, die Politik zu verlassen und die Festspiele zu meiner Lebensaufgabe zu machen. Ich habe tatsächlich alle politischen Funktionen sofort aufgegeben und wurde Präsidentin. Und das erste Mal in meinem Leben fühlte ich starken Gegenwind. Und zwar aus der Politik, wo man meinen Abgang als unverantwortlich abrupt empfand – und aus der Kultur, weil ich keine einschlägige Karriere vorweisen konnte. So wurde mir vorgeworfen, dass ich nicht einmal Klavierspielen könne. In dieser teils sehr kränkenden und sehr öffentlich geführten Debatte trat ein völlig falsches Bild von den Aufgaben des Präsidenten zutage. Doch der Präsident darf keine Konkurrenz zum künstlerischen Leiter sein. Er muss heutzutage Manager sein, Außenminister, Fundraiser.
Ich reagierte kein einziges Mal auf massive Beleidigungen. Nicht einmal als Gerard Mortier in einer großen deutschen Tageszeitung sagte: »Ich habe das Pech, dass ich eine Dirndlverkäuferin aus der Getreidegasse als Präsidentin habe.« Ich glaubte, persönliche Kränkungen zum Wohle der Festspiele ertragen zu müssen. Heute würde ich anders reagieren. Ich würde sicher weibliche Solidarität in Anspruch nehmen und sagen: Helft mir, denn das passiert nur einer Frau, auf diese Art kritisiert, ja herabgesetzt zu werden. Diverse Leute, natürlich alles Männer, die sich bereits als Präsidenten sahen, legten mir nahe, zurückzutreten. Ich sah mich aber auf einem guten Weg. Ich zog erstmals große Sponsoren und Mäzene an Land und baute eine starke Beziehung zum Publikum, insbesondere dem Verein der Freunde der Salzburger Festspiele, auf.
Heute blicke ich auf 25 Jahre Präsidentschaft zurück und kann, wenn ich mit Lob überschüttet werde, nur lachend kommentieren: Ich bin nicht so gut, wie ihr mich jetzt darstellt. Aber ich war auch nie so dumm, wie manche mich damals gemacht haben. Jeder Führungspersönlichkeit, ob männlich oder weiblich, rate ich: Du darfst in der Niederlage nicht den Mut verlieren und im Sieg nicht überheblich werden. Schlechte Zeiten, gute Zeiten, wir müssen beides bewältigen. An der Spitze eines Unternehmens bist du nicht nur für dich, sondern für alle deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.
KUNST DER DIPLOMATIEJohn Naisbitt, der Megatrend-Forscher der 1980er-Jahre, schrieb damals – allerdings ohne allzu großes Echo in der Wirtschaftsrealität –, der Manager der Zukunft müsse weiblich sein: »Just like a woman«, weil wir Frauen flexibler und lernfähiger seien. Ich bin überzeugt, er hat recht. Wir Frauen besitzen die Gabe, heterogene Milieus zusammenzubringen. Das beginnt schon in der Familie. Es ist die Ehefrau und Mutter, die es schafft, am heimischen Mittagstisch den pubertierenden Sohn, die grantelnde Schwiegermutter, den wortlosen Ehemann zusammenzubringen, ohne dass es zu Mord und Totschlag kommt. Für sie ist es geradezu ein Kinderspiel, eine heterogene Gruppe in einem Betrieb zu steuern.
Auch als Festspielpräsidentin war es oft genug gefragt, ausgleichend einzuwirken. Bis heute bin ich sehr froh darüber, dass es mir in der Ära Mortier gelungen ist, das damals sehr angespannte Verhältnis zwischen ihm und den Wiener Philharmonikern zu kitten. Es war so strapaziert, dass es auf der Kippe stand, ob sich die Philharmoniker ganz aus Salzburg zurückziehen und in Wien im Sommer ein eigenes Festival ins Leben rufen. Letztlich konnte ich die Philharmoniker mit dem Argument überzeugen, dass es ohne sie zwar Festspiele in Salzburg gäbe, aber dies sicher nicht die weltberühmten Salzburger Festspiele wären. Dass sie unser künstlerisches Herz sind, die Festspiele aber auch ein Teil ihrer Identität.
KRAFT VON KUNST UND KULTURDie Grundidee der Festspiele – Kunst als Friedensbringer – wieder in den Vordergrund zu rücken, war und ist mir in dem Vierteljahrhundert meiner Präsidentschaft ein besonderes Anliegen. Diese gesellschaftspolitische Mission wurde in den vorangegangenen Jahrzehnten zu wenig thematisiert. Die Salzburger Festspiele wurden nach dem Ersten Weltkrieg »als eines der ersten Friedensprojekte« (O-Ton Max Reinhardt) gegründet. Aber auch um Österreich, das vom Europa umspannenden Habsburgerreich »zum vergleichsweise winzigen Rest geschrumpft war«, wieder ein Selbstverständnis, eine Identität zu geben. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann eine der ersten Taten von US-General Mark Clark, US-Hochkommissar für Österreich von 1945 bis 1947, bereits für August 1945 wieder Festspiele in Salzburg einzufordern, obwohl die Stadt noch in Schutt und Asche lag. Es sollte ein »Beweis dafür sein, dass die gemeinsame Arbeit der österreichischen Bevölkerung und der Vereinten Nationen ein freies, unabhängiges Österreich wiederherstellen wird.«
Diese historische Komponente finde ich großartig und bedauere es, dass unser 100-Jahr-Jubiläum 2020 aufgrund der Corona-Krise nicht so stattfinden konnte, wie wir es ursprünglich geplant hatten. Umso wichtiger war es mir, mit den modifizierten Festspielen ein Zeichen für die Kraft der Kunst in schweren Zeiten zu setzen. Man kann nicht oft genug betonen: Nicht nur Handel, Tourismus oder Gastronomie sind systemrelevant, Kunst und Kultur sind das ebenfalls! Kunstschaffende werfen mit ihren Werken Fragen auf, regen die Menschen zum Nachdenken an, was ich gerade in unserer schnelllebigen Zeit so wichtig finde. Ich war ein großer Fan von Nikolaus Harnoncourt, der den schönen Satz sagte: »Wenn wir Künstler gut sind, dann gehen die Menschen anders aus einer Aufführung hinaus, als sie hineingegangen sind.«
VON MOZART BIS NONOMozart ist mein Lieblingskomponist. Seine Musik spiegelt alle menschlichen Regungen und Seelenzustände wider: Liebe und Eifersucht, Rachsucht und Vergebung, Freude und Unglück. Ich höre fast nur klassische Musik, wobei ich es mit Leonard Bernstein halte. Der wollte den Graben zwischen U-Musik und E-Musik zuschütten, denn es gibt nur gute und schlechte Musik. Mir gefällt auch die neue Form des Wienerliedes, wie sie Ernst Molden erdichtet und komponiert. Oder die herrlichen Chansons meines Freundes André Heller. Und auch bei der Musik gilt, was ich zuvor schon betonte: Je mehr ich mich mit etwas beschäftige, desto besser gefällt es mir. Markus Hinterhäuser hat mir die Ohren für Luigi Nono, für Sofia Gubaidulina und für Galina Ustwolskaja geöffnet.
MAX REINHARDT: »… DASS ES ZUMINDEST EBENSO VIEL BEDEUTET, KÜNSTLERISCHE DINGE ZU VERWIRKLICHEN, WIE SIE ZU ERSINNEN«Ich war sehr gerührt, als ich den Brief von Max Reinhardt an Franz Rehrl, Landeshauptmann von Salzburg von 1922 bis 1938, in Händen hielt. Rehrl verdankt die Festspielhausgemeinde ihr Überleben, weil er das ökonomische Potenzial einer großen Kulturveranstaltung für Stadt und Land Salzburg erkannt und Pionierarbeit in Sachen Finanzierung geleistet hat. Rehrl war es auch, der in einer sehr antisemitisch geprägten Zeit den Platz vor dem Festspielhaus Max-Reinhardt-Platz nannte, obwohl er dafür als christlich-sozialer Politiker keine Lorbeeren erntete. Dies wusste Max Reinhardt zu würdigen, ließ für Rehrl, den »Schutzpatron der Festspiele«, eine Büste anfertigen und schrieb, »dass es zumindest ebenso viel bedeutet, künstlerische Dinge zu verwirklichen, wie sie zu ersinnen«. Ich würde mir nie anmaßen, das zu sagen, aber letztlich ist es meine Aufgabe, in finanzieller Hinsicht dafür zu sorgen, dass der Intendant möglichst viele seiner ersonnenen künstlerischen Ideen realisieren kann.
MUTIGSTE ENTSCHEIDUNGDas Haus für Mozart bauen zu lassen, war sicher meine mutigste Entscheidung. Die allgemeine Meinung lautete damals, das wäre zu kostspielig. Aber hätte ich 2003 dieses Bauprojekt nicht durchgesetzt, wären wir heute in einer verheerenden Situation. Dieses Vorhaben war sehr schwer zu erkämpfen und gleichzeitig einer meiner größten Sponsoring-Erfolge. Von den Gesamtkosten von über 36 Millionen Euro brachten die Festspiele 40 Prozent selbst auf, was für einen Kulturbetrieb eine enorme Summe ist.
KEIN TALENT ZUR FRUSTRATIONMein Erfolgsgeheimnis? Ich habe kein Talent zur Frustration: probieren, probieren und wieder probieren! Wie sagte mein Vater immer? »Sei dir klar, du bist ein Kind des Glücks, dass du das machen darfst.« Genau so empfinde ich das. Ich bin dem Schicksal sehr dankbar, dass ich diese einzigartige Aufgabe und das außerordentliche Team des Festspielhauses habe. Natürlich muss ich viele Probleme bewältigen. Die Kraft dazu gibt mir die feste Überzeugung, dass die Salzburger Festspiele künstlerisch, gesellschaftlich und politisch wichtiger denn je sind. Hugo von Hofmannsthal schrieb: »Unser Salzburger Festspielhaus soll ein Symbol sein. Es ist keine Theatergründung, nicht das Projekt einiger träumerischer Phantasten und nicht die lokale Angelegenheit einer Provinzstadt. Es ist eine Angelegenheit der europäischen Kultur und von eminenter politischer, wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung.«
EWIGER TATENDRANGEs gibt eine weitere Parallele zu meinem Vater: diese Freude am Tun, diese Freude, mit guten Leuten zusammenzuarbeiten, diese Freude, wenn mir selbst oder anderen etwas gelingt. Ich bin nicht deshalb erfolgreich, weil ich so eine Streberin bin, sondern ich habe Erfolg, weil ich andere zum Denken und Tun begeistern kann. Deshalb war es für meinen Vater auch schwierig, in Pension zu gehen. Er war unglücklich, dass er nicht mehr gestalten konnte. Ich fürchte, dass mir die Begabung für den Ruhestand ebenfalls fehlt. Wir sind Menschen der Tat. Ich will etwas verwirklichen! Mein Vater hat acht Stunden am Tag gelesen, und natürlich kann man täglich acht Stunden lesen, aber er und ich wollen auch einen Nutzen für die Gesellschaft aus unserem Tun ziehen. Wenn nur ich davon profitiere, ist mir das zu wenig.
Trotzdem bin ich fest entschlossen, am 31. Dezember 2021 in Pension zu gehen. Selbst wenn der Tatendrang nach wie vor da ist, kann und darf ich in dieser Intensität nicht ewig weiterarbeiten. Seit ich Präsidentin bin, hatte ich sehr wenig Urlaub, aber das war kein Problem, weil ich einfach so gerne für die Salzburger Festspiele arbeite. Deshalb habe ich mich so rasend darüber gefreut, als ich 2018 Ehrenbürgerin von Salzburg wurde! Wie hat Hans Weigel einmal geschrieben? »Wer Salzburg kennt, mit dem werden es andere Städte schwer haben.« Salzburg ist meine Heimat – auch diesbezüglich bin ich ein Kind des Glücks.