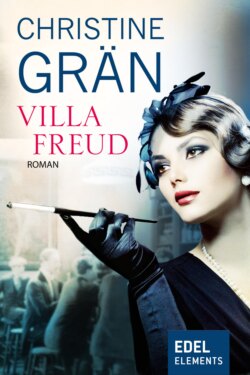Читать книгу Villa Freud - Christine Grän - Страница 7
3
ОглавлениеIch konnte nicht anders. Rita hat diesen Satz nie verstanden. Die Schläger, Vergewaltiger, Kinderschänder, Folterer, Mörder und Wegseher ... sie alle konnten nicht anders? Welche Form der Absolution soll das sein? Der Himmel für alle, die sich in die Hölle der Willenlosigkeit begeben haben? Ein bequemer Platz zum Ausruhen von dem, was fordert und dazu drängt, dem Leben eine Richtung zu geben, die einem zeigt, wer man ist?
Ein Ball, der auf die Straße rollt, kann nicht anders. Die ihm hinterherlaufen, schon. In Ritas Sicht der Welt ist der Wille eine absolute Größe. Sie ist frei. Abgesehen davon, dass sie minderjährig, geldlos und einer Familie ausgeliefert ist, in der jeder versucht, dem anderen seinen Willen aufzuzwingen.
»Ich kann nicht anders«, sagt Anna, und auch aus ihrem Mund klingt der Satz verdächtig. Anna hat sich für diese Wendung und einen Mann entschieden, der als Geburtstagsüberraschung in die Familie eingeführt wird. Ihr Geschenk an Hanna, die so fest daran geglaubt hat, dass ihre älteste Tochter die Familie nie verlassen, sie sozusagen weiterführen wird. Hanna fühlt sich betrogen, und ihre stille Wut senkt sich wie ein bleierner Vorhang über die Tischgesellschaft.
Anna liebt Justus. Also glaubt sie, nicht anders zu können. Er ist vierundsiebzig und ein Bewohner des Seniorenheims, in dem sie arbeitet. Als Geschenk betrachtet ist der Mann ein trojanisches Pferd, das Hanna als Kriegserklärung deutet. Über die Geburtstagstorte hinweg, die aus Lagen von Blätterteig, Schokolade und Himbeeren, Rum und Mascarpone aufgetürmt ist, versucht sie ihre Tochter davon zu überzeugen, dass man in der Liebe irren kann.
»Ich weiß«, erwidert Anna.
Woher wohl? Rita verfolgt den Weg des Tortenstücks vom Teller bis in Annas Mund. Er ist groß und üppig wie alles an ihr. Ungeschminkt, denn Lippenstift würde den Geschmack beeinträchtigen. Anna lässt jeden Bissen im Mund zergehen, bevor sie ihn langsam schluckt. Sie erscheint unbeteiligt an dem Sturm, den sie entfachte, obwohl sie den Eindruck erweckt, aufmerksam zuzuhören.
Gregor spricht von Fortpflanzung, dem natürlichen Kreislauf des Lebens, und während er Argumente formt, fragt er sich, ob die Endungen auf a wirklich eine so glückliche Entscheidung waren. Hanna bestand darauf, sie ist abergläubisch wie ihre irische Großmutter, die mit fünfundneunzig Jahren starb und sieben Kinder und neunzehn Enkel hinterließ. Sie hieß Elsa, und all ihre Töchter und Söhne waren unehelich, doch dieses Detail änderte nichts an Hannas Glauben, dass die Erfüllung im Buchstaben A zu finden sei. Jehova, Buddha, Allah ... was nützt es, sie anzurufen, wenn Anna eine Wahl getroffen hat? Wie ein Fels sitzt sie da, und nichts an ihr ist weich bis auf das Fleisch, das sie einem Mann offenbart, der sein Vater sein könnte.
Hanna erklärt mit ihrer demütigsten Stimme, dass sie sich nichts sehnlicher wünsche als Enkelkinder.
Laura fühlt sich schuldig. Sie betrachtet ihre gepflegten Finger, die Babys liebkosen sollten und statt dessen Brot über die Theke schieben. Sieht Rita an, die wie immer ein wenig abwesend erscheint, eine fehlbesetzte Walküre im Feuerkreis ihres Ehrgeizes. Biologisch und praktisch gesehen, wäre nun wirklich Anna an der Reihe. Hat man je ein so gebärfreudiges Becken gesehen?
Doch Justus kann kein Irrtum sein, denn Anna hält an ihm fest wie am letzten Rettungsring ihres Lebens. Sie wird ihn heiraten, das Datum steht bereits fest. »Wir haben schließlich keine Zeit zu verlieren«, sagt sie, und Rita denkt, das haben wir nie, weil es einen Anfang und ein Ende gibt, und dazwischen eine begrenzte Wirklichkeit.
Hanna weint niemals. Sie wird steinern, und nichts fürchtet Gregor so sehr wie diesen Ausdruck ihres Gesichts. »Charlie Chaplin hat mit achtzig noch ein Kind gezeugt.« Diese, seine Kapitulationserklärung, quittiert Hanna mit einem Senken der Mundwinkel, doch Anna nimmt das Stichwort dankbar auf.
»Wenn ihr es wirklich wissen wollt: Wir haben wunderbaren Sex. Justus ist nicht alt. Er sieht nur so aus. Dieser Mann hat die Seele eines Zwanzigjährigen. Im Übrigen dachte ich immer, dass wir eine besondere Familie seien.«
Sie sieht herausfordernd von einem zum anderen, bevor sie sich ein zweites Stück von der Torte abschneidet und behutsam auf ihren Teller bugsiert. Sie ist eine Fundamentalistin der Sinne: Essen und Sex als wundersame Berührungen des Körpers. Die Alten brauchen so viel Zärtlichkeit, es ist, als hätten sie in ihrem Leben nie genug davon bekommen. Und sie kann sie ihnen geben, und besonders einem, den sie mehr liebt als die anderen. Weil sie weiß, dass Geld nicht wichtig ist, aber zählt, fügt sie hinzu, dass sie die Familie weiterhin unterstützen werde, denn Justus’ Beamtenpension werde für zwei reichen.
Buddha sei Dank. Rita seufzt nach innen, denn Annas Glück oder Unglück zählt nichts im Verhältnis zu ihrer Angst, dass die Gesangstunden ausfallen könnten. Und dies zu einem Zeitpunkt, an dem sie mithilfe ihrer Musiklehrerin jemanden gefunden hat, der sie in Wagners Welt bringen wird. Ritas Herzenssache. Der Mensch, an den sie glaubt, den sie fürchtet, anbetet, liebt, hasst...
Die Ängste sind groß, und sie führen immer zur Quelle des gehätschelten und gehassten Ichs. Rita kann in Gregors Haltung die Furcht vor Hannas Zorn erkennen, denn wie ein Junkie ist er süchtig nach Harmonie, dem schönen Klang der Eintracht. Hanna fürchtet um ihr Gesamtkunstwerk, das vollkommenste all ihrer Gerichte: der von ihr erschaffene Eintopf aus Menschenfleisch. Anna hat Angst vor ihrer Entscheidung, der Veränderung von Lebensumständen, und wer wird sie so vollkommen füttern, wenn sie auszieht?
Lauras Gesicht trägt Spuren von Neid. Sie ist jünger und hübscher und auf dem Kriegspfad, seit sie denken kann. Aber die Helden, die sich ihrem Anriff in Form eines Eherings ergeben könnten, leben anderswo.
Ein Minimum an Aufrichtigkeit, und sie alle würden einander in die Arme fallen – oder aufstehen und getrennte Wege gehen. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, denkt Rita, mindestens, aber die Grundlage wäre die Analyse der Wirklichkeit, in der man sich und die anderen ohne Angst oder Kalkül definiert und daraus eine Entscheidung formt. Das Risiko, dass sie falsch sein könnte, wiegt geringer als die dritte Wahl: die Umgehung aller Möglichkeiten bis hin zur Selbstauflösung.
Rita hat fast achtzehn Jahre gelebt und glaubt an die Summe ihrer begrenzten Erfahrungen: Die Substanz ist Angst, und niemand kann sie dir nehmen. Die Furchtlosen sind Mörder oder Märtyrer. Wie der Junge aus ihrer Schule, der sich weigerte, Crack zu nehmen, und aus dem zweiten Stock sprang, als sie ihn einen Feigling nannten. Jetzt ist er ein Verrückter, der humpelt, während Rita vorgab, das Zeug zu schlucken, in ihrer Mundhöhle speicherte und unauffällig ausspuckte.
Schauspielen gehört zum Leben und zur Kunst. Die Stimme allein genügt nicht, man hat es ihr oft genug gesagt. Opernsänger müssen Schauspieler, Leistungssportler und Techniker ihrer Stimme sein, sie müssen fechten – und sterben können, und alles ist hundertmal geprobt und doch ein Spiel des Zufalls.
Hanna ist nach Ritas Einschätzung eine furchtlose und begabte Selbstdarstellerin. Nun nimmt sie zu aller Überraschung ihre älteste Tochter in den Arm. Sie wird eine Hochzeitstorte kreieren, die alles übertrifft, was in diesem Viertel je gebacken wurde. Das Glück ist klein und wird schneller geschluckt, als man es vorbereiten kann.
Hanna hat es immer gewusst und ihre Entscheidungen daran gemessen, das hat sie stark gemacht.
Gregor wird nie zu fragen wagen, was Anna unter perfektem Sex versteht, obwohl das Thema ihn häufig bewegt. Vielleicht, er zieht es in Erwägung, ist es nicht der Tod, sondern das Leben, das Hanna bewogen hat, sich ihm in kleinen Dosierungen zu entziehen. Hannas vollkommener Rücken, ihm zugewandt, wenn er sich die Zähne geputzt hat und zu ihr ins Bett kommt. Die Linie ihres Halses, schöner als jeder andere Teil ihres Körpers, der nur aus Rundungen und Buchten besteht, eine Landschaft von vollendeter Sinnlichkeit. Nie wird er aufhören, sie mit jenem Schmerz zu begehren, den Hanna seine »gregorianische Hörigkeit« nennt. Sein Knoblauchduft, der sie stört. Mein Gott, sie verwendet dieses Gewürz in fast allen Gerichten. Mehr als früher? Oder hat sie früher darüber hinweggerochen? Auch dieser Frage wäre nachzugehen, wenn Gregor es nicht vorziehen würde, sich in Geduld zu flüchten.
Laura wird Anna fragen, ob Justus »ein Kunststück« kann? Eher aus oberflächlicher Neugierde als aus Wissensdurst, denn über Sex weiß sie Bescheid. Sie liest Frauenzeitschriften. Sex ist das, was Männer wollen und Frauen ihnen geben, weil sie Männer wollen. Mehr ist im Grunde nicht daran, aber es ist trotzdem sehr kompliziert. Weshalb so viel darüber geredet, geschrieben und gesendet wird, aber, und das ist Lauras Überzeugung, was all diesen Geschichten fehlt, ist die wahre Liebe, an die sie glaubt, für die sie ausgezogen ist in eine fremde und gefrorene Welt. Alles, was jenseits ihrer Straße, ihres Viertels liegt, erscheint ihr abweisend und Furcht einflößend. Junge Männer, die wie Schläger aussehen. Verkäuferinnen von schönen Kleidern, die ihre Nase rümpfen, weil Laura nach Brot riecht, nicht nach teurem Parfum. Mit dem zaghaften Mut der Verzweiflung versucht sie, sich die Welt jenseits ihrer Bedingungen zu erobern. Der Ehemann hat sich gerühmt, sie in sein soziales Milieu erhoben zu haben. Der Preis war zu hoch. Aber nein, sie will nicht glauben, dass in dieser Straße aller Anfang zum Ende führen wird. Es gibt ein Leben vor dem Tod, und sie weiß genau, wie es aussehen soll: ein netter Mann, ein hübsches Haus, reizende Kinder. Rita würde sagen, dass Lauras Problem in den Adjektiven liegt.
»Die Stimme«, so nennt sie ihre jüngere Schwester, und tatsächlich scheint sich dieses Wesen freiwillig darauf zu reduzieren. Rita mit ihren selbstgefärbten weißblonden Haaren, die sie streichholzkurz trägt, und diesem winzigen Körper, der nur aus Haut und Knochen zu bestehen scheint. Seit sie Gesangstunden nimmt, joggt sie morgens und abends eine Stunde und trainiert mit Hanteln. Sie wird achtzehn und läuft in Jeans und schlampigen Hemden auf einer Spur neben dem Leben. Sie wird scheitern, davon ist Laura überzeugt. Nein, sie möchte es sogar. Weil niemand, den sie liebt, sich über sie erheben soll.
Rita wird Anna nicht fragen, was den besonderen erotischen Reiz eines Vierundsiebzigjährigen ausmacht. Sex in seiner beliebigen Verfügbarkeit interessiert sie nicht sonderlich. Jeder kann es, tut es, und danach fühlt sich jeder irgendwie betrogen. Vielleicht muss sie so alt werden wie Anna oder Hanna, um über die Frage des »Wen kann ich kriegen?« auf das »Wie schön kann es sein?« zu kommen.
Wahr ist natürlich auch, dass Rita kein Objekt der Begierde ist, in Lauras Worten »ganz und gar nicht sexy«. Es gäbe die umnachteten Gebete schräger Typen zu erhören, doch kein Siegfried ist darunter. Romantisch? Vielleicht. Wer in Opern lebt, fühlt sich auf der Bühne der Wirklichkeit immer enttäuscht. Sex ist von Sphärenklängen weit entfernt. Sie hat alle Hoffnung und Furcht auf einen Punkt konzentriert: die Stimme. »Wenn du es wirklich willst, wirst du es schaffen«, das ist Hannas Gebet, nicht überzeugend, aber von Liebe getragen. Wenn sie diesen Satz sagt, dann glaubt Rita daran. Gott hat gesprochen, und wer, wenn nicht ihre Gesangslehrerin wäre die Instanz, in die alles Vertrauen, aller Glaube, alle Zuversicht fließt?
»Ich mache eine Wagner-Sängerin aus dir.«
Rita wird nie vergessen, wie sie ihr die Tür öffnete, beim ersten Mal, und sagte: »Ich war Astrid Stemm.«
Die Frau, die war, ist ein monumentaler Schatten ihrer Vergangenheit. Die Wände der Altbauwohnung im Hochparterre sind dekoriert mit Fotos. Opernszenen, in Hochglanzpapier gepresst, stumme Zeugen dessen, was war, und dies ist wohl der einzige Trost der Gegenwart, der ruhmlosen Einsamkeit, der Angst vor dem Tod, den sie einst so dramatisch und hinreißend interpretierte.
Mit den heutigen Produktionen steht Astrid Stemm überwiegend auf Kriegsfuß. Die Oper, das wiederholt sie oft, verkomme zum Actionfilm mit Gesangseinlagen. »Modern« ist ein Wort, das sie aus tiefstem Primadonnenherzen verabscheut. Astrid Stemm hat vierzig Jahre auf Opernbühnen gestanden, zunächst im Chor, dann in kleineren Rollen in unbedeutenden Städten, um schließlich in Bayreuth zu singen: die Elisabeth, die Ortrud ... doch nie, niemals die Brünnhilde oder Isolde.
Mild und leise, wie er lächelt, wie das Auge hold er öffnet – seht ihr’s, Freunde? Isolde, die nicht begreift, dass Tristan tot ist. Astrid, die ihre Augen davor verschließt, dass sie den Sprung in den dramatischen Sopran nicht geschafft hat. Es waren die Umstände, die Agenten, Intendanten, Dirigenten, Regisseure, die ihrer Stimme und Karriere das Letzte versagt haben. Also ist sie nicht gescheitert, sondern als tragische Figur in die Operngeschichte eingegangen. Man singt nur, nicht wahr? Schreibt das Libretto nicht selbst.
Die große Stemm hat immer aus zwei Stimmbändern und einem diese umgebenden Körper bestanden. Er alterte schneller als ihre Stimme. Bühnenschminke ruiniert die Haut und der Lockenstab die Haare. Sie trägt eine Perücke aus weißen Wellen, die bläulich schimmern. Dickes Make-up, das die Falten zementiert. Und wenn sie singt mit dieser Stimme, die nicht an Kraft, nur an Schmelz verloren hat, wirkt sie wie ein junges Mädchen, das sich als alte Frau verkleidet hat. Unter ihrem Namensschild, weiß mit Goldprägung, steht »Kammersängerin«. Sie war Astrid Stemm.
Rita arbeitet, um Astrids Gagen zu bezahlen. Sie trägt morgens Zeitungen aus und deklariert dies als »Jobjoggen«. Sie bedient mittags in der Kantine der Wurstfabrik, wenn die Arbeiter das, was sie in Achtstundenschichten produzieren, als Form der Mahlzeit einnehmen, die Hanna als »Fraß« bezeichnen würde. In der Fabrik riecht es nach Blut und Schweiß, und Rita duscht ausgiebig, bevor sie mit der Bahn zur Stemm fährt, zu den zwei Stunden des Tages, für die sie die restlichen zweiundzwanzig erträgt.
Am Wochenende hilft Rita in der »Weißen Taube« aus, der Gastwirtschaft neben der Bäckerei. Der Wirt hält Rita für eine miserable Kellnerin, die weder durch Aussehen noch Charme zum Verzehr von Speisen und Getränken animiert. Doch sie ist willig, billig und deutsch. Grundsätzlich hat er nichts gegen Ausländer, nur kann er sich Illegale ausschließlich in der Küche leisten, in dieser Unsichtbarkeit, in der sie sich wohl zu fühlen scheinen.
Dass Rita ihn betrügt, so gut sie kann, liegt außerhalb seines Wissens. Es gibt kein System, das nicht zu unterwandern wäre, und Kellnerinnen, die schlecht bezahlt werden und wenig Trinkgeld bekommen, neigen zum Anarchismus. Rita »vergisst« manchmal einige Positionen in die Kasse einzugeben, weil die wenigsten Leute eine Rechnung verlangen oder diese kontrollieren. Sie verrechnet sich leicht und stets zu ihren Gunsten. Psychologie für Anfänger: Nach ein paar Wochenenden hat sie die Gäste zu unterscheiden gelernt nach Opfern, Trunkenbolden und peniblen Idioten. Wozu hat sie Abitur gemacht?
Um zu studieren, sagt Gregor. Er missbilligt ihren Broterwerb, ohne dessen Abgründe zu kennen. Wenn schon Gesang, dann solle sie sich an einer Hochschule bewerben. Dies sei kein Leben für eine Achtzehnjährige, sagt Gregor, und sie erwidert, dass er nicht der brennende Dornbusch sei.
Sie lebt. Sie atmet, um zu singen. Chi sa respirare, sa cantare. Der Atem muss funktionieren wie der Bogen eines Streichinstruments. Die Stemm foltert Rita mit Atemübungen. Sie lässt sie an der Wand stehen und Fersen, Gesäß, Schultern und Kopf gegen die Mauer pressen. Rita ruft »ksst« oder »hoi«, wieder und wieder, und fühlt die Kontraktion der Bauchdecke. Man atmet über Bauch und Zwerchfell oder Brust und Rippen. Die Kapazität der Lungen muss erweitert werden, um der Stimme Kraft und Ausdauer zu geben.
Rita liegt auf dem Boden und hebt auf Befehl die Beine. Dabei darf kein Geräusch im Hals entstehen. Die »fu«-Übung verbessert das Ausatmen. Das F ist ein Atemverzehrer. Wer nicht richtig aus- oder einatmet, stirbt als Sänger einen schnellen Tod. Die Stemm knabbert an Hannas Pralinen und wiederholt ihren Lieblingssatz: »Das Zwerchfell oben halten, den Atem oben, alles schön oben ... der Brustkorb erweitert sich wie ein Blasebalg, und dann Buuum! Die Luft geht nach oben und Wuuu...! Die Luftsäule befindet sich schon im Gesicht.«
Rita will Wagner singen und stößt Geräusche aus wie ein Baby, das sprechen lernt, während die Stemm sie unterbricht, ermahnt, beschimpft und bisweilen in theatralischer Stimmlage verkündet, dass sie ihre kostbare Zeit an einen hoffnungslosen Fall verschwende.
Manchmal weint Rita nach innen, und einmal stieß sie aus Verzweiflung einen Schrei aus, der im Bereich des hohen C angesiedelt war und den Kristalllüster zum Klirren brachte. Doch sie ist zäh, vielleicht ein Erbe Hannas, die nie ein Gericht verloren gibt und geplatzte Zwetschgenknödel in einen Zwetschgenauflauf verwandelt, mit Butterbröseln, Zimt und Zucker.
Der Folterkeller ist mit dem Steinway, einem roten Sofa, dem Pralinentisch und Fotos an den Wänden dekoriert. Er riecht nach Schweiß und süßem Parfum. Astrid Stemm zieht verbrauchte Luft jedem kalten Hauch vor, der einer Stimme schaden könnte. Rita kennt die Geschichte von jener Grippe, die La Donna daran hinderte, die Gilda mit dem hohen Es in Zürich zu singen. Fünf Wochen Heiserkeit und die Inszenierung eines Selbstmordversuchs, der sie in die Schlagzeilen brachte. Wer interessiert sich für erkältete Sängerinnen?
»Es nützt nichts, eine Stimmbesitzerin zu sein«, sägt die Stemm. »Du brauchst Ausstrahlung, Stehvermögen, Schauspielkunst, Schönheit, einen guten Agenten... und Glück.«
»Was ist Glück?«, fragt Rita.
»Das, was ich letztlich nicht hatte.«
Obwohl ihre Stimme besser gewesen sei als die der Nilsson, Olivero, Rysanek, Ludwig, Mödl, Varnay. Die Callas konnte sowieso nicht singen. »Sie hatte Essig in der Stimme«, sagt die Stemm mit jenem Anspruch auf Unfehlbarkeit, die sie dem Papst abspricht. Die Callas habe stets versucht, aus Rolle und Stimme das Letzte herauszuholen, und weil das nicht gelingen konnte, habe sie ihre Stimmbänder verbrannt, und zwar an beiden Enden.
Rita weint, wenn sie die Callas als Margherita hört, im dritten Akt von Boitos Mefistofele. Sie ist Margareta, sie hat nur den Namen geändert, und sie fühlt diesen Schmerz. Die Kerkerszene, in der alle Kälte, Verlassenheit und Tod in der Stimme eingefangen sind. Sie liebt die Callas, doch sie widerspricht ihrer Lehrerin selten. Astrid Stemm ist eine Diva und duldet keine abweichenden Meinungen. Sie wird wütend, stößt spitze Triller aus, schweigt danach, nur ihr Gesicht verrät eine ungeheure Wut, und Rita bereut – oh, wie sie bereut! –, eine Meinung zu haben und sie gegen das Dogma einer Göttlichen gesetzt zu haben.
Wer unsere Träume stiehlt, gibt uns den Tod. Sie stirbt oft, es sind kleine Tode, und steht wieder auf und kämpft. Wenn du ein Ziel hast, musst du Härte üben, vor allem gegen dich selbst. Kannst der Spieler deines Lebens sein oder der Spielball, rollen wie die anderen, so rund und nachgiebig, ganz leicht und von einer Resignation getragen, die das Leben, wie es sein sollte, verloren gibt.
Hanna fragt sie: »Weißt du, was du tust?« Hanna hat immer gute Fragen gestellt, aber den Antworten selten geglaubt.
»Ich weiß es nicht, aber ich muss es tun.« Diese Auskunft liegt sehr nahe an dem Satz »Ich konnte nicht anders«, den sie so unverständlich findet. Die entscheidende Nuance ist, dass sie die Sklavin ihres Willens ist. Sie muss arbeiten, sparen, Gregors Missbilligung und Astrids Launen ertragen, weil sie singen will... Wagner, ausgerechnet Wagner. Die Diva sagt, es sei leichter, in Bayreuth zu singen, weil die Akustik besser sei als in jedem anderen Opernhaus. Nur sei das Schwerste, dorthin zu gelangen.
Rita ist das Kind, das von seiner ehrgeizigen Ersatzmutter nicht geliebt wird. Hässlich und ohne die gefälligen Rundungen guter Erziehung, die Haushunde von Wölfen unterscheidet. So hungrig, sie weckt Erinnerungen an die Astrid, die einmal war. Und irgendwann weißt du, dass es die vollkommene Sättigung nicht gibt. Zu viele Wölfe. Man muss zusehen, dass man genug abbekommt. Und es ist nie genug. Das Kind quält sich. Sie quält es, nicht weil es ihr Freude machte, o nein. Wagner-Interpretinnen müssen durch die Hölle gegangen sein, um das singen zu können...
...und dann gibt es zwei Vorhänge, und du gehst nach Hause in ein schäbiges Hotelzimmer, zu Fuß, um Geld zu sparen. Das könnte sie ihr sagen, und dass sie zu jung ist, die Stimme nicht tragend genug, und andererseits hat dieses seltsame Wesen die Qualitäten eines Marathonläufers... man wird sehen. Jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Außer man wird krank oder Opernsängerin.
Das grausame Urteil, die Einstufung als »Soubrette«, geschah aus ein wenig Wahrheitsliebe, schlechter Laune und ganz ordinärem Sadismus. Rita war unkonzentriert, müde, der ewigen Übungen leid. Draußen war ein schöner Frühlingstag, und die stickige Luft, getränkt von süßem Parfum, nahm ihr den Atem. Sie hasste die Dicke, die Hannas Pralinen in den Mund stopfte, sie ständig kritisierte, lächerliche Liedchen einübte und das Klavier bearbeitete, als wolle sie Ritas Stimme mit Orchesterklängen niedermachen. Da brach Rita Händels Chìo mai vi possa ab und sagte: »Ich mache dieses lächerliche Theater nicht mehr mit. Sie bringen mich noch dazu, dass ich das Singen hasse.«
Astrid war nicht überrascht, eher belustigt. So überlegen. Als ob sie nicht auf das Geld angewiesen wäre, das ihr Ritas Stunden brachte. Als ob Karajan, Böhm und Wagner ihr zu Füßen gelegen hätten. Sie war Astrid Stemm, und diese Welt schloss alles andere aus, Vernunft, Selbstmitleid, Mitgefühl, Liebe zu Wesen, die real existierten und nicht für die Bühne erfunden wurden. Die Stemm trillerte und trauerte der überirdischen Weichheit ihrer Stimme nach. Sagte: »Wie du willst. Es ist deine Zukunft. Mehr als die Adele oder Despina wirst du ohnehin niemals singen. Wenn’s hoch kommt.«
Rita brach in Tränen aus. Weinen ist schlecht für die Stimmbänder, wusste sie das nicht? Nachdem die Tragödie ihren Höhepunkt erreicht hatte, schien Astrid besänftigt. Sie tätschelte mit ringgeschmückten Fingern eine nasse Wange: »Wir arbeiten daran und entwickeln dich bis ins dramatische Fach. Du musst mir vertrauen, Kindchen, vollkommen vertrauen. Wir schaffen das schon.«
Hoffnung ist die Droge, die Rita braucht, um zu überleben. Astrid ist der Dealer. Und sie küsst ihre Hand und unterwirft sich den Gesetzen der Abhängigkeit. Beiße nie in die Hand, die dich mit Hoffnung futtert. »Du bist dieser grotesken Frau hörig«, sagt Gregor, doch sie stellt sich taub, wenn er davon spricht. Rita hört sich nicht selbst singen, sie beurteilt ihre Stimme an Astrids Reaktionen. Sie liest aus ihrer Mimik, noch bevor sie Kritik oder, was selten ist, Lob hört.
La Donna, der sie die geschwollenen Knöchel massiert, während diese aus ihrem Leben erzählt, eine Arie aus Triumphen und Enttäuschungen, und Letztere waren immer fremdbestimmt, denn die Oper ist die vollkommene Komposition der Angst vor dem Versagen. Vor den Männern, die Rollen besetzen. Vor dem Regisseur, der den Erfolgsdruck nach unten weitergibt. Dem Dirigenten, der falsche Einsätze provoziert, zu schnell oder zu langsam spielen lässt. Dem Orchester, das gegen die Stimme anspielt. Den Partnern, die nicht für dich oder das Publikum singen, sondern für ihren Ruhm. Dem großen schwarzen Loch jenseits der Bühne, in dem sie sitzen und darauf warten, zu klatschen oder zu buhen. Das Finale, der Applaus, die Vorhänge, sie sind der Lohn der Angst. Und das Lob der Kritiker, der nächste Vertrag, das Angebot eines bedeutenderen Hauses ... Ruhm ist der Stoff des Lebens... und die Fäden des Triumphes und der Niederlage sind nur aus Gier und Angst gewebt. Sie hinterlassen keine Spuren, wenn man davon absieht, dass sie alle anderen Gefühle vernichten.
»Wenn du Geld verdienen willst, Kindchen, dann versuch es mit der Volksmusik«, sagt Astrid Stemm.
»Zu wenig Busen. Und ich hasse Volksmusik.« Rita bezahlt zweihundertfünfzig Mark für zwei Stunden Unterricht und fordert nichts für Pralinen, Massagen, Einkäufe und Erledigungen, die Astrid selbstverständlich von ihrer Schülerin erwartet. Dies ist Oper und nicht soziale Marktwirtschaft. Macht über diese jungen Dinger auszuüben, ist die letzte Spielart aller unbefriedigten Eitelkeiten, Demütigungen, Verletzungen. Macht ist das Vergnügen, das bleibt, wenn alles Gute hinter dir liegt. Singt, und ihr werdet erfahren, dass eine menschliche Stimme nicht laut genug ist, alle anderen zu übertönen. »Sie ist dein Dornbusch«, sagt Gregor, und er hört nicht auf, gekränkt zu sein. In langen grauen Stunden und Tagen lebt Rita gegen die Missbilligung der Familie und für den Traum, der nur ihr gehört. Das Gespenst des Scheiterns wirft Schatten über die Straße, in der sie wohnt, die Wurstfabrik, die Kneipe, den halbblinden Spiegel im Badezimmer, in dem sie eine sieht, die Brünnhilde so gar nicht ähnelt. Abends, wenn sie nicht arbeitet oder den Italienischkurs an der Volkshochschule besucht, hört sie über Kopfhörer Arien, lernt Wort für Wort auswendig, singt sie mit, natürlich nicht zu laut, um niemanden zu stören.
Und sie stört doch. Sie bekam Annas Zimmer, als diese auszog, eine Entscheidung Hannas, die Laura schmollend akzeptierte, denn als Zweitälteste hätte sie »den natürlichen Anspruch« gehabt. Sie ist eine Zurückweichende, also hat sie nicht dafür gekämpft. Sie ist, bisweilen fühlt sie es, eine Nichtigkeit des Weltgeschehens, das ohnehin auf ein Stadtviertel reduziert ist.
Rita ist anders. Das sagt sogar Hanna, die großen Wert darauf legt, ihre Liebe wie weichen Schnee gleichmäßig auf alle zu verteilen. Niemand musste je frieren, und doch fühlt Laura sich betrogen. Um Anerkennung, denn alle anderen in dieser Familie erscheinen wichtiger, sogar die Tote, deren Grab Hanna jedes Wochenende aufsucht.
Schnee ist nicht gleich Schnee. Und Rita ist die Einzige, die keinen Pfennig zu Hause abliefert, sondern alles, was sie mit ihren Jobs verdient, in diese verrückten Gesangsstunden steckt. Selbst Anna trägt noch etwas bei, obwohl sie nur noch zum Essen kommt, häufig allerdings, und manchmal bringt sie Justus mit, der aussieht wie ein vertrockneter Engel, dem Anna Flügel wachsen lässt. Er hat es am Magen, deshalb kocht Hanna ihm Schongerichte, und während des Essens sind Gregors strenge, priesterlichen Blicke auf seinen Schwiegersohn gerichtet, den Anna umhätschelt, als sei er ihr Baby.
Was der Basis dieser Beziehung vermutlich am nächsten kommt: Anna hat ihr Kind gefunden. Rita hat ihre Musik. Hanna ihre Küche, und Gregor hat Hanna. Und nur sie, Laura, hat nichts. Brot in ihren Händen, und Wechselgeld. Und manchmal einen Schwanz, der zu einem Mann gehört, den sie nicht wirklich will und nur deshalb berührt, weil dieser Funken Hoffnung unzerstörbar ist, dass es den Richtigen geben könnte. Also muss man nicht Nein sagen und daran glauben, dass das Wunder geschieht und sich aus den groben Hüllen der strahlende Held aller Fernsehserien schält.
Lieber Gott, mach mich fromm, auf dass ich einen Mann bekomm. Das sind Nachtgebete von großer Unsinnigkeit, denn das Gegenteil wäre erfolgversprechender. Die Tage sind so lang, und sie wird Krampfadern bekommen vom Stehen in der Bäckerei, und abends ist sie müde, einfach nur müde.
Rita hat das Ave Maria gesungen bei Annas Hochzeit. So ergreifend. Hat man ihr, Laura, jemals im Leben applaudiert? Nein, und so hat sie sich umgesehen, während Rita gegen die Orgel anheulte, ob nicht zumindest einer unter den Gästen sei, den sie heiraten könnte. Anna hatte das Seniorenheim geladen: alte Augen, manche lüstern, andere einfach nur glasig, schon verschwommen im Übergang zwischen Leben und Tod. »Sie brauchen so viel Zärtlichkeit«, sagt Anna immer. Aber wer zum Teufel gibt Laura die Zärtlichkeit, die sie braucht, die Anerkennung, Bewunderung, die gottverdammte Liebe, die man nicht kaufen kann wie den teuren Fetzen, den sie zur Feier trug, fast ein Monatsgehalt war er wert, und niemand wusste es zu schätzen. Sie hat Schulden in der Boutique, so hoch, dass sie inzwischen einen Bogen um das Geschäft macht.
»Ein unschätzbares Gut ist es, sein eigenes Eigentum zu werden.« Papa und seine Sprüche. Seine Rede bei der Hochzeit war viel zu lang, einige der Alten schliefen ein und wachten erst wieder auf, als die gigantische Torte in den Saal gerollt wurde. Hanna hatte sich selbst übertroffen, und sie nahm die Ovationen mit der Gelassenheit der großen Künstlerin entgegen. Der Kellner, dem Laura sich nach Mitternacht in der Toilette hingab, vermittelte ihr auch nicht das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Er war sehr hübsch, sprach aber kaum deutsch. Danach fragte sie ihn aus Höflichkeit, woher er käme, und er sagte: »Syrien«. Ein Land jenseits ihrer Vorstellungskraft, und seinen Namen hat sie auch vergessen. Sex ohne Liebe ist traurig, aber das merkt man erst, wenn es zu spät ist.
Laura steht vor dem Spiegel und schminkt sich ab. Ein getränkter Wattebausch, der schwarze Linien über ihre Wangen zieht. Sie würde nie ohne gründliche Reinigung zu Bett gehen. Selbst nachdem ihr Mann sie geschlagen hatte, wurde dieses Ritual erfüllt. Die Zeitschriften sagen, dass man sich pflegen muss und dafür im Alter belohnt wird. Sie war die Einzige der Schwestern, die überaus lange an den Weihnachtsmann glaubte. Sie war immer ein braves Kind, sagt Hanna, eines, das alle Regeln befolgte. O Gott, wie sie manchmal wünscht, dass sie in das Auto gelaufen wäre. Das Gefühl, sich im Leben verloren zu haben, ist ja auch eine Art von Tod.
»Darf ich reinkommen?«
»Na klar, wir haben ja nur ein Bad.« Sie öffnet Rita die Tür, die sie versperrt hatte. Vater hasst das, er weigert sich sogar, die Wohnungstür abzuschließen. Eine seiner Theorien, dass die Menschen sich allem versperren und deshalb einsam geworden sind. Er hätte doch Priester werden sollen, manchmal glaubt sie, dass diese verlorene Möglichkeit ihm das ewige Grinsen ins Gesicht gegraben hat.
Rita ist nass, sie reibt sich die komischen Haare mit einem Handtuch trocken. Sie joggt, auch wenn es regnet, es scheint nichts zu geben, das ihre Schwester davon abhält, ihren großen Plan einzuhalten.
»Was macht die Kunst?«
Zwei Augenpaare treffen sich in einem halbblinden Spiegel. »Sie frisst mich auf«, sagt Rita. Sie zieht sich aus, und ihr Körper ist weiß und von stählerner Zerbrechlichkeit. Da auch die Schamhaare weißblond gefärbt sind, sieht sie sehr nackt aus. Sie hat Rita nie gefragt, ob sie noch Jungfrau ist, doch sie nimmt es an. Unwahrscheinlich, dass einer es wagen sollte, diesen riesigen Zwerg zu besteigen. »Ich wäre auch lieber Künstlerin«, sagt Laura, während ihre Schwester Annas alten Bademantel um sich drapiert. Er ist viel zu groß und an den Enden ausgefranst.
»Dann tu es doch.«
»Du meinst, ich muss nur sagen ich will- und dann geschieht es?«
Rita verzieht ihr Gesicht zu einer Clownsmaske. »Nichts geschieht. Außer dass du beim Joggen auf die Nase fällst, weil du den Augenkontakt zum Boden verloren hast. Ich bin mit einem Schuh in einem Gully hängengeblieben und lag bäuchlings in einer Pfütze. Und stell dir vor, als ich aufblicke, reicht mir jemand meinen verlorenen Turnschuh. Mit der Bemerkung, dass es ein antikes Stück sei.«
Das erste, ursprünglichste Gefühl ist Eifersucht. Wer käme auf die Idee, an einem nasskalten Abend in dieser Straße einen Prinzen zu finden? »Wie sah er aus? Ein Siegfried?«
»Nein, eher Hagen. Aber er war sehr nett. Glaubst du, dass ich absichtlich gestolpert bin? Es war vor dem Haus der Taubenmörderin, an der Stelle, wo... du weißt schon.«
An jedem Jahrestag legt Hanna eine Blume auf den Asphalt. Wir leben von Erinnerungen, denkt Laura, an eine schöne, unbeschwerte Kindheit. Und sie lässt es nicht zu, dass wir vergessen. Damit wir Kinder bleiben. Hanna kocht in großen Mengen, und der hölzerne Esstisch ist ihre Bühne. Wie konnte sie es zulassen, eine Tochter ohne jedes Talent auf die Welt zu bringen? Nur mit Sehnsüchten ausgestattet. »Und – wie ging es weiter?«
Rita steigt auf die Waage und verlässt sie seufzend. Mit diesem Gewicht kann man Pagen oder Zofen spielen, und kein Muskeltraining lässt den Zeiger vorwärts springen. »Gar nicht. Er half mir, den Schuh anzuziehen, und ist das letzte Stück mit mir gelaufen.«
»Sei froh, dass er dich nicht vergewaltigt hat.«
Laura ist eine Frau mit Vergangenheit, auch dafür fühlt sich die Familie verantwortlich, und so schweigt Rita. In der Enge dieser Gemeinschaft birgt jeder Versuch von Nähe das Risiko der Sippenhaft. Wir haben eine Tote zu beklagen und eine Geschlagene. Wir sind fröhlich, aber nicht unbeschwert, und wehe, wenn alte Wunden berührt werden. Und so liegt über allem Lärm eine stille Traurigkeit, undefiniert, und Rita lacht, um ihre Schwester zu besänftigen.
»Man kann die Helden von den Schurken nicht so leicht unterscheiden.« Laura geht voraus in die Küche, in der es nach Thymian und Koriander duftet. Geborgenheit hat einen altmodischen, penetranten Geruch. Sie hasst ihn und ist unfähig, ihm zu entkommen.
»Nach dem Essen könntest du uns was vorsingen«, sagt Hanna. Sie sagt es fast jeden Abend.
Rita setzt sich auf ihren Platz auf der Eckbank. »Ich muss meine Stimme schonen.« Genau das tut sie nicht, und doch ist es ihre Antwort jeden Abend, außer zu besonderen Gelegenheiten.
Familienfeiern. Begräbnisse. Hochzeiten. Hanna hat die Reste des Vortages zu einem kräuterduftenden Auflauf verarbeitet. In dieser Familie wird nichts weggeworfen außer Träumen. Arme Laura. Sie kann sich zwischen ihren Hoffnungen und Ängsten nie entscheiden.
Und er war doch nett. Er hieß Hagen, und er hat eine Schwingung ausgelöst, die sie mangels anderer Erfahrung musikalisch deutet. Mozart entwickelte in der Zauberflöte eine besondere Vorliebe für Außenseiter. Rita hörte das Liebesduett von Pamina und Papageno, als sie ihm nachsah, wie er durch den Regen lief.