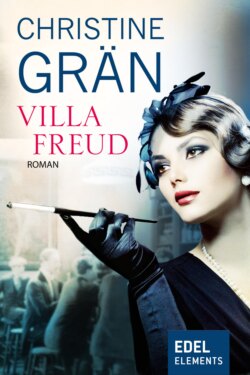Читать книгу Villa Freud - Christine Grän - Страница 8
4
ОглавлениеMusik ist Liebe, Wahnsinn, Zerstörung. Sie ist eitel, unvollkommen, ausschließlich. Ein Geschäft wie jedes andere. Nur schöner, sehr viel schöner. Das Geheimnis einer Stimme ist, dass sie einen Kern haben muss wie eine Pflaume. Einen Kern aus musikalischer Intelligenz und Leidenschaft. Ritas Gesang hat an Ausdruck gewonnen, an »Brunst«, wie die Stemm sagt. Es kann sich nur um einen Mann handeln, der diesem kleinen Vogel Flügel verliehen hat.
Die Diva erinnert sich, wenn auch nur vage, an eine Zeit der jubilierenden und kollabierenden Gefühle, und alles floss in die Stimme, wohin sonst, und am Ende trocknete alles aus. Brüchige Töne, umhüllt von Wüste. Der Okavango, im Sand versickert. Sie hat von dem Fluss gehört, doch gesehen hat sie nur Opern- und Konzerthäuser, Bahnhöfe, Flughäfen, Hotels. Die schäbigen Garderoben. Kantinen, in denen der üble Gestank des Neids über das Bratenfett triumphierte. Das Leben als Illusion von Größe, gebrochen in viele kleine Widrigkeiten. Und von Jahr zu Jahr werden sie bedeutender. Sie hört ein bisschen schlecht in letzter Zeit, das macht ihr Sorgen. Ohne das Geld für die Gesangstunden würde sie verhungern.
Alles, was man weiß, weiß man zu spät; die unzeitgemäßen Einsätze waren stets eine Katastrophe. Sie ist alt, krank, übergewichtig, und ihr Arzt, ein Heldentenor ohne Stimme, spricht von Diäten. Wozu die Aufregung, sie ist ja schon gestorben, als Marschallin im Rosenkavalier, eine miserable Aufführung an einer Provinzbühne. Astrid Stemm war großartig in dieser, ihrer letzten Rolle, sowohl in Gesang wie auch Darstellung, doch das lokale Schmierenblatt schrieb, dass sie ihre besten Jahre wohl hinter sich habe.
Das ist fünfzehn Jahre her. Heute würde sie diesen Satz akzeptieren. Obwohl, Kritiker sind die Totengräber der Musik. Sie kannte einen, der fast taub war und seine Kritiken aus den Reaktionen des Publikums »herauslas«. Er liebte sich und Beethoven.
Astrid Stemm war mit ihm im Bett. Der Akt ist ihr nicht mehr in Erinnerung, wohl aber das Motiv. Sie sang die Rosalinde in der Fledermaus, eine gehasste Rolle mit diesem vulgären Csárdás, den sie nie zu beherrschen gelernt hatte. Später schrieb er, dass sie sich durch die Koloraturen geheult und wie ein Elefant getanzt habe. Nachdem sie seine Kritik gelesen hatte, schlitzte sie ihm die Autoreifen auf, eine Form der Rache, die sie als unzureichend empfand. Man hätte ihm die Augen ausstechen sollen, die blinden.
Und nie wieder schlief sie mit einem Kritiker. Es gab Regisseure, Repetitoren, Sänger, Orchestermusiker. Geiger waren in der Regel etwas besser als Bläser, warum, hat sie nie herausgefunden. Es war auch nicht wichtig, denn vorrangig ging es darum, nach einer Aufführung nicht allein zu sein, über alle Töne und Schritte und Publikumsreaktionen mit jemandem zu reden. Die Oper, das ist eine große Familie aus egomanischen Monstern. Selbst der Kantinenkellner, ihr letzter sexueller Akt, war ein intriganter Schmierenkomödiant. Er senkte den Vorhang für eine Blondine aus dem Chor, die wie ein Vogel zwitscherte und keinen tiefen Ton halten konnte.
Rita studiert die Isolde ein, Wagners Denkmal für den schönsten aller Träume, und er steht für die Liebe, die stärker ist als der Tod. Isolde stirbt wie Kleists Penthesilea, indem sie mit der Gewalt ihres Willens das Leben in sich besiegt. Tod ist Erlösung von allen Zwängen und Nötigungen... in des Welt-Atems wehendem All – ertrinken, versinken...
»Du musst den Bogen halten!«, schreit sie, während Rita zu Boden sinkt. Leiser: »Deine Stimme ist gestorben, bevor Isolde es tut.«
Rita hat alles gegeben, sie weiß es, mehr kann sie nicht, und es war perfekt. Fast. Sie sitzt mit gebeugten Schultern am Boden und ringt nach Atem. Sterben ist schwer, doch der Tod ist ihr nahe genug, um ihn fühlen zu können. Hanna hat Brustkrebs, sie ist die statistische Vierte in Deutschland, das ist Pech, Schicksal, ein genetischer Defekt, eine weitere Familienkatastrophe, an der Hanna ihre Stärke messen kann. Auch mit einer Brust, mit der sie weiterlebt wie eine Amazone, die Männer wie Gregor mühelos bezwingt. Mehr denn je betet er sie an, diese Liebe hat heilige Dimensionen, und Rita und ihre Schwestern fühlen sich ausgeschlossen. War es nicht immer so? In der Hierarchie der Familie ist die Stärke des einen die Schwäche der anderen. Rita klammert sich an Hagen, weil er sie braucht, und niemand sonst es tut.
Die Stemm greift sich an die Brust, ein Zeichen des Abschieds. Sie klagt über Herzbeschwerden, doch das Pathos ihrer Gebärden ist so unübersehbar, dass Rita es nicht ernst nimmt. Dennoch fragt sie, ob sie irgendwie helfen könne? Die Kameliendame ohne Schwindsucht winkt mit matter Geste ab. Sie ist in das rote Samtsofa gesunken, und man könnte sich vorstellen, dass sie ewig da liegt, Tag und Nacht, und bisweilen nach dem Konfekt auf dem Beistelltisch greift oder nach Hannas Johannisbeerlikör, den sie so gerne trinkt. Die Süße des Seins in Kalorien konsumiert: Man bedarf aller Tröstungen, wenn man untröstlich ist.
»Vielleicht ist es für die Isolde doch noch zu früh«, sind ihre letzten Worte an ihre Schülerin, die diese stumm von sich weist. »Zu früh« gibt es nicht, nur »zu spät«. Wer ungeduldig ist, macht Fehler. Sagt Gregor. Aber es gibt eine Form der Geduld, die ein ganzes Leben andauert und zu nichts führt außer Versäumnissen.
Rita zieht die Tür sanft hinter sich zu und schwebt über die Treppen zum Ausgang. Wenn sie den Zug erreicht, wird sie pünktlich zum Abendessen zu Hause sein. Anna wird da sein mit ihrem alten Mann, der sich wie ein Haustier in die Familie eingefugt hat. Manchmal besorgt er Rita Opernkarten, weil er einen Beleuchter kennt, für den er die Steuererklärung macht. Diese Familie lebt in einigen Bereichen vom Tauschhandel; Hannas Pralinen und Torten sind eine harte Währung im Gegenzug zu anderen Naturalien oder Dienstleistungen. Sogar das Klavier wurde auf dieser Basis zumindest so weit gestimmt, dass Rita seinen Klang ertragen kann.
Zu besonderen Gelegenheiten, zum Beispiel als Hanna ihre Brustkrebsdiagnose bekannt gab, beteiligt sich Rita an dem, was Gregor »Hausmusik« nennt. Denn manchmal, selten, gibt es keine Worte mehr für den einen oder anderen Schmerz. Dann flüchtet Laura vor den Fernsehapparat im Kinderzimmer, und Hanna setzt sich ans Klavier. Rita singt. Und Gregor wiegt seinen Kopf im Takt und wünscht sich, die Zeit anzuhalten. Sie arbeitet gegen ihn, sie ist ein Feind des Glücks, dessen vollkommene Augenblicke er wie auf einer Perlenschnur aufreihen möchte. Hanna soll sie tragen und an ihre Töchter weitergeben. Und doch ist es so, dass er Angst empfindet, wenn er Rita zuhört. Mit jedem Ton scheint sie zu schrumpfen, sich langsam aufzulösen, als ob die Anstrengung zu groß wäre für diesen kleinen Körper. Am Ende sieht er sie nicht mehr, hört nur noch ihre Stimme, die leiser wird... und wenn er es Hanna erzählt, lacht sie ihn aus.
Sie glaubt nur an das, was sie sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken kann. Nur an das Leben, wie es ist, die erdenschwere Existenz, und nichts davor und danach, darüber oder darunter.
Religion ist etwas für die Furchtsamen, sagt Hanna. Leben ergebe nur den Sinn, mit dem man es ausfülle. Und so hat sie einen Mann gewählt, der sie braucht und nie in Frage stellen wird. Sie hört ihm aufmerksam zu, wenn er über seine Propheten spricht, und sagt dann, dass sie nur das annehmen könne, was sie verstehe, das Konkrete nämlich. Schließlich sei sie eine ungebildete Frau, und jenseits der Küche und Kinder sei die Welt sehr unbestimmt und nur so weit von Interesse, als sie darauf Einfluss nehmen könne. Alles andere, sagt Hanna, sei wie Fernsehen: amüsant oder schrecklich oder einfach nur langweilig.
Hagen, der aus Prinzip alles in Frage stellt, bezweifelt, dass es das »perfekte Paar« gibt. Die Verneinung als Lebensform ist die Jacke, die ihn vor der Kälte der Enttäuschung schützen soll. Hagen und Rita kennen sich seit zwei Jahren, vielleicht lieben sie sich auch, aber sicher ist sie sich nur, dass sie ihn nicht mit der Familie teilen möchte. Das Spielzeug oder Geheimnis, der Freund oder Geliebte, der nur ihr gehört. Sie glaubt zu wissen, dass die Intimität dieser Beziehung dem Familiensog nicht standhalten würde.
Also treffen sie sich in seiner kleinen Wohnung und verzichten auf gemeinsame Exkursionen, und wenn sie sich beim Joggen begegnen, lächeln sie einander kurz an und laufen weiter. Sie haben wenig Zeit, beide, weil sie keinen Beruf haben und viele Jobs, die diese monetäre Lücke ausfüllen. Sie beschränken die gemeinsame Zeit auf Reden und Sex.
Hagen versteht Ritas Traum, auch wenn er Opern als kulturelitären Selbstzweck und Wagner als unzeitgemäßen Reaktionär ablehnt. Worte sind die leichte Übung eines Belesenen, der sich weigert, sein eigenes Buch zu schreiben. Wozu die Mühe, die Aufregung? Ein Ziel zu haben, ist die horizontale Ausdehnung über bodenlosen Schächten. Er hat keines. Lebt im Untergeschoss des kapitalistischen Elfenbeinturms und nennt sich Lebenskünstler, weil ihm keine bessere Bezeichnung einfällt für das Dahingleiten von einem Tag zum nächsten, erfüllt mit Zeitvertreib, der Geld bringt und ihn weder anekelt noch besonders anturnt.
Hagen repariert Computer und Telefonanlagen für Freunde und Bekannte, renoviert Wohnungen und springt als Discjockey ein oder auch als Türsteher; alle Talente sind provisorisch und flexibel und unterliegen dem Prinzip von Lust und Laune. Die Kunst des Lebens liegt darin, keinen Ernst darin zu suchen.
Die Schattenwirtschaft ist ein Milieu, das ihm zusagt, weil er die Unverbindlichkeit schätzt und sich dem entzieht, was er die Versklavungsmechanismen der Marktwirtschaft nennt. Sein Vater hat vierundfünfzig Jahre gearbeitet und bezieht jetzt eine kleine Rente.
Solche Leute muss es geben, er hat keine grundsätzlichen politischen Vorbehalte gegen das System, nur eine Reihe privater Motive, sich ihm zu entziehen.
Alles ist fremdes Gut, nur die Zeit ist unser Eigen. Die Zeit ist ihm heilig, vielleicht noch die Stereoanlage, der Computer, das Motorrad, die Fliegerjacke aus antikem Leder. Alles andere in seinem Leben ist spartanisch angelegt bis hin zu Dosenfutter und Fastfood, die Rita faszinierend sättigend findet. Was sie an ihm liebt? Sein Aussehen, alles, was schwarz ist, von den Haaren bis zur Kleidung. Er ist so viel schöner als sie, dieser Vorsprung macht dankbar, fast demütig. Sie liebt ihn nicht. Sie bewundert seine Freiheit von Lebensplänen, Bindungen, Besitzständen. Die Art, wie er ihr zuhören kann, aufmerksam und geduldig. Wie er ihren verkrampften Nacken massiert oder die Füße, die sie als Wochenendkellnerin strapaziert. Sein Schweigen. Während alle anderen reden, als ob sie pausenlos etwas zu sagen hätten, kann Hagen über lange Strecken still sein. Er fordert nichts von ihr, nicht einmal Zeit. Sie hat einen Schlüssel zu seiner Wohnung, kann kommen und gehen, wann sie will, und wenn er nicht da ist, hinterlässt sie ihm eine Nachricht. Schreibt »Ich liebe dich« auf kleine Zettel, die sie an die große Pinnwand in der Küche heftet, neben Rechnungen, Mahnungen, Computerausdrucken, Notizen, Fotos von Hagen auf dem Motorrad in verschiedenen Ländern Europas.
Sie fühlt sich nicht mehr allein, das ist das Geheimnis dieser Beziehung. Zwei, die miteinander schweigen können, haben sich etwas zu sagen, und was trennen könnte, wird verdrängt. Abgesehen von ihren Eltern existiert nichts, woran sie diese Beziehung messen könnte, nur Rita und Hagen, vereint in Einsamkeit und einer Form von Sex, die beiden als angemessen erscheint.
Sie berühren einander nicht, wenn sie Sex haben, nur davor und danach. Sie küssen und streicheln sich, das ist das Spiel von Kindern, sie ziehen einander aus und lachen über ihre Ungeduld, und dann sitzen sie sich nackt gegenüber, auf dem Bett oder auch auf dem Teppich, und befriedigen sich selbst und sehen sich an dabei oder schließen die Augen, je nach Stimmung, und es ist eine große Nähe in dieser Distanz, und weiter wollen sie nicht gehen, noch nicht, vielleicht nie, denn Sex ist, sie ahnen es beide, das gewöhnlichste, brutalste, komplizierteste Spiel von allen.
Stillschweigend das Einverständnis, sich vor Missverständnis und Missvergnügen zu schützen, indem man den anderen nur mit den Augen berührt. In dieser voyeuristischen Variante des Beischlafs spielt der Gleichtakt der Lust keine Rolle, und nur beim ersten Mal, als sie auf seinen Vorschlag der Selbstbefriedigung einging, schämte sie sich mit geschlossenen Augen und brauchte sehr lange, um sich auf ihren Körper zu konzentrieren. Danach nicht mehr. Der erregendste Moment ist, in die Augen des anderen zu sehen wie in einen Spiegel der Lust. »Du warst gut«, sagt Hagen manchmal, wenn er fertig ist, doch Komplimente fallen sehr aus dem emotionalen Rahmen, den er sich gesetzt hat.
Die Familie ist in ihrer Welt gefangen. Hanna hat eine Brust verloren und wünschte sich noch ein Kind, um diesen Verlust auszugleichen.
Es ist zu spät, sie hat vollendete Tatsachen geschaffen, und darunter leidet sie, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Der zweite Rückzug in die Trauer dringt in heftiger Aktivität nach außen. Hanna redet und kocht, sie lacht sehr laut und oft, und erträgt keinen Augenblick der Stille.
Gregor wird nicht müde, ihr zu versichern, dass sie die Schönste aller Amazonen sei. Seine Lüge beschämt ihn, denn er fürchtet sich vor dem Augenblick, in dem sie sich entkleidet, vor der vernarbten Ebene, die neben der großen Zwillingsbrust so grausam verloren aussieht. Das Wort, das er nicht zu denken wagt, heißt Ekel, und es macht ihn impotent und zutiefst unglücklich. Sex entzieht sich allen philosophischen Betrachtungsweisen, aller Güte und Liebe und Wahrhaftigkeit. Genitalien sind der Resonanzboden des Gehirns, und er wünschte sich, sie zu verlieren so wie Hanna ihre Brust. Als gerechter Ausgleich für Schuldgefühle. Er ist, wie sie schon früh erkannt hat, ein sehr unvollkommener Masochist.
Anna sieht die Risse in den Familienbanden und erklärt sich für nicht zuständig. Ihr Leben mit Justus ist ruhig und behutsam, und in diesem Kokon will sie bleiben, sich einspinnen, und für den Fall, dass das alte Kind stirbt, möchte sie ein Baby zur Welt bringen. Sie ist insofern nicht wählerisch, als sie sich nicht auf Justus’ müden Samen kapriziert. Anna ist bereit, jeden zu nehmen, der sie mit guter Hoffnung erfüllt. Konspirativ natürlich, denn sie will ihren Mann nicht kränken. Sie hat immer gewusst, dass sie stark genug ist, die Fortpflanzungsgeschichte alleine durchzuziehen. Wie Hanna es auch getan hat, auf ihre Art und mit ihren Möglichkeiten.
Rita lebt in der Welt ihrer einsamen Orgasmen, beim Singen und in Hagens Wohnung. Wenn Anna über ihre Pläne sprechen würde, was sie nicht tut, wären sich die Schwestern einig, dass Zärtlichkeit wichtig sei, nicht aber Sex. Der Austausch von Schweiß und Körpersäften, Selbstverleugnung und Heuchelei, so ihre übereinstimmende Meinung, ist eine antiquierte Form der Liebe. Eine für die Fortpflanzung überflüssige Leibesübung, eine Vergewaltigung der Sinne, das große Missverständnis, dass männliche und weibliche Geschlechtsorgane eine natürliche Symbiose der Lust bilden.
Braucht die Oper Sex? Mitnichten. Sie lebt von den großen Gefühlen, den guten und schlechten, und nicht den kleinen Bewegungen der Triebe. Musik ist die zivilisierte Form des Lebens, daran glaubt Rita, und selbst wenn es nicht so wäre, ist sie der Droge verfallen. Man liebt zuletzt seine Begierde und nicht das Begehrte.
»Wer Musik macht, lernt, nicht zu hassen«, sagte Isaac Stern einmal, und Rita fügt für sich hinzu: »Allenfalls sich selbst.« Sie hasst sich, wenn die Spitzentöne ab dem hohen B schrill werden, das Timbre hohl, die Stimme unausgeglichen. Ihr Kampf um das hohe C ist heroisch, aber nicht entschieden. Die Ungeduld ist ihr Feind, den sie braucht, um durchzuhalten. Hagen tötet bisweilen mit dem Speer des Kleinmütigen: Talent und Willen seien ohne Glück nicht durchsetzungsfähig. Und auf das Glück könne Rita nicht bauen.
Es gibt keinen Weg zurück, und wenn, wohin sollte sie gehen?
Zurück in Hannas Bauch wäre die einzige Lösung, die ihr einfiele. Wenn sie die Schritte ihres Lebens zählt, so waren es nicht viele, die von zu Hause wegführten. Siebenundsiebzig Schritte von der Wohnung zu dem Haus, in dem Hagen sich eingenistet hat. Der Weg zu Astrid Stemm, die Fahrt in bemalten Zügen, in denen bleiche Menschen sitzen, die einander nicht oder nur verstohlen ansehen. Der Gasthof am Ende der Straße, die Wurstfabrik. Leute, die sich scheinbar widerspruchslos in ihr Schicksal gefügt haben. Sie spielen Lotto, so viel zum Glück. Und wenn sie in besseren Straßen und Häusern lebten, würden sie anders empfinden?
In einer irrsinnigen Welt vernünftig sein zu wollen, ist schon wieder ein Irrsinn für sich. Sagt Hagen, der Meisterdieb der Zitate und Wächter unverbindlicher Taten. Er verwöhnt sie mit Matetee und massiert ihre Fußballen. Er macht nie etwas falsch, das richtig sein könnte. Hagen ist so abgrundtief traurig, dass sie ständig darüber lachen muss. Es gibt nichts Ernstes, außer man tut es. Wie Rita es versucht, und ihre Niederlage könnte sein Vergnügen sein. Sie weiß es doch: Der Weg in Hannas Bauch ist versperrt, zu viele Schritte führen zurück, sie ist erwachsen und hat keine Ahnung, was sie damit anfangen soll. Sie kann nur singen.
»Frei bist du nur, wenn du keine Wünsche hast«, sagt Hagen, und manchmal erinnert er sie an Gregor, nur ohne Heiligenschein. Seine Liebe zum Schicksal, gewürzt mit Sartre, Nietzsche und Schopenhauer, schmeckt manchmal berauschend und dann wieder nur nach kindlicher Verweigerung. Dann möchte sie ihn aufrütteln, auf den Kopf stellen und nach ihrem Willen formen, aber schon während sie das denkt, verschwendet sie mehr Kraft, als sie aufbringen möchte. Vielleicht braucht sie ihn, liebt ihn sogar, doch dieses Gefühl ist nichts im Vergleich zu dem Wunsch, von vielen geliebt zu werden. Die Isolde so unvergleichlich zu singen, dass Hunderte an ihren Lippen hängen.
»Wer von uns beiden ist das Kind?«, fragt Hagen dann und setzt sich Kopfhörer auf. Wenn sie in hohe Tonlagen gerät, schmerzen seine Zähne, und Wagner macht ihn aggressiv. Nur sanfte Jazzmusik streichelt seine Gehörnerven. Sie haben nichts gemeinsam außer der Einsamkeit, an der sie festhalten, während sie einander küssen und streicheln. Schon Minuten wären verschwendet, würde er in Rita etwas von sich selbst suchen. Sie ist wie ein Gefäß, in das er Worte tropfen lässt, die versickern. Alles an ihr ist porös bis auf die Stimmbänder. Hierhin hat sie alle Kraft, alle Gefühle konzentriert.
Was man bewundert, muss man nicht lieben. Es ist die Verzweiflung in Frauen, die ihn anzieht, ihre Lust am vollkommenen Untergang anstelle eines geordneten Rückzugs ins Exil der Einsamkeit. Seine letzte Freundin verschwand in Richtung Burma. Sie hinterließ ihm einen Zettel, auf dem stand, dass sie nach ihrem Gott suchen wolle. Er hängt immer noch an seiner Küchenwand. Hagens gesammelte Erinnerungen sind ein Protokoll der Sinnlosigkeit, so wie es ihm gefällt. Neunundneunzig Prozent der Materie aller Lebewesen besteht aus Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Worüber soll er sich aufregen? Die Endlichkeit chemischer Verbindungen? Ritas absurden Wunsch, unsterblich zu werden?
Alles! Alles! Alles weiß ich: Alles ward mir nun frei!
Rita winkt den Mannen, Siegfrieds Leichnam aufzuheben. Sie ist Brünnhilde, sieht ihn liegen auf Stemms Parkett und kniet nieder, um ihm den Ring vom Finger zu ziehen. Die Koordination von Stimme, Gefühl und Bewegung erfordert absolute Konzentration. Dennoch registriert sie Schokoladenkrümel, dort, wo Siegfried liegen sollte, den Hagen erschlug. Sie singt weiter, scheitert am verdammten hohen C, ihre Stimme überschlägt sich, und als sie aufsieht, hält sich die Diva die Ohren zu und schreit »AUFHÖREN!«.
Ein Stemm-Ton in schrillster Höhenlage, der abrupt abbricht. Ein flacher Atemzug, der kein Leben bringt, und ein Schmerz in ihrer Brust, der alles auslöscht, was sie je erlitten hat. Er währt nicht lang, dann fällt der Vorhang, dies ist das Ende, die plötzliche Dunkelheit, die Astrid Stemm immer gefürchtet hat.
»Ein gnädiger Tod«, sagen die Leute später, die wenigen, die sie kannten und den kurzen Nachruf im Lokalteil der Zeitung lesen. Es gibt gnädige und schreckliche Tode, nichts anderes, und es gibt Schmerz oder Gleichgültigkeit oder Schuldgefühle. Man lebt ja noch.
»Ich habe sie umgebracht«, sagt Rita zu ihrem Liebhaber, als sie von der Beerdigung kommt. Sie glaubt es in gewisser Weise, denn sie hat an dem missglückten Ton festgehalten, als die Lehrerin »Aufhören!« schrie, hat versucht, ihn zu korrigieren, was unmöglich war, und als sie die Augen öffnete, glitt ein gewaltiger Körper im seidenen Hauskleid vom Sofa zu Boden. Astrid Stemm lag da mit offenem Mund und sah, ja, überrascht aus.
Auf der Bühne wäre sie eleganter gestorben, war Ritas erster Gedanke im Angesicht des Todes. Sie war erschrocken, aber nicht erschüttert, so weit war sie noch nicht, den Verlust des wichtigsten Menschen in ihrem Leben zu beklagen. Sie wedelte mit der Hand über den starren Augen, rüttelte an dem gewaltigen Körper, und dann öffnete sie das Fenster, bevor sie den Notarzt rief. Es war völlig unmöglich, doch sie roch den Gestank der Verwesung.
Er gab ihr eine Beruhigungsspritze, als sie ihm sagte, dass Astrid Stemm am hohen C verschieden sei. Er mochte es nicht, wenn er Kunden als Leichen vorfand. Das Ausfüllen des Totenscheins war mühselig, und Tröstungen der Hinterbliebenen waren eine Qual. Er fragte Rita, die auf dem geschlossenen Toilettendeckel im Badezimmer saß, ob es Verwandte gebe, und sie schüttelte den Kopf. »Nein. Sie war ganz allein.« Er erwiderte: »Sind wir das nicht alle«, und dann senkte er seinen Kopf und küsste sie auf den Mund. Es war nichts, nur ein flüchtiger Kuss der beiderseitigen Tröstung, und sie nahm ihn in narkotisierter Gelassenheit hin. Der Notarzt war noch jung, doch sein kahler Schädel und das bleiche Gesicht, sein Aussehen, das sie erst nach dem Kuss wahrnahm, ließen sie hinterher, in ihren Träumen, zittern. Leichenschänder kamen in ihrem Repertoire nicht vor, doch sie träumte, dass sie die Leiche war, die er berührte.
Tod ist Ziel der Natur, nicht Strafe, sagt Cicero aus Hagens Mund. Seine Hand massiert ihren Nacken, und er redet mit seiner sanften Stimme beruhigend auf sie ein. Der Klang ist einlullend, auch wenn seine Worte sie nicht erreichen.
Hanna kocht Hühnersuppe mit Zitronengras und Chillies, ihr Rezept gegen Leben und Tod. Die »Stimme« ist für eine Weile verstummt, und die anderen reden. Sie lässt sich trösten, obwohl das nicht möglich ist.
»Man könnte meinen, deine Mutter sei gestorben.« Hagen hat sie genau dort, wo er sie haben wollte, doch die Situation beginnt ihn zu langweilen. Er sagt ihr, dass sie den Tod der Lehrerin auch als Chance begreifen müsse. Sich bewerben und vorsingen, den Sprung ins kalte Wasser wagen, statt ewig zu warten. Er spricht gegen all seine Überzeugungen, und es bedeutet ihm nicht das Geringste.
»Du hast noch nie irgendjemandem vorgesungen.« Rita ist aus der Trauer erwacht. Sie kritisiert ihn mit diesem absurden Satz, stellt sein Leitmotiv in Frage. Das ist der Lauf der Liebe, sie beginnt immer mit Bewunderung und endet mit Verachtung. Dazwischen mäandert Selbstverleugnung in allen Erscheinungsformen. Er entscheidet sich in diesem Augenblick für eine Motorradtour durch die Türkei und bringt in Erinnerung, dass sie ihm zweitausend Mark schuldet.
Sie denkt, dass das Leben aus Zahlen besteht: dem Datum der Geburt, der Schritte, die man geht, dem Todestag. Aus Zahlen und Musik, dem einzigen Klang des Lebens, der ihr vertraut ist. Alles andere ist kompliziert, und man verrechnet sich so leicht. Sie möchte glauben, dass sie ohne Schuld ist an allem, was geschieht. Wenn Hanna stirbt, wenn Hagen sie verlässt, ist Rita immer noch ihr Eigentum. Sie kann damit machen, was sie will. Sich die Haare blau färben. In Hagens milde lächelndes Gesicht schlagen. Ihn um sein Geld betrügen. Nach Burma fliehen. Wagner singen. Es kommt doch nur auf ihren Willen an. Natürlich will sie ihm den Kredit zurückzahlen. Nur leider sind diesem Vorsatz ökonomische Grenzen gesetzt. Wie soll sie weitere Gesangstunden bezahlen? Eine Bank überfallen? Die Arbeit in der Gastwirtschaft hat sie verloren. Ein Missverständnis mit einem Gast, der behauptete, sie habe ihn mit dem Wechselgeld betrogen. Der Wirt entschied sich für den guten Gast und gegen die schlechte Kellnerin, und nutzte die Chance, sie um ihren restlichen Lohn zu bringen. Das Leben besteht aus Zahlen. Man zahlt fürs Geld. Auch mit seinem Willen.
Und so sind es nicht Hagen oder Hanna, die Rita auf den Weg bringen, obwohl sie glauben, dass ihr Einfluss schwer wiegt. Die Wahrheit ist, dass Rita beschlossen hat, eine Münze zu werfen, nachdem sie alles Für und Wider abgewogen hat, die Arien, die sie beherrscht, und das hohe C, das ihr nur in den besten Momenten gelingt, der akute Geldmangel gegen den Instinkt, nichts zu übereilen.
Die Münze, die sie wirft, zeigt mit dem Adler nach oben. Sie wird vorsingen. In dem nächstgelegenen Opernhaus, in Frankfurt. Es gibt größere, bessere Häuser, dieses liegt in der Mitte aller Möglichkeiten, und Hanna liefert Sachertorten an eine Kundin, deren Sohn Repetitor in Frankfurt ist und somit eine nützliche Verbindung darstellt.
»Natürlich wirst du es schaffen«, sagt Hanna. Gregor, der sein Lächeln verloren hat, ohne dass die anderen es merken, zündet eine Kerze in der Kirche an, in der er jetzt öfter Zuflucht sucht. Eine Kerze für alle Fälle, denn die Götter sind nicht unbestechlich.
Anna, die schwanger aussieht, es aber nicht ist, bietet an, ihre Schwester zum Termin nach Frankfurt zu fahren, und verbindet diesen Liebesdienst mit einem Termin beim Gynäkologen. Sie braucht ein Kind, das die Vergreisung ihres Seins aufhebt. Manchmal fühlt sie sich älter als Hanna.
Hagen streichelt Ritas Hals, die Goldkehle, an die er ebenso wenig glaubt wie an das Leben nach dem Tode. Oder die Bedeutung dessen, was ihm vorangeht. Die Zeit der Menschheit ist nicht mehr als eine Sekunde, gemessen an der Ewigkeit. Also ist sein Leben viel weniger als eine tausendstel Sekunde. Alles nichts. Er kann ebenso gut für ein paar Wochen in die Türkei fahren. Mit Höchstgeschwindigkeit der Illusion nachjagen, dass es irgendetwas aufzuholen gäbe. Im Übrigen sagt ihm sein Instinkt, dass es besser wäre, zu diesem Zeitpunkt aus Ritas tragischer Oper zu verschwinden.
Rita singt Isoldes Liebestod. So allein auf der großen, leeren Bühne, in ihrem einzigen schwarzen Kleid, das auch zu Beerdigungen dient. Es endet über Knien, die erstaunlich rund sind. Sie trägt hohe Schuhe, um größer zu erscheinen, doch es war falsch, denn sie fühlt keinen Boden unter den Füßen. Die Panik ist vollkommen, also ist sie ganz ruhig. Vom Repetitor am Klavier begleitet, gibt sie alles, was sie an Klang, Fülle, Leidenschaft und Todessehnsucht zu geben hat. Wagners erotische Konzeption der Welt. Isoldes Verlangen nach ewiger Liebe. Ritas Feuerprobe vor ihren Richtern. Sie kann sie nicht sehen, sie sitzen im Dunkeln, dem großen, schwarzen Loch, von dem die Stemm immer gesprochen hat. Sie kann sich nicht hören, nur die Begleitung, und sieht nichts außer dem ausdruckslosen Gesicht des Klavierspielers. Er kommt aus Afghanistan, und vor dem Auftritt hat er ihr erzählt, dass er geflohen sei, nachdem die Taliban die Musik verboten hätten. Er war sehr freundlich, und sie verliebte sich in ihn.
Sie hat Isolde tausendmal gesungen, und es ist das erste Mal. Ewig lange Bogen auf einem Atemzug. »Mild und leise« kommt zu tief, sie fühlt es, ein Augenblick der Verunsicherung, sie fängt den mahnenden Blick des Klavierspielers ein, und dann hört sie ungeduldiges Räuspern aus dem Dunkeln.
Ein Ball rollt auf die Straße, ein roter Ball, und sie läuft ihm nach und weiß, dass sie es nicht tun sollte... der Klavierspieler aus Afghanistan, der Rafael heißt, hat aufgehört zu spielen. Er sieht sie an, und jetzt erst hört Rita die Stille. Sie ist das schrecklichste Geräusch, das sie je gehört hat, nein, das Quietschen der Bremsen war noch schlimmer. Sie sollte jetzt etwas tun, ein paar Worte sagen oder in Ohnmacht sinken. Oder sterben. Noch besser. Nicht mehr steigerungsfähig.
»Vielen Dank für Ihre Vorstellung.«
Da ist eine Stimme aus dem Dunkeln. Der Klavierspieler ist aufgestanden und schließt sein Notenbuch.
»Wir melden uns bei Ihnen.« Irgendjemand sagt diesen Satz mit mörderischer Beiläufigkeit. Sie kann ihn nicht sehen.
Sie hört Schritte im Dunkeln. Weiß, dass sie jetzt gehen sollte, von der Bühne abtreten. Nur ist es so, dass sie sich nicht bewegen kann. Nicht will, dass die Zeit weiterläuft, sondern zu Ende ist. Isolde stirbt. Vorhang. Applaus.
Rafael nimmt sie sanft am Arm und führt sie durch eine Eisentür in den Gang hinter der Bühne. Es ist gut, dass sie sich noch bewegen kann. Er fängt sie auf, als sie stolpert. Er ist sehr freundlich, schon dafür kann man jemanden lieben. »Wie war ich?«
»Nicht schlecht. Aber die Isolde war eine gewagte Wahl. Wie alt bist du?«
»Dreiundzwanzig.«
»Zu jung, um einen Wagnertod zu sterben.«
Er spricht mit schwerem Akzent, und die Wahrheit ist nie leicht. »Wer war die Stimme aus dem Dunkel?«
»Der GMD, Generalmusikdirektor. Er leidet unter einer Halsentzündung, deshalb das Räuspern. Hast du seinetwegen abgebrochen? Das war unprofessionell.«
Sie war gut. Bis zum Ende. Sie hat alles gegeben, und wie kann dieser Mensch von einer Anfängerin Professionalität erwarten? Wenn sie sprechen könnte, würde sie ihm antworten, doch sie hat das Gefühl, dass ihre Stimmbänder zerschnitten sind.
Der Repetitor führt Rita durch den langen, hässlichen Gang zur Hintertür. Seine Schritte sind länger als ihre. Sie hasst ihn für diese feige Eile und sagt ihm, dass sie allein hinausfinde. Er klopft ihr erleichtert auf die Schulter und murmelt etwas, das sie nicht versteht. Dann sprintet er in die andere Richtung... Er erinnert sie an einen Film, den sie mit Anna gesehen hat. Er war sehr traurig, auch wenn sie viel lachten. Anna wartet in dem Café auf der anderen Straßenseite. Sie wird sie erwartungsvoll ansehen und fragen: »Wie war’s? Hast du ein Engagement?«
Mehr als vor allem anderen fürchtet Rita sich vor dieser Frage. Ihr ist übel, sie braucht jetzt vor allem eine Toilette, und sie läuft in die andere Richtung, bis sie die Tür findet. Erbricht Kaffee, Cola und Galle, während ihre Augen tränen. Sie möchte nie wieder aufhören, für immer vor dieser Toilette knien und alles auskotzen. Als sie ein Kind war, sperrte sie sich einmal im Klosett der Schule ein und brachte die Tür nicht mehr auf. Sie wurde unter dem Gelächter der anderen befreit, es war eine lustige Geschichte. Sie war wohl immer eine lächerliche Figur, nur haben Hanna und Gregor, die Stemm und in gewisser Weise auch Hagen es verstanden, sie darüber hinwegzutäuschen.
Sie zwingt sich aufzustehen, aufzuschließen und zum Waschbecken zu gehen. Es ist voller feiner Risse. Sie werden kaum wahrgenommen, und eines Tages bricht alles zusammen. So sieht eine Isolde aus, die kurz vor ihrem Tod verreckt ist. So bleich und voller Risse. Rita lässt kaltes Wasser über ihr Gesicht laufen, bis ihre Haut erfroren ist. Jeder Schmerz ist angenehm. Es ist nichts geschehen, man wird sich bei ihr melden. Nein, sie weiß, was dieser Satz bedeutet. Und dann, als sie den Wasserhahn abdreht, hört sie draußen vor der Tür Stimmen. Sie erkennt eine davon, sie gehört dem Repetitor.
Rita geht auf Zehenspitzen zur Tür. Man darf nicht lauschen, deshalb hat sie es immer getan. Wie anders sollte man hören, was wahr ist?
»Sie ist nicht die Erste, der die Stemm die Stimme ruiniert hat«, sagt Rafael.
Der andere: »Zu mehr als zur Soubrette hätte es ohnehin nicht gereicht. Kein Volumen. Wie kommt die Kleine bloß auf Wagner?«
Rita atmet nicht mehr. Sie steht an der Tür und stirbt, während Rafael spricht. »Das ist doch der Tick von der Stemm: die große Wagner-Sängerin zu gebären. Man sollte der Alten das Handwerk legen.«
»Schon erledigt. Sie ist vor ein paar Wochen beerdigt worden.«
»Gut. Aber das hilft der Kleinen nicht mehr. Kantine? Ich brauche jetzt einen starken Kaffee.«
Schritte, die sich entfernen. Worte, die immer bleiben werden. Rita hat einmal im Fernsehen gesehen, wie ein Mörder sein Todesurteil entgegennahm. Sein Gesicht verriet nichts, keine Angst und keinen Zorn. Sie hat ihn beinahe bewundert, während Gregor ein Plädoyer gegen die Todesstrafe hielt. Sie hat dazu keine Meinung. Sie hat immer nur gesungen. Soubrette mit Wagner-Wahn.
Sie ist sehr gefasst. Trocknet sich sorgfältig ihre Hände und zieht die Lippen nach. Sie sieht grauenhaft aus, doch darüber könnte sie lachen. Sie öffnet vorsichtig die Toilettentür, der Gang ist leer, und sie zwingt sich, nicht zu laufen. Es wäre ohnehin schwierig mit den lächerlich hohen Schuhen, die sie jetzt auszieht. Rita ist klein, und die meisten Menschen können zu ihr herabsehen. Hanna sagt, dass sie zu früh aufhörte zu wachsen. Zu früh, zu spät, woher soll man wissen, welche Zeit die richtige ist?
»Keine«, sagt Rita laut, während sie durch die Tür in den Tag geht, der unangemessen schön ist. Blau, mit durchsichtiger Wolkenschrift. Die Leute laufen über den Gehweg, als ob nichts passiert sei. Sie sieht das Café, in dem Anna wartet. Ihre Schwester wird sagen, dass es zu warm sei für die Jahreszeit, und ihr Lächeln wird erwartungsvoll sein. Rita geht vorüber, ohne einen Blick durch das Glasfenster zu werfen.
Sein Leben muss man vor anderen rechtfertigen, den Tod nur vor sich selbst. Seneca. Hagen, der ihr spöttisch »den Erfolg, den du verdienst« gewünscht hat, bevor er aufs Motorrad stieg. Ob er schon über alle Grenzen ist? Sie vermisst ihn und ist froh, dass er weg ist. Sie hat ihm sein Geld zurückgezahlt und schuldet es jetzt Anna. Zweitausend Mark, das ist viel Geld für eine, die nichts besitzt, nicht einmal eine Stimme.
Vielleicht hat Hagen Recht mit allem, was er sagt. Wie er lebt. Wir bestehen vor allem aus Wasser und Wünschen, und Fließen ist besser als Leiden. Wenn es nur eine Art gibt, in die Welt zu kommen, dann steht zumindest zur Auswahl, wie sie zu verlassen wäre.
Fließen erinnert sie an die Brücke, die sie gesehen hat. Es ist leichter, einen Fuß vor den anderen zu setzen, wenn man ein Ziel hat. Sie hatte eines, daran kann sie sich erinnern. Die Stemm, der Ball, das Auto... und man sollte nicht lauschen, weil es eine Wahrheit gibt, die unerträglich ist. Weil alles einfach nur lächerlich war. Komische Oper mit Rita Bronner und Astrid Stemm. Die eine ist schon tot, und Rita ist das Salzkorn in der Ursuppe, in Auflösung begriffen. Hagen würde jetzt lachen, aber er ist weit weg.
Sie war nie mutig, so wie Hanna, und nie geduldig wie Gregor. Niemals schwindelfrei. Doch jetzt zwingt sie sich dazu, an einem Brückengeländer zu stehen und tief nach unten zu sehen, ins Wasser, das längst nicht so blau ist wie der Himmel, abstoßend wie jede Form von Zukunft. Der freie Wille, in die Enge getrieben. Das Leben besteht aus Zahlen, und jetzt sind es nur noch zwei Schritte, ein großer und ein kleiner. Es ist doch ganz einfach. Wenn es dir gefällt: lebe. Wenn nicht, zähle eins und eins zusammen – und spring.