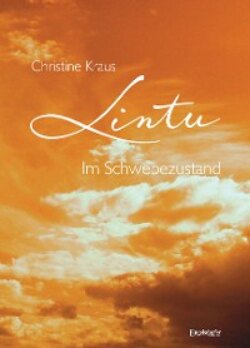Читать книгу Lintu - Christine Kraus - Страница 6
1. Kapitel
Оглавление„Kannst du nicht schneller fahren?“, schrie ich zu Julien hinüber, während ich das Fenster auf meiner Seite herunterließ.
„Der Wagen gibt nicht mehr her“, rief er zurück, trat trotzdem fester auf das Gaspedal, den Blick konzentriert auf die Straße gerichtet. Die alte Schüssel, die er fuhr, war eben nur für Familienausflüge geeignet, nicht für Verfolgungsjagden.
Wir waren bestimmt schon zehn Minuten aus der Stadt draußen und rasten auf der dunklen Landstraße mit hundertsechzig Sachen hinter den Verbrechern her, die Frau Schmidt überfallen hatten – meine Frau Schmidt, die liebenswerteste, klügste alte Dame der Welt. Der Abstand wurde immer größer und wir liefen Gefahr, den Wagen vor uns zu verlieren. Das durfte auf keinen Fall geschehen. Erstens hatte ich eine Mordswut auf die Typen und zweitens wollte ich unbedingt wissen, was sie bei ihr gesucht hatten – auch wenn fraglich war, ob sie das ausgerechnet mir anvertrauen würden. Ich schnallte mich ab und rutschte auf dem Sitz Richtung Fenster. Julien registrierte meine Bewegung und rief: „Elli, was machst du?“
Bestürzung lag in seiner Stimme, aber darum konnte ich mich jetzt nicht kümmern. Es musste etwas geschehen, bevor uns die Situation entglitt! Ich hielt mich mit beiden Händen an der Fensteröffnung fest, machte mich leicht und hechtete hinaus. Der Fahrtwind warf mich ein paar Meter zurück, doch ich fing mich rasch und schoss nach vorn über Juliens Wagen hinweg auf das Auto der Verbrecher zu.
Ich musste sie vorhin überrascht haben, denn sie hatten mich über den Haufen gerannt, als ich das Haus, in dem Frau Schmidt ihren Buchladen hatte, durch die Hintertür betreten wollte. Bis ich mich wieder aufgerappelt hatte, waren sie um die Ecke verschwunden. Ich hatte gehört, wie ein Auto anfuhr, und Julien angerufen, während ich in das kleine Lager des Buchladens gestürmt war. Es war total verwüstet. Und Frau Schmidt mitten im Chaos reglos auf dem Boden. Gerade als mich eine Panikattacke erfassen wollte, hatte sie die Augen geöffnet und gemurmelt: „Es ist alles gut, Elli, ruf mir nur einen Krankenwagen …“
Ich war losgerannt – ohne zu wissen, warum eigentlich. Es fühlte sich alles irgendwie gefährlich an und ich hatte Angst um Frau Schmidt. Julien war mit seiner Kiste um die Ecke geschaukelt, ich war in den Wagen gesprungen und wir hatten die Verfolgung aufgenommen. Während wir durch die Straßen gekurvt waren, um die Spur der Verbrecher zu finden, hatte er den Krankenwagen gerufen und seine Kollegen informiert. Julien war Polizist, Kriminalkommissar, besser gesagt. Aber eben noch war er privat unterwegs gewesen. Verabredet mit mir, bei Frau Schmidt. Oh, nicht daran denken jetzt, Elli, sonst wird das hier nichts …
Ich hatte das Auto erreicht, flog mit gleicher Geschwindigkeit über ihm her und warf mich dann quer auf die Windschutzscheibe. Hoffte, sie würden vor Schreck ins Schleudern geraten, doch das passierte leider nicht. Der Fahrer zuckte zwar zusammen, blieb dann aber erstaunlich ruhig und starrte mich böse an. Obwohl er nichts mehr sehen konnte, ging er nicht mit dem Tempo runter.
Er hatte einen fast viereckigen Schädel, kurze Haare und helle Augen, soweit das in der Dunkelheit zu erkennen war. Auf dem Beifahrersitz saß ein zweiter Mann, sonst befand sich niemand im Wagen. Sein Gesicht konnte ich aus meiner Position nicht genau sehen, nur, dass er kahl rasiert war und nicht viel älter sein konnte als ich. Wie aus einem Fernsehkrimi die beiden, das reinste Klischee.
Der Kahlkopf schrie irgendetwas und versuchte, dem Fahrer ins Lenkrad zu greifen. Der bellte zurück, und der Kahlkopf zog die Hände wieder ein. Dann ließ der Quadratschädel das Fenster herunter und angelte nach mir, während er weiterfuhr, als könne er durch mich hindurchsehen. Ich rutschte ein Stück Richtung Beifahrer, doch der hatte inzwischen auch den Arm draußen. Es wurde verdammt eng auf der Windschutzscheibe. Fieberhaft überlegte ich, was ich tun könnte. Währenddessen gelang es dem Fahrer, an mir vorbei auf die Straße zu schauen. Er grinste triumphierend. Das machte mich noch wütender, als ich sowieso schon war, und ich bewegte mich schnell wieder ein Stück auf ihn zu. Leider hatte ich seine Reichweite unterschätzt. Seine Finger krallten sich wie eine Beißzange in meine Schulter. Ich hatte das Gefühl, die Löcher, die er mir ins Fleisch grub, würden für immer bleiben. Plötzlich riss er an mir, als wollte er mich in den Wagen zerren. Das hätte er besser nicht getan.
Für einen kurzen Moment trübte ein roter Schleier meinen Blick, dann wurde es eiskalt in mir. Ich löste mich von der Scheibe und ließ mich vom Fahrtwind zurückwerfen. Selbst wenn er gewollt hätte, hätte der Quadratschädel mich nicht mehr loslassen können. Im nächsten Augenblick war ein scheußliches Geräusch zu hören. Sein Arm war entweder gebrochen oder ausgekugelt. Jedenfalls hing er schlaff aus dem Fenster und ich war frei. Sicherheitshalber ließ ich mich erst einmal hinter den Wagen fallen und beobachtete die beiden. Der Kahlkopf lenkte jetzt, während der Quadratschädel fluchend versuchte, den verletzten Arm ins Wageninnere zu ziehen. Dabei stand er weiter auf dem Gaspedal und dachte offensichtlich nicht daran, langsamer zu werden. Oh Mann, ich hatte keine Ahnung, wie ich sie stoppen konnte. Doch ich war nicht gewillt aufzugeben. Dafür war meine Wut zu groß.
Julien fiel immer weiter zurück, obwohl er bestimmt aus dem Wagen herausholte, was ging. Ich warf mich noch einmal auf die Windschutzscheibe. Das musste einfach funktionieren! Die konnten nicht auf Dauer blind fahren. Jetzt wurde der Quadratschädel doch langsam nervös. Der Schmerz schien ihn zu beeinträchtigten. Trotzdem übernahm er mit der rechten Hand wieder das Steuer. Der Kahlkopf hatte auf einmal einen Schlagstock in der Hand, lehnte sich aus dem Fenster und schlug nach mir. Diesmal war ich in einer besseren Position – und vorsichtiger obendrein. Ich hockte mich komplett vor den Fahrer und wich den Schlägen des Beifahrers aus. Er traf nur die Windschutzscheibe. Dann versuchte er, sich aus dem Fenster zu lehnen – und wäre fast rausgefallen. Nachdem er so nichts ausrichten konnte, schleuderte er den Stock nach mir. So ein Idiot! Was er sich davon wohl versprochen hatte? Ganz gewiss hatte er nicht damit gerechnet, dass ich den Stock fangen würde. Ich übrigens auch nicht. Tat ich aber. Der Fahrtwind bremste seine Wucht und irgendeine Geistesgegenwart ließ mich nach ihm schnappen.
Na gut, dann war er jetzt dran. Er hatte es so gewollt. Ich legte mich wieder der Länge nach auf die Scheibe, ließ die Füße auf der Fahrerseite überhängen. Der Quadratschädel konnte nichts mehr sehen, selbst wenn er den Kopf aus dem Fenster hinge. Und der Kahlkopf hatte keine Chance, denn ich hielt den Schlagstock wie ein Skorpion seinen aufgerichteten Stachel, bereit zuzuschlagen, wenn er auch nur ein Körperteil aus dem Fenster streckte. Jetzt brauchte ich nur noch zu warten. Irgendwann musste eine Kurve kommen, die sie aus der Spur brachte. Ich hatte kein Mitleid mit diesen … mir fiel nicht ein einziges Schimpfwort ein, das schlimm genug gewesen wäre. Dabei ratterten in meinem Gehirn ununterbrochen Verwünschungen der ärgsten Sorte. Der Quadratschädel schaltete in seiner Verzweiflung die Scheibenwischer ein. Darüber hätte ich fast gelacht. Er fuhr jetzt langsamer, Julien konnte endlich aufholen. Eine Kurve tauchte nicht auf, doch Julien kam so weit heran, dass er in die Reifen schießen konnte. Der Wagen schlingerte.
Das Schlingern beunruhigte mich nicht. Wenn es darauf ankam, konnte ich jederzeit nach oben weg. Die Schüsse jedoch waren besorgniserregend – selbst wenn ich Julien unterstellte, dass er wusste, wohin er zielte. Das hier war kein Fernsehkrimi. Das war ernst. Besser, ich verzog mich hinter beide Wagen, aus der Schusslinie heraus. Ich hoffte inständig, dass wir mit den Typen fertig werden würden, wenn die Autos endlich zum Stehen kämen. Hielt den Schlagstock fest in den Händen, um einspringen zu können, falls Julien die Munition ausging.
Der Wagen der Verbrecher beschleunigte wieder, geriet dann aber endgültig ins Schleudern und schoss über den Seitenstreifen in den Wald hinein. Nach ein paar Metern Hoppelpiste, die ihn entscheidend abbremsten, blieb er zwischen zwei jungen Bäumen hängen. Leider überlebten die Bäumchen den Aufprall nicht. Sie knickten ab, das Auto fuhr noch über die schrägstehenden Stämme und krachte einige Meter weiter gegen einen Baum. Beide Männer durchbrachen die Windschutzscheibe und blieben bewusstlos auf der Kühlerhaube liegen. Ich hockte mich in sicherer Entfernung auf einen Baum und wartete auf Julien, ohne die beiden aus den Augen zu lassen. Mein Herz raste und vor Aufregung bekam ich kaum Luft. Julien brauchte eine ordentliche Strecke, bis sein Wagen so langsam war, dass er ihn wenden konnte. Doch dann legte er mit quietschenden Reifen und gezückter Pistole ganz filmheldisch seinen Auftritt hin.
Endlich, endlich legte er den Typen Handschellen an – hatte man als Kriminalkommissar eigentlich immer die passende Anzahl Handschellen dabei? Ja, das war jetzt mal eine ganz wichtige Frage. Sarkasmus gehörte normalerweise nicht zu meinem Repertoire, schon gar nicht Julien gegenüber. Wahrscheinlich war das die Anspannung. Ich war ganz schön durch den Wind. Von einer Sekunde auf die andere brach mein heiliger Zorn zusammen und Verzweiflung wollte mich überkommen.
Julien telefonierte – wahrscheinlich mit seinen Kollegen – und sah sich nach mir um. Leise sprang ich vom Baum. Eigentlich war es mehr ein Schweben, doch ich ließ es aussehen wie einen Sprung, denn ich war plötzlich befangen, Julien alles zu zeigen, was ich konnte. Er hatte schon viel zu viel gesehen. Während ich auf ihn zulief, setzte er zum Reden an. Seine Miene verhieß nichts Gutes, deshalb ließ ich ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Bevor ich mir anhören wollte, was er zu sagen hatte, musste ich wissen, wie es Frau Schmidt ging. Der Schock, den mir der Anblick ihrer reglosen Gestalt versetzt hatte, saß mir tief in den Knochen.
„Was ist mit Frau Schmidt? Weißt du, in welchem Krankenhaus sie liegt? Hat dir jemand Bescheid gesagt? Wie geht es ihr?“ Die ersten beiden Fragen hatte ich ihm noch im Laufen zugerufen, jetzt war ich bei ihm angelangt und pflanzte mich vor ihm auf.
Julien hörte einen Augenblick auf, mich anzufunkeln, sein Blick wurde weich. „Es geht ihr einigermaßen. Sie hat Prellungen und blaue Flecke, keine größeren Verletzungen, aber einen Kreislaufkollaps. Sie haben sie stabilisiert. Wir können nachher noch bei ihr vorbeifahren.“
Ich war so erleichtert, dass ich ihn am liebsten umarmt hätte. Doch sein funkelnder Blick war zurückgekehrt und ich wurde vorsichtig. Wartete ab. Er atmete mächtig Luft in seine Brust – er machte Bodybuilding und konnte sich ganz schön aufblasen, wenn er wollte – und sprach dann in verdächtig ruhigem Tonfall: „So, junge Dame, und jetzt zu dir.“
„Junge Dame“ sagte er üblicherweise zu seiner kleinen Tochter, wenn sie etwas angestellt hatte. Ich hätte beleidigt sein können, schließlich war ich zweiundzwanzig und hatte ihm gerade geholfen, ein paar ganz fiese Mistkerle zur Strecke zu bringen.
„Kannst du mir bitte erklären, was du da eben gemacht hast?“ Seine Betonung des Wörtchens „bitte“ ließ keinen Zweifel an der Unausweichlichkeit einer ausführlichen Antwort.
Ich setzte trotzdem meinen unschuldigsten Blick auf und versuchte es mit: „Vom Baum gesprungen? Verbrecher gefangen?“
„Du weißt genau, was ich meine, Elli – was war das? Wie hast du das gemacht? Bist du Superwoman oder was? Von deinen Kunststücken abgesehen“, er kam langsam in Fahrt, „hätten die auf dich schießen können. Und du hast dem einen fast den Arm abgerissen! Schon mal darüber nachgedacht, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben und nicht mit Figuren aus irgendeinem Computerspiel? Das ist vorsätzliche Körperverletzung!“
Vorsätzliche Körperverletzung? Computerspiel? Was redete er da? Ich hatte zwei Verbrecher bekämpft, die meine geliebte Frau Schmidt überfallen hatten! Und mit uns, also mit Julien und mir, hätten die auch keine Gnade gehabt. Wieso sollte ich da … Und überhaupt spielte ich diese blöden Computerspiele gar nicht. In meinem Verstand geriet ein bisschen was durcheinander und meine Knie wurden plötzlich weich. Nie hatte ich mich so sehr im Recht gefühlt wie vorhin, als ich versucht hatte, die beiden Typen unschädlich zu machen. Sehr deutlich hörte ich den Widerspruch in mir, mit dem ich Juliens Gekeife abschmettern wollte. Doch langsam dämmerte mir auch, was ich getan hatte. Genau das, was ich sonst immer verurteilte. Wow. Wo waren meine Überzeugungen geblieben? Zum Beispiel, dass jeder Mensch das Recht auf körperliche Unversehrtheit hatte? Seit ich angefangen hatte, mich mit Politik zu beschäftigen, war ich immer froh darüber gewesen, in einem Land zu leben, in dem diese Grundsätze eine Rolle spielten. Und jetzt – hatte ich sie bei der ersten Gelegenheit über den Haufen geworfen! Gut, der Quadratschädel hatte mich angegriffen, aber ich hätte mich auch befreien können, ohne ihn zu verletzen. Und ich war bereit gewesen, die beiden bewusstlos zu schlagen. Das war Selbstjustiz. Selbstgerechtigkeit!
Unterdessen hatte sich Juliens Lautstärke erheblich gesteigert, er brüllte ohne Punkt und Komma auf mich ein. Allzu viel bekam ich nicht mit. Ich war so geschockt von der Erkenntnis, wie radikal ich gewesen war – man musste es schon „brutal“ nennen – dass sich in meinem Kopf alles zu drehen begann. Ich hörte nur noch so etwas wie: „… wohl zu viel schlechte Krimis gesehen!“, dann musste ich mich auf den Boden setzen. Meine Ohren klingelten und mir war schlecht. Ich starrte auf die Erde und versuchte, auf die Reihe zu kriegen, wie das vorhin abgelaufen war, als ich mit den Typen gekämpft hatte. Was hatte ich gedacht, was gefühlt? Erinnere dich, Elli … Das Bild von Frau Schmidt auf dem Boden, mein Entsetzen darüber tauchte auf – und da war sie wieder, die Wut! Sie stieg rasend schnell in mir auf und blieb dicht unter der Schädeldecke hängen, ich konnte kaum noch klar denken. Ruhig, Elli, ruhig, du hast deine Rache gehabt, es ist vorbei, du musst dich nur noch erinnern!
Genau …! Rache – ich hatte diesen Dreckskerlen Schmerz zufügen wollen für das, was sie Frau Schmidt angetan hatten, für den Schreck, den sie mir eingejagt hatten, dafür, dass sie meine ohnehin nicht sehr heile Welt ganz aus den Angeln gehoben hatten! Es war gewesen, als hätten sich all meine Zellen mit heißem, rotem, brodelndem Nebel gefüllt, bis in die Augenhöhlen, nur das Gehirn war kalt geblieben. Ich hatte sehr klar und sehr taktisch gedacht in dem Moment, in dem ich den Quadratschädel verletzen wollte. Das scheußliche Geräusch des kaputtgehenden Arms hatte ich mit einer kleinen Befriedigung zur Kenntnis genommen. Weiter hatte ich nicht gehen wollen, aber war nicht das schon viel zu weit? Und was wäre passiert, wenn ich den Schlagstock hätte benutzen müssen? Ich hätte zugeschlagen, keine Frage. War ich zum Monster mutiert? Oder schon immer eins gewesen?
Ich entdeckte eine Seite an mir, die ich bisher noch nicht gesehen hatte, jedenfalls nicht in diesem Extrem. Es erschütterte mich zutiefst, dass ich auch jetzt noch keine Reue den Mistkerlen gegenüber fühlte, nur darüber, dass ich etwas verraten hatte, was mir ganz selbstverständlich als mein ureigenster Wert erschienen war. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich konnte nichts mehr denken, meine Brust war sehr eng, als würde sie zusammengedrückt, und tiefe Schluchzer stiegen in mir auf. Ich wurde regelrecht geschüttelt von ihnen, bis Julien mich an den Schultern packte und nach oben zog. Auch er schüttelte mich, aber sehr sachte, und rief wie aus weiter Entfernung meinen Namen.
„Elli …! Elli, beruhige dich, hör auf, komm schon …!“ Er zog mich an seine Brust und hielt mich fest. Eine Ewigkeit. Ich spürte seine Arme um mich, seine Wärme, hörte seine Stimme jetzt deutlicher, wie sie irgendwelche beruhigenden Laute murmelte. Nahm die Bewegung seines Atems in seiner Brust wahr, und dann nahm ich meinen eigenen Atem wahr und wurde tatsächlich ruhig.
Ich weinte nicht mehr. Hielt die Augen geschlossen und ließ meinen Kopf einfach auf seiner Brust liegen. Sanft schob er mich ein Stück von sich weg, um mir ins Gesicht zu schauen, und sagte leise und schnell: „Die Verstärkung und der Krankenwagen sind in ein paar Minuten da. Du musst dich wieder hinkriegen, sonst nehmen sie dich auch gleich mit.“
Erschrocken schaute ich ihn an.
„Die Sanitäter, meine ich, nicht die Kollegen.“
„Es tut mir so leid, Julien, ich weiß nicht –“
Er unterbrach mich.
„Wir reden später darüber, jetzt müssen wir dich erst mal zurechtmachen und absprechen, was wir über den Hergang sagen.“
Mein Gehirn arbeitete immer noch verlangsamt, ich hatte keine Ahnung, worauf er hinaus wollte.
„Naja, wir können schließlich nicht sagen, dass du hinter ihrem Wagen hergeflogen bist. Also: Wir haben sie verfolgt und aufgeholt, ich habe in die Reifen geschossen, dann sind sie in den Wald gerast. Mehr ist nicht passiert.“
„Aber die beiden werden –“
„Gar nichts werden die. Die werden sich hüten, davon zu reden. Das würde doch nie jemand glauben. Die würden sich total lächerlich machen, und die Kollegen würden ziemlich sauer reagieren. Aber“, er schaute mir sehr ernst in die Augen, „du weißt schon, dass du dir Feinde für den Rest deines Lebens gemacht hast. Feinde, die etwas von dir wissen, was sie besser nicht gewusst hätten.“
Ich nickte stumm. War total niedergeschlagen. Am liebsten hätte ich mich irgendwohin verkrochen und noch ein bisschen geheult. Doch von ferne waren schon die Sirenen zu hören.
„Wir müssen dich jetzt wieder herrichten“, sagte Julien und fing an, meine Klamotten zurechtzurücken.
Ich schaute an mir herunter. Oh weh, ich war von dem Kampf total dreckig. Wir wischten und klopften zu zweit an mir herum, ich versuchte, mir mit den Fingern die Haare zu kämmen und rieb mit den Händen mein Gesicht ab.
Julien betrachtete mich kurz und nickte. „So gehts“, meinte er, keinen Moment zu früh. Drei Fahrzeuge hielten, die Insassen stürzten an den Unfallort. Dann war vom Unfallwagen her ein Geräusch zu hören. Julien hatte sofort die Pistole im Anschlag, er raunte mir zu: „Zieh dich mal ein bisschen zurück, vielleicht haben die dich nicht gut gesehen im Dunkeln“, und rannte zum Wagen hinüber.
Der Quadratschädel regte sich und hob den Kopf. Ich verschwand zwischen den Bäumen und beobachtete das weitere Geschehen von dort aus. Zwei Polizisten liefen zusammen mit den Sanitätern zu den Verletzten, zwei andere begannen mit der Untersuchung des Unfallortes. Die Verbrecher wurden in den Krankenwagen bugsiert. Während der Quadratschädel sich widerwillig zwischen den Sanitätern bewegte, sah er sich immerfort um. Es schien, als würde er tatsächlich nach mir suchen. Der Kahlkopf war noch immer bewusstlos.
Als die Gefangenen verstaut waren, sprachen die beiden Polizisten mit Julien. Sie notierten seine Aussage. Er zeigte auf mich und ich trat zwischen den Bäumen hervor, achtete darauf, dass ich vom Krankenwagen aus nicht gesehen werden konnte. Julien beruhigte mich, als ich neben ihm stand. „Er liegt“, flüsterte er kurz, „er kann dich unmöglich sehen.“
Ich atmete auf. Einer seiner Kollegen nahm meine Personalien auf und befragte mich zum Tathergang. Ich wunderte mich, dass er sich nicht wunderte, was ich hier machte. Julien musste bereits eine gute Begründung geliefert haben. Also antwortete ich so unpräzise wie möglich, um ihm nicht ins Handwerk zu pfuschen. Der Kollege gab sich zufrieden, anscheinend genügte ihm die Aussage von Julien. Der war schließlich ein Vorgesetzter. Ein paar Minuten später konnten wir gehen. Julien nahm mich am Arm.
„Auf ins Krankenhaus“, sagte er, sprang in seinen Wagen und fuhr los, kaum, dass ich die Beifahrertür geschlossen hatte. Es sah so aus, als wollte er so schnell wie möglich vom Unfallort wegkommen. Als ich ihn fragend ansah, nickte er.
„Der, der wach geworden ist, kommt mir verdammt bekannt vor. Ich will noch in die Kartei gehen, den habe ich irgendwie unter ,gefährlich‘ abgespeichert.“
Ich wäre gern mit aufs Revier gekommen, um mir mit Julien die Kartei anzusehen, doch er lehnte ab. „Übertreib’s nicht, Elli. Ich glaube, es reicht für heute.“
„Wieso? Ich könnte dir helfen, ihn zu identifizieren.“
„Das krieg ich schon noch allein hin.“ Damit war die Diskussion beendet. Ich kannte Julien lange genug, um zu wissen, wann ich aufhören musste. Vermutlich reichte es ihm selbst auch – mit mir.
Im Krankenhaus konnten wir nur die Nachtschwester sprechen, die Patienten schliefen alle, klar. Frau Schmidt lag nicht mehr auf der Intensivstation, das beruhigte mich. Die Nachtschwester war sehr nett und ging extra noch einmal nach ihr schauen. Als sie wiederkam, lächelte sie. „Sie schläft so friedlich, als wäre sie im Urlaub.“ Damit musste ich mich wohl für heute begnügen.
Julien bestand darauf, mich nach Hause zu bringen, obwohl ich lieber geflogen wäre. Ich wollte das Thema aber dann doch nicht mehr anschneiden. Hätte mir allerdings denken können, dass Julien sich nicht so einfach zufrieden gab. Er nötigte mir das Versprechen ab, ihm am nächsten Morgen alles, aber auch restlos alles zu erklären. Wir verabredeten uns zum Frühstück in seinem Lieblingscafé, und er brauste davon. Es war schon so spät, dass nicht zu befürchten war, es würde jemand im Treppenhaus herumspazieren, also schoss ich die Treppen im Dunkeln nach oben in den elften Stock, wo meine Wohnung lag. Als ich die Tür hinter mir schloss, stiegen mir schlagartig Tränen in die Augen. Nun merkte ich doch, wie angespannt ich die ganze Zeit gewesen war. Dusche und Bett, mehr verkraftete ich jetzt nicht mehr. Julien hatte recht gehabt. Ich hatte genug. Auf dem Weg zum Bad zerrte ich mir die Klamotten vom Körper, konnte plötzlich kaum noch erwarten, warmes Wasser auf der Haut zu spüren. Heißes Wasser eigentlich, fast an der Schmerzgrenze. Ich wollte am liebsten die ganze Aufregung des heutigen Abends von mir abspülen – natürlich ohne Erfolg.
All die Menschen schwirrten in meinem Kopf herum – Frau Schmidt, die Verbrecher, Julien, seine Kollegenmannschaft. Alles wuselte durcheinander und formte sich zu neuen, skurrilen Bildern und ich immer mittendrin, fliegend, wütend. Ich brachte keinen klaren Gedanken zustande. Hätte diese Dusche mich nicht einfach entspannen können? Resigniert stellte ich das Wasser ab, brachte meine Abendtoilette zu Ende und kroch in meinem gemütlichsten Schlafanzug ins Bett. Obwohl an Schlaf nicht zu denken war, wenn ich es nicht schaffte, mich zu beruhigen. Ich versuchte, meinem Atem zu folgen, wie er sich in meinem Körper ausbreitete. Nichts weiter. Nur atmen. Dann konzentrierte ich mich auf die Empfindung meiner Arme und Beine. Atem, Arme, Beine – nur das. Später den restlichen Körper dazu, atmen, empfinden. Langsam wurde es stiller in mir.
Ich dachte an Julien. Nur an Julien. Alle anderen Personen sperrte ich aus. Sie waren mit zu vielen verwirrenden Bildern verknüpft. Julien war verlässlich. Er war heute so gewesen wie immer und würde es auch morgen sein. Bis auf die Tatsache, dass er seit ein paar Stunden mein Geheimnis kannte. Morgen würde ich ihm alles erzählen müssen, und deswegen war es gut, jetzt noch ein bisschen an ihn zu denken. Mir in Erinnerung zu rufen, was ich von ihm wusste. Wie ich meine Erklärung so gestalten konnte, dass er sie verstand.
Ich kannte Julien jetzt gut ein Jahr. Wir waren uns in einem Seminar zur Kriminalliteratur begegnet. Ich studierte Sprachen und arbeitete mich nebenbei durch alle angebotenen Genres in der Literaturabteilung, denn eigentlich träumte ich davon, Schriftstellerin zu werden. Julien war Hauptkommissar bei der hiesigen Kripo und wollte ebenfalls schreiben. Einem echten Kommissar zu begegnen, fand ich sehr spannend. Mein ganzes Wissen über das Innere eines Polizeireviers stammte aus Kriminalfilmen und jetzt hatte ich ein lebendes Exemplar vor mir. Ich fragte und fragte und fragte. Julien war der geduldigste Antworter, den ich je kennengelernt hatte. Vielleicht lag es einfach daran, dass er seinen Beruf über alles liebte – nicht ganz so wie seine kleine Tochter und seinen Freund, aber genug, um mir mit Begeisterung auch nach Stunden noch ausführlich zu antworten.
Wir hatten von Anfang an ein Faible füreinander und trafen uns auch noch, nachdem das Seminar beendet war. Ich lernte Juliens Familie kennen: seine Tochter Martha, seinen Freund Gus. Martha sah aus wie eine Miniaturausgabe von Julien mit längeren Haaren. Sie war gerade in die Schule gekommen. Gus hieß eigentlich Gustav, doch so durfte ihn niemand nennen, nur Martha, wenn sie sauer auf ihn war. Das kam allerdings nicht sehr oft vor, denn Gus lag Martha zu Füßen. Er war originell, fantasievoll und sehr einfallsreich, wenn es darum ging, das Kind bei Laune zu halten. Er hatte Martha sein gesamtes Schlagerrepertoire beigebracht – das ungefähr dreißig Jahre umfasste. Natürlich wollte Martha Schlagersängerin werden. Und sie hatte beschlossen, niemals zu heiraten, sondern immer bei Papa und Gus zu wohnen.
Marthas Mutter fuhr zur See. Als sie schwanger geworden war, hatten Julien und sie versucht, eine normale Familie zu sein. Nach zwei Jahren hatten sie sich geeinigt, dass Martha bei Julien bleiben sollte, und sie war wieder losgezogen. Ungefähr zur selben Zeit, als Julien Gus kennenlernte und entdeckte, dass er eigentlich auf Männer stand, war sie zu Greenpeace gegangen. Martha war gerade drei geworden. „Ich bin nun mal kein Muttertier, aber ich liebe meine Tochter und kann auf diese Weise etwas für sie tun“, hatte sie ihm von dem Schiff, auf dem sie unterwegs war, geschrieben. Julien hatte mir das erzählt, weil Martha eines Tages auf dem Spielplatz auf die Frage nach ihrer Mutter stolz geantwortet hatte: „Meine Mama ist kein Muttertier, sie ist Seefahrerin.“ Wie sie diesen Ausdruck aufgeschnappt haben konnte, war ihm bis heute ein Rätsel geblieben. Jedenfalls hatte Martha Papa, „mein Gus“ und Mama. Und seit einem Jahr auch noch „meine Elli“. Hin und wieder passte ich nämlich auf sie auf, wenn Papa und Gus mal ausgehen wollten.
Julien war fünfunddreißig, groß und schlank, hatte hellbraune, kurze Locken, dunkelgraue Augen und ein unglaublich warmes Lächeln. Er war einfühlsam, intelligent und ein bisschen draufgängerisch. Er hatte eine nicht zu verstehende Vorliebe für locker sitzende Cordhosen – sehr zum Leidwesen von Gus und mir, weil sie seine wirklich gute Figur überhaupt nicht zur Geltung brachten. Nur zum Ausgehen brezelte er sich auf. Manchmal sah er so umwerfend aus, dass Martha, Gus und ich uns einig waren, den schönsten Mann der Welt zu kennen. Julien war mein bester Freund, aber zum Glück war er nicht mein Typ. Keine Probleme also.
Ich fragte mich oft, wer denn eigentlich mein Typ sei, denn bisher war ich ihm noch nicht über den Weg gelaufen. Mein Liebesleben entsprach dem einer Nonnenanwärterin. Nicht, dass es mich sonderlich gestört hätte, meistens war ich zu beschäftigt mit studieren, schreiben, bei Frau Schmidt rumhängen – und natürlich jede Nacht ein paar Stunden fliegen. Und dann hatte ich ja noch Julien, Martha und Gus. Nur manchmal, wenn ich an meine Zukunft dachte, kam es mir komisch vor, dass ich keine Vorstellung davon hatte, wie ich überhaupt eine Beziehung führen könnte mit einem normalen Mann. Ich hätte mir gewünscht, jemanden zu finden, der auch flog. Wie sollte das denn sonst gehen – mit einem Mann, der es nicht konnte? Ihn einweihen? Ihn jede Nacht verlassen, um allein herumzufliegen? Vielleicht würde ein normaler Mann ja wollen, dass ich es aufgäbe. Das ginge schon mal gar nicht. So drehten sich meine Gedanken immer im Kreis, bis ich ärgerlich auf mich selbst wurde und diesen Quatsch einfach sein ließ. Normale Männer waren also nicht so interessant für mich wie ich für sie. Allzu häufig musste ich allerdings keinen abwimmeln. Ich galt als unnahbar.
Tja, jemanden, der fliegen konnte, hatte ich bis jetzt noch nicht getroffen. Deshalb fühlte ich mich manchmal einsam. Dass ich es konnte, wusste auch keiner. Außer meinen Eltern. Und jetzt Julien. Noch nicht mal meine kleine Schwester wusste es. Bei diesem Gedanken wurde ich traurig, wie immer, wenn ich an sie dachte. Da ich das gerade am allerwenigsten gebrauchen konnte, konzentrierte ich mich schnell wieder auf meinen Atem. Ich war ziemlich abgeschweift von Julien und meiner Erklärung. Aber heute fiel mir nichts mehr ein. Es wurde auch bald hell, ich sollte jetzt doch noch ein wenig schlafen. Probehalber schloss ich die Augen, merkte auf einmal, wie müde ich war, und vergrub mich in meiner weichen Bettdecke.
Der Kampf mit den Verbrechern verfolgte mich bis in meine Träume. Diesmal waren es viele. Sie waren mir alle unbekannt, man hatte mir nur gesagt, sie seien Verbrecher und verdienten Strafe. Ich war absolut skrupellos und blutrünstig und in meinem Zorn ihnen allen überlegen. Körperteile flogen durch die Gegend und sehr viel Blut spritzte. Ich war die personifizierte Raserei und ununterbrochen am schreien. Davon wachte ich dann auf. Meine Kehle war rau, als ob ich tatsächlich geschrien hätte. Erleichtert bestätigte ich mir selbst, dass es nur ein Traum gewesen war. So wollte ich mich im echten Leben niemals fühlen.
Der Aufenthalt im Bett hatte mich eher erschöpft als erfrischt. Es hieß ja, dass man über gewisse Dinge eine Nacht schlafen solle. Damit war bestimmt kein Abend wie mein gestriger gemeint. Ich war immer noch durcheinander. Das bisschen Schlaf und der Traum hatten es nicht besser gemacht.
Im Dämmerlicht des neuen Tages ließ ich den Blick über meine wenigen Möbel schweifen. Meine Wohnung war sehr übersichtlich, ein Zimmer, eine kleine Küche, ein Bad und ein winziger Balkon. Gute Start- und Landebahn. Die Einrichtung war eher zweckmäßig als gemütlich. Ich brauchte Bewegungsfreiheit und hatte fast keine Deko, damit ich beim Herumschweben nichts herunterwerfen konnte. Ich übte oft, mich zu beamen, wie ich es nannte. Dabei schwebte ich, so schnell es ging, von einer Stelle in der Wohnung zur anderen. Je nachdem, wie weit diese Stellen auseinanderlagen und ob noch eine Tür dazwischen war, nahm ich schon mal etwas mit. Damit das Gefühl aufkommen konnte, ich hätte mich dematerialisiert und wieder materialisiert, musste ich wirklich sehr schnell sein. Keine Ahnung, warum ich da so einen Ehrgeiz hatte. Konnte es ja doch niemandem zeigen. Aber ich übte es trotzdem. Es machte Spaß.
Langsam ließen die schrecklichen Bilder und der unsägliche Zorn aus meinem Traum nach. Ich wurde wieder normal. Machte mir einen Tee und zog frische Sachen an. Große Auswahl hatte ich nicht. Eng anliegende Hosen, T-Shirts und Pullover. Das weite Zeug knatterte zu laut beim Fliegen. Ich konnte dann nicht so gut hören, wurde aber von anderen gehört. Also hatte ich hauptsächlich enge Kleidung. In gedeckten Farben, am liebsten blau und grün. Passte ganz gut zu meinen Haaren und Augen. Augen blaugrüngrau, Haare irgendwo zwischen blond und hellbraun. Aschblond nannte meine Mutter die Farbe. Arschblond meine kleine Schwester. Grinsend. Gelb, orange, rot und andere leuchtende Farben gab es bei mir höchstens als Accessoires, die ich schnell ablegen konnte, nur für den Fall.
Wenn ich nachts flog, trug ich einen dunkelblauen Radrennanzug. Ein wunderbar windschlüpfriges Modell. Ich hatte noch einen silbergrauen für tagsüber. Den hatte ich in der Regel unter meinen Klamotten an – wenn es nicht gerade so heiß war wie in den letzten Tagen. Meine Schuhe waren immer flach, immer dunkel, immer biegsam. Mit steifen Sohlen in einem Baum herumturnen ging nun einmal nicht. Für den Winter hatte ich Hirschlederstiefel aufgetan, die waren zwar sündhaft teuer, aber unvergleichlich geschmeidig. Bei guter Pflege hielten sie ein paar Jahre, jetzt, wo ich nicht mehr größer wurde. Außerdem brauchte ich kein Auto, deshalb konnte ich mir alle paar Jahre diesen Luxus leisten.
Mein Magen knurrte. Bevor ich mich mit Julien traf, wollte ich noch bei Frau Schmidt vorbei, also steckte ich mir einen Müsliriegel für unterwegs ein. In dieser Hinsicht kam ich mir schon manchmal vor, als stamme ich von Vögeln ab. Von körnerfressenden allerdings. Mit allem, was körnig war, war ich sehr leicht zufriedenzustellen. Passte gut, Müsliriegel gab es an jedem Kiosk.
Ich klemmte das Skateboard unter den Arm, nahm wie üblich das Treppenhaus. Niemand zu hören, also sauste ich in einem Schwung nach unten. War fast angekommen, als mein Handy klingelte. Das konnte ich ja überhaupt nicht leiden. Meistens hatte ich es gar nicht an, damit es mich nicht verriet, wenn ich gerade in der Luft war. Oder in einer Situation wie jetzt zum Beispiel. Heute hatte ich es angeschaltet – wegen Julien und Frau Schmidt. Ich stoppte abrupt und lief den Rest der Treppe zu Fuß, während ich in meiner Tasche nach dem Handy kramte. Es war Rumina, eine Kommilitonin, mit der ich gemeinsam ein Referat schrieb. Sie klang aufgelöst.
„Elli, kannst du deinen Laptop mitbringen? Meiner hat gerade den Geist aufgegeben. Der ganze Text ist futsch!“ Sie redete noch weiter, doch ich hörte gar nicht hin. Mist, vor lauter Überfall hatte ich ganz vergessen, dass ich mit ihr verabredet war.
„Elli, du hast ihn doch gespeichert, oder? Auf deinem Laptop?“ Rumina klang besorgt.
„Eh, ja, klar, ich hatte nur vergessen, dass wir verabredet waren. Bei mir ist was passiert, ich kann heute nicht.“
„Du weißt aber schon, dass wir morgen dran sind mit dem Referat?“ Jetzt war sie aufgebracht.
„Rumina, sorry, ich hab echt grad andere Sorgen. Kannst du das Referat nicht allein halten? Sag einfach, ich bin krank geworden. Bitte! Ich bring dir auch meinen Laptop vorbei, aber ich kann wirklich nicht.“
Ich war schon wieder auf dem Weg nach oben. Sprang halb schwebend die Treppen hinauf, mit einem Ohr am Hörer und mit dem anderen bei den Umgebungsgeräuschen. Zum Glück war Rumina zurückhaltend genug, um nicht weiterzufragen. Wir kannten uns nicht besonders gut, hatten nur ein paar Seminare gemeinsam. Sie wirkte beleidigt, doch das konnte ich jetzt nicht ändern. Oben in der Wohnung stopfte ich den Laptop in die Tasche und sauste wieder los. Wenn ich noch bei Rumina vorbeiwollte, musste ich mich beeilen. Trotzdem hielt ich unten vor der Tür einen Augenblick inne. Ich hatte zu viel erlebt seit gestern, um gedankenlos in das Hamsterrad einzusteigen. Es war noch früh, die Luft war morgendlich frisch, der Himmel jetzt schon strahlend blau. Der Tag versprach, heiß zu werden. Ein Julitag, wie man ihn sich vorstellte. Ich nahm einen tiefen Atemzug voll Sommerluft. Die Vögel zwitscherten aus Leibeskräften.
Mein Hochhaus stand in einer Wohnblocksiedlung am Stadtrand. Nur wenige Meter vom Haus entfernt begann ein schmaler Streifen Wald. Weil die Bäume des Waldstreifens nicht bis hoch in den elften Stock ragten, waren die Vögel dort kaum zu hören, nur wenn sie alle zusammen loslegten oder ich im Schwebezustand war. Das war das Einzige, was ich da oben vermisste. Mein Balkon zeigte zum Wald hin. Wenn ich von hier aus losflog, musste ich nur ein paar Meter an der Fassade nach unten schweben und konnte dann die kurze Strecke bis zu den ersten Bäumen in gerader Linie sehr schnell zurücklegen.
Ich sprang auf das Skateboard und raste los. Das Board war mein Alltagsfahrzeug. Es hatte nur Alibifunktion, eigentlich schwebte ich in aufrechter Haltung und sorgte dafür, dass das rollende Board unter meinen Füßen blieb. In belebten Gegenden hatte ich mich sogar schon ohne Board so bewegt. Da die meisten Leute nicht genau guckten, fiel es gar nicht auf, und wenn einer mal hinsah, war ich meistens schon weg, bevor er sich die Frage stellte, ob er sich getäuscht hatte oder nicht. Ohnehin hatte ich immer unauffällige, möglichst kleine Boards, da sie nicht wirklich etwas leisten mussten, außer gut in meinen Rucksack zu passen, wenn ich flog. Gelegentlich hatte ich sogar eines zurücklassen müssen.
Bei den echten Skatern hatte ich mir die Tricks abgeguckt, die ich brauchte, um nicht aufzufallen. Leider konnte ich das Board genauso wenig unter den Füßen halten wie sie, wenn ich ungeschickt war. Verbinden konnte ich mich nur mit Lebewesen, nicht mit Material. Ich versuchte es immer wieder, doch bis jetzt war es mir noch nicht gelungen. Nur manchmal bildete ich mir ein, es für einen kurzen Augenblick geschafft zu haben. Dummerweise ließ es sich nie wiederholen.
Ich fuhr sehr gern sehr schnell. Wenn niemand auf der Straße war, gab ich richtig Gas. Musste mich nur zusammennehmen, wenn ich gesehen wurde. Allerdings hatte ich im Schwebezustand auch eine recht passable Reaktionszeit, abgesehen davon, dass meine Sinne dann besser funktionierten als sonst. Deshalb machte ich mir nie allzu viele Gedanken, wenn ich losraste. Bisher hatte es noch immer geklappt, rasch auf Normalgeschwindigkeit zu gehen und typische Skaterbewegungen zu machen, wenn jemand auftauchte.
Bei Rumina hielt ich mich nicht lange auf. Sie konnte nicht verstehen, warum ich sie im Stich ließ und ich wollte es nicht erklären. Wusste doch selbst nicht genau, was los war. Trotz des Umwegs war ich ziemlich schnell am Krankenhaus und hüpfte vom Board. Ließ es in meinen Arm springen, während ich weiterlief. Diesen Auftritt liebte ich, besonders, weil er in Skateraugen ungemein lässig aussah und ich manchmal meine Freude daran hatte, damit anzugeben – wenn ich mich sonst schon immer zurückhalten musste mit meinen eigentlichen Fähigkeiten.
Frau Schmidt war wach und sah mich unergründlich an, als ich zur Tür hereinkam. Sie wirkte zerbrechlich in ihrem Bett, obwohl sie sonst immer eine sehr starke Ausstrahlung hatte. So, als könnte ihr niemand etwas anhaben. So, als hätte sie schon alles erlebt, was es an Herausforderungen anzunehmen gab. Der Überfall schien sie wirklich mitgenommen zu haben. Zur Begrüßung fragte sie mit rauer Stimme: „Wo hast du deinen Kommissar gelassen? Will er nicht meine Aussage aufnehmen?“
„Dein Kommissar“, so nannte sie Julien. Ich hatte den Eindruck, dass sie Vertreter der Staatsgewalt im Allgemeinen nicht besonders mochte. Julien konnte sie allerdings gut leiden.
„Wir kommen nachher nochmal zusammen“, antwortete ich und schlug die Augen nieder, „habs nicht ausgehalten, so lange zu warten, ich musste einfach wissen, wie es Ihnen geht.“ Plötzlich war mir meine Anhänglichkeit peinlich.
Frau Schmidt bemerkte es. Sie hatte immer noch diesen seltsamen Blick. Sie winkte mich an ihr Bett, ich holte mir einen Stuhl und setzte mich. Griff nach ihrer Hand, die klein auf der schweren Krankenhausbettdecke lag. Im selben Augenblick durchfuhr mich ein Schock. Alarmiert ließ ich ihre Hand los und schaute sie an. Sie war genauso erschrocken wie ich, zog hastig die Bettdecke bis zum Hals und steckte beide Hände darunter. Sie murmelte so etwas wie: „Mir ist kalt.“
Es war nicht kalt. Natürlich nicht. Es war Hochsommer.
Unsere Hände hatten sich bei der kurzen Berührung sofort miteinander verbunden. Die Zellen. Das kannte ich bisher nur aus meiner Familie. Besser gesagt, hauptsächlich mit meiner Schwester. Bei meinen Eltern hatte ich es sehr früh gelassen, weil ich merkte, dass sie es nicht wollten. Und trotzdem war das hier noch anders gewesen. Bei meiner Schwester musste ich meine Aufmerksamkeit auf die Verbindung richten, dann strömte etwas aus meinen Zellen zu ihren hinüber und verband sich. Bei Frau Schmidt hatte ich gar nichts gemacht. Es war einfach passiert. War sie es gewesen, die den Impuls gegeben hatte? Aber dann müsste sie ja … Nein, sie war genauso schockiert wie ich, also war es keine Absicht von ihr gewesen. Dann müsste sie doch trotzdem – etwas mit mir gemeinsam haben. Sehr gemeinsam, so schnell, wie das gegangen war. Mein alter Verdacht flammte auf. Sie musste meine Großmutter sein! Wie oft hatte ich schon mit mir gerungen, sie zu fragen – und es immer gelassen. Auch jetzt rang ich, doch ich sah ihr an, dass sie nicht antworten würde. Wenn sie es war, dann musste sie ihre Gründe haben, es nicht auszusprechen.
Überhaupt, warum war mir das nicht schon früher aufgefallen? Ich kannte sie jetzt schon so viele Jahre, da hätte es doch schon früher mal passieren müssen. Ich versuchte mich zu erinnern, wann wir uns das letzte Mal berührt hatten. Fand aber nichts. Gar nichts, keine einzige Berührung. Das war ja seltsam – sollten wir uns wirklich noch niemals die Hand gegeben haben, noch nie zufällig aneinander gestoßen sein? Durch die ganze Verbindungsgeschichte war ich mit allen Menschen sehr vorsichtig. Ich vermied körperlichen Kontakt, wo immer es sich machen ließ, um nicht in die Gefahr zu kommen, mich zu verraten. Einer der Gründe, weshalb ich mich bei Frau Schmidt so wohl fühlte, war, dass sie diese spezielle Unnahbarkeit zu achten schien. Bei ihr hatte ich nie das Gefühl, sie könnte meine Grenze überschreiten. Sollte das etwa gar nicht nur von mir ausgegangen sein? Sollte sie es selbst so gewollt haben?
„Es geht mir nicht gut“, unterbrach sie meine Grübelei und beantwortete damit meine gar nicht wirklich ausgesprochene Frage, „ich habe Angst.“ Ihr Tonfall war etwas milder als vorhin und sehr klar.
Das beunruhigte mich. So kannte ich sie, ich konnte mir also nicht einreden, sie würde das nur sagen, weil sie noch mitgenommen war von dem Überfall. Etwas begann mir die Kehle zuzuschnüren. „Wovor?“, krächzte ich.
„Sie werden wiederkommen“, sagte sie leise.
„Aber sie sind in U-Haft!“ Mir fiel ein, dass ich ihr noch gar nichts von unserer Verfolgungsjagd und der Verhaftung berichtet hatte. „Wir haben sie geschnappt gestern Nacht.“
„Nicht diese beiden – andere …“ Ihre Stimme ging in ein Flüstern über. „Ich kenne die Organisation, die sie geschickt hat. Die Kameradschaft. Sie werden mich umbringen. Und du bist auch in Gefahr, Elli. In großer Gefahr.“ Ihre dunkelblauen Augen waren jetzt fast schwarz.
Ich starrte sie an, unfähig, aus dem Wust an Fragen in meinem Kopf die richtige herauszuziehen. „Aber warum?“, brachte ich schließlich hervor, „was wollen die von Ihnen? Und von mir?“
„Sie suchen etwas“, flüsterte Frau Schmidt. „Dich kennen sie noch nicht, es sei denn, du hättest gestern ihre Aufmerksamkeit erregt. Aber sie könnten auf deine Spur kommen. Und dann bist du in großer Gefahr.“
In meinem Brustkorb krampfte sich alles zusammen, mein Zwerchfell begann wild zu flattern. Ich zog den Kopf ein. „Sie sind ziemlich aufmerksam geworden auf mich. Ich habe bei der Verfolgung mit ihnen gekämpft“, gestand ich. Den Rest konnte ich ihr nicht erzählen. Obwohl ich gewollt hätte. Verdammt, warum fragte ich nicht einfach? Aber wenn sie selbst in dieser Situation nichts sagte …
„Was suchen sie?“, fragte ich leise. Wir hätten gar nicht flüstern müssen, die beiden Betten in Frau Schmidts Zimmer waren leer. Trotzdem hatte ich das Bedürfnis danach, so wie sie anscheinend auch.
Sie sah mir in die Augen. „Ich kann nicht darüber sprechen“, antwortete sie, „aber du musst es herausfinden! Es ist deine einzige Chance, ihnen zu entkommen!“
Nun verstand ich gar nichts mehr. Was sollte das denn heißen: Ich weiß es, sags dir aber nicht. Finde es heraus, sonst bist du geliefert. Ich hatte gedacht, sie sei meine Freundin. Noch besser, sogar meine Großmutter. Ich war noch nie böse auf Frau Schmidt gewesen, aber jetzt fühlte ich einen ziemlichen Ärger aufsteigen, vermischt mit Enttäuschung und Verzweiflung. Weil ich nichts kapierte – und sie es durch ihre merkwürdigen, bedrohlichen Äußerungen noch schlimmer machte.
„Erinnere dich“, unterbrach sie mich wieder, „erinnere dich an ganz früher, als du noch klein warst …“
Also doch!
„… dann wirst du alles herausfinden. Aber du musst dich beeilen!“
Wütend und schmerzerfüllt schaute ich sie an. Was war das hier für ein bescheuertes Verwirrspiel? Sie konnte nicht meine Großmutter sein. Meine Großmutter hätte so etwas nie mit mir gemacht! Aber meine Frau Schmidt auch nicht, jedenfalls nicht die Frau Schmidt, die ich kannte. Ich starrte sie an, wie sie da in diesem Krankenhausbett lag, die Decke bis zum Hals hochgezogen, zerbrechlich, mit immer noch unergründlichem Blick, angstvoll und entschlossen gleichzeitig, fremd. Und doch hatte es die Verbindung unserer Zellen gegeben. Mir wurde plötzlich klar, dass ich sie wirklich nicht kannte. Dass ich so gut wie nichts über sie wusste. Dass es immer nur um ihren Laden oder um mich ging, wenn ich bei ihr war. Niemals um sie. Es war mir bisher nicht aufgefallen, weil sie mir so vertraut erschien. Bis jetzt. Ich musste sofort aufhören, irgendwelche emotionalen Ansprüche an sie zu stellen, die nur in meinen Fantasien über sie begründet waren. Musste sie ganz neu betrachten. Musste ihr zuhören und versuchen zu verstehen, was ich tun konnte. Wie meine Rolle aussah. Als ich so weit gekommen war, fühlte ich mich besser. Ich nickte. „Okay. Ich gehe jetzt erst mal zu Julien. Wenn ich nachher mit ihm wiederkomme, habe ich bestimmt noch ein paar Fragen.“
„Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann“, erwiderte sie leise.
Eigentlich musste ich mich beeilen, um noch rechtzeitig im Café zu sein. Dennoch lief ich die Treppenstufen zu Fuß nach unten, auch wenn weit und breit niemand zu sehen war. Kein Risiko jetzt. Ich hatte gerade keine Kapazität mehr frei. Musste versuchen, einen Überblick über die einzelnen Kriegsschauplätze in mir zu bekommen. Und die Kontrolle wiederzugewinnen. Mein Verstand arbeitete fieberhaft, aber nicht sehr effizient. Er wiederholte jedes Wort, das Frau Schmidt heute gesagt hatte, wieder und wieder, in der Hoffnung auf einen Geistesblitz. Mein Gefühlshaushalt war mit einer Versammlung durcheinanderschreiender Wichtigtuer zu vergleichen. Eine Emotion wollte ernster genommen werden als die nächste. Wut, Verzweiflung, Angst, Enttäuschung, Aufregung, Neugier, Trotz – zusammen veranstalteten sie einen Tumult, der es mir schwer machte, mich zu beruhigen. Mein Herz klopfte sehr laut und schnell, mein Magen flatterte, in meinen Ohren fiepte es, meine Zellen vibrierten, als stünde ich unter Strom.
Gut, soweit die Bestandsaufnahme. Jetzt musste ich runterkommen, und zwar ganz fix. Das Café war fast in der Innenstadt, also brauchte ich Aufmerksamkeit für den Verkehr. Und dann lag ja das Gespräch mit Julien noch vor mir. Ich lachte nervös. Heute Morgen hatte ich es noch als mein wichtigstes Thema betrachtet, Julien zu erklären, was es mit mir auf sich hatte – jedenfalls soweit, wie ich es selber wusste – und jetzt erschien es mir geradezu nebensächlich, gegenüber dem, was ich von Frau Schmidt erfahren hatte. Bei allen Zweifeln, die in mir aufstiegen, musste ich erst einmal davon ausgehen, dass das, was sie gesagt hatte, einen Sinn ergab – der mich zutiefst betraf.
Es kreiselte schon wieder in mir. Atmen Elli, atmen, Körper empfinden, konzentriere dich auf das Einfachste, was du wahrnehmen kannst! Die letzten Stufen bis zur Tür rannte ich trotzdem, blieb erst stehen, als ich an der frischen Luft war. Nahm einen tiefen Atemzug. Eine Runde Fliegen hätte jetzt gutgetan, um einen klaren Kopf zu bekommen. Doch es musste auch so gehen.
Ich setzte mich auf eine Bank, die vor dem Eingang des Krankenhauses stand, schloss die Augen und konzentrierte mich noch einmal auf den Atem und meinen Körper. Zwang mich, nichts weiter zu tun. Nach einer halben Ewigkeit wurde ich ruhiger. Konnte wieder denken, nachdenken über das, was Frau Schmidt gesagt hatte.
Der Schlüssel lag also in meiner Kindheit. An diese Zeit erinnerte ich mich nicht besonders gern. An die Ablehnung und den gequälten Ausdruck im Blick meines Vaters, sobald meine Fähigkeiten im Spiel waren, an die Strenge meiner Mutter, die alles tat, um das Leid meines Vater zu mildern, an den Zorn meiner kleinen Schwester, weil sie fühlte, dass ich ihr etwas Wesentliches verschwieg.
Ich machte mich auf den Weg. Julien würde mich mit Sicherheit nach meiner Kindheit ausfragen. Vielleicht würde mir da so ganz nebenbei der richtige Gedanke kommen. Eigentlich sollte ich darauf vertrauen, so passierte es doch meistens. Bis ich beim Café ankam, dachte ich einfach nicht mehr nach. Glücklicherweise hatte Julien einen Tisch im Vorgarten ergattert. Er schaute in meine Richtung. Ich beschloss, ihm meinen neuesten Trick vorzuführen, den ich vor kurzem einstudiert hatte. Gab noch mal richtig Gas, raste auf ihn zu, sprang kurz vor ihm vorn über das Board, gab dem Board dabei mit beiden Füßen einen Drall, so dass es in einer Schraube von hinten über meinen Kopf flog und dann in meine Arme fiel. Ein normaler Skater würde viel üben müssen, bis er das hinbekam, ohne sich zu überschlagen. Lässig setzte ich mich ihm gegenüber an den Tisch und verzog keine Miene. Julien lächelte und nickte anerkennend. „Sieht so aus, als würde es dir wieder gut gehen, Elli Pirelli.“
So nannte er mich, wenn er mich necken wollte. Heute jedoch klang sein Tonfall nicht neckend. Ich musterte ihn. Etwas Neues lag in seinem Blick. Anerkennung, sogar Respekt und ein Hauch Bewunderung. Wie hatte der denn seine Nacht verbracht? Gestern Abend hatte er mich noch angebrüllt. Das war ich zwar nicht gewohnt von ihm, aber ich konnte es mir immerhin erklären. Dieser Blick jetzt? Wir schwiegen beide. Dann setzten wir gleichzeitig zum Reden an.
„Du zuerst“, sagte er, „ich zuerst“, sagte ich. Wir prusteten los. Etwas von der Spannung baute sich ab, die zwischen uns in der Luft lag.
„Das war nur Show eben“, gab ich zu, „nach allem, was passiert ist, brauchte ich das gerade.“
Julien sah mich fragend an.
„Ich war schon bei Frau Schmidt, im Krankenhaus“, fuhr ich fort, „sie sah gar nicht gut aus. Sie hat Angst. Sie sagte, sie kennt die Organisation, die die Typen geschickt hat, irgendeine Kameradschaft, und sie sagte, die würden wiederkommen und sie umbringen.“
In diesem Moment erst, als ich es Julien gegenüber aussprach, wurde mir bewusst, was sie da gesagt hatte. Was es bedeutete. Ich hatte das vorher gar nicht richtig kapiert. War so beschäftigt gewesen damit, beleidigt zu sein – weil sie nicht zugab, dass sie meine Großmutter war, und weil sie mir nichts erklärte, außer, ich sei in Gefahr – dass ich die Tragweite ihrer Aussage überhaupt nicht begriffen hatte. Dafür traf sie mich jetzt mit ihrer ganzen Wucht. Es haute mich in meinem Stuhl nach hinten. Stumm starrte ich Julien an.
„Ich habe den Burschen in der Kartei gefunden“, sagte er, ohne auf mein Entsetzen einzugehen. „Hab den Namen gelesen und wusste es wieder. Bertram Kurz. Als ich noch in der Polizeischule war, wurden wir bei einer rechtsextremen Demo eingesetzt. Er war einer der Demonstranten, hat plötzlich eine Waffe gezogen und auf den Kollegen geschossen, der neben mir stand. Er ist erst seit kurzem raus aus dem Knast.“
Ich schluckte. „Wurde dein Kollege schlimm verletzt?“
„Er wurde gar nicht verletzt. Einer, der neben Kurz stand, sah, was er vorhatte und hat ihm den Arm nach oben geschlagen, gerade als er abdrückte. Kurz wurde dann sofort von uns überwältigt und festgenommen.“
„Warum habe ich davon nichts in den Nachrichten gehört? Ich kann mich gar nicht erinnern.“
„Naja, du warst noch ziemlich klein, als das passiert ist. Es war kurz nach der Wende. Niemand wollte negative Schlagzeilen zu dem Zeitpunkt. Die Demo hat immerhin in den neuen Bundesländern stattgefunden. Damals wollte noch keiner wissen, dass es dort Rechtsextremismus gibt. Alles musste demokratisch und weltoffen sein. Es gab eine kurze Nachricht im Radio, aber schon abends in der Tagesschau tauchte sie nicht mehr auf.“
So war das also. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass unsere Nachrichten uns mehr verschwiegen als berichteten. Aber wenn man es dann hörte … Und nun war dieser Kurz wahrscheinlich ein Gesandter der sogenannten Kameradschaft. Dann konnte man ja fast davon ausgehen, dass diese Kameradschaft rechtsextrem war. Ich hoffte, Frau Schmidt würde etwas gesprächiger sein, wenn Julien nachher eine offizielle Zeugenaussage aufnahm. Denn wie sollten wir sie sonst schützen?
„Kannst du Frau Schmidt nicht bewachen lassen?“, fragte ich. „Die könnten einfach in ihr Krankenzimmer spazieren und sie ermorden …“ Der Gedanke zerrte an meinen ohnehin überspannten Nerven.
„Jetzt beruhige dich mal“, antwortete Julien, „die Kerle wissen gar nicht, wo sie ist. Wenn die tatsächlich wiederkommen, dann kommen sie in den Laden. Im Augenblick können wir erst einmal die Streife verstärken, die sollen öfter fahren und den Laden beobachten und wir können versuchen, etwas über diese Kameradschaft herauszufinden.“ Er telefonierte direkt mit dem Kommissariat.
Er hatte recht, trotzdem blieb ich unruhig. Am liebsten wäre ich gleich wieder aufgebrochen, Julien zwang mich aber, etwas zu bestellen. Ich nahm das kleinste Frühstück, das sie hatten. Während wir aßen, merkte ich, dass ich doch Hunger hatte. Julien versuchte derweilen, mir Informationen über mich zu entlocken. Genau dieses Thema wollte ich jedoch nicht in der Öffentlichkeit mit ihm besprechen und so verabredeten wir einen Waldspaziergang nach dem Besuch bei Frau Schmidt. Als wir endlich in Juliens Wagen stiegen, klingelte sein Handy. Infos über die Kameradschaft.
„Eine extrem rechte Organisation, deren Mitglieder streng geheim operierten“, berichtete er, „die waren im zweiten Weltkrieg für Hitler aktiv und sind danach nach Spanien zu Franco gegangen. Ihr Spezialgebiet war die Verfolgung und Ermordung von Regimegegnern, auch über die Grenzen hinaus.“
„Und was machen sie jetzt?“, wollte ich wissen.
„Keiner weiß Genaues nicht“, sagte Julien. „In den letzten zwanzig Jahren sind keine Straftaten bekannt, die mit ihnen in Verbindung gebracht werden. Es war bis jetzt noch nicht einmal klar, ob es die Kameradschaft überhaupt noch gibt.“
Erstaunlich. Heutzutage wurde doch alles überwacht, wie konnte da so eine Gruppe unbehelligt ihr Unwesen treiben? Würde mich nicht wundern, wenn Julien eine Menge Hinweise fände, jetzt, wo er wusste, wonach er suchen musste.
Wir hielten vor dem Krankenhaus. Ich war gespannt, was Frau Schmidt erzählen würde – wenn sie bereit war, etwas zu erzählen. Sie saß im Bett und wirkte gefasster als heute früh. Bereitwillig beantwortete sie alle Fragen, die Julien ihr stellte und schilderte dann, was gestern passiert war. Frau Schmidt wohnte direkt über dem Laden. Am späten Abend hatte sie unten Geräusche gehört. Sie war nachschauen gegangen und fand die Tür des Lagers aufgebrochen.
„Ich wollte mich gerade wieder nach oben schleichen, um die Polizei zu alarmieren, da hat mich einer der beiden Männer gesehen, hat mich fest am Arm gepackt und ins Lager gezogen. Er hat mir einen Kinnhaken verpasst. Ich bin gegen die Regale gefallen und dann zu Boden gegangen. Dort bin ich liegen geblieben und habe mich ohnmächtig gestellt. Ich wollte nicht noch weiter verprügelt werden. Ich hatte große Angst.“ Bei der Erinnerung schauderte sie kurz. „Ich habe versucht, durch die Wimpern zu sehen, was sie tun. Sie haben alles aus den Schränken und Regalen gerissen und auf den Boden geworfen, es sah so aus, als suchten sie etwas. Ich habe überlegt, was es wohl sein könnte und dann kam ich darauf, dass nur die Kameradschaft sie geschickt haben konnte, denn ich wüsste nicht, für wen es sonst etwas Interessantes bei mir gäbe. Anscheinend fanden sie nicht, wonach sie suchten. Der, der mich niedergeschlagen hatte, kam zu mir, packte mich vorn am Kragen und schüttelte mich, bis ich vor Schreck die Augen öffnete. Er schrie mich an, wo ich es versteckt hätte, und schlug mir ins Gesicht. Ich konnte nicht sprechen vor Angst. Er schüttelte mich weiter, bis plötzlich von draußen das Klappern von Ellis Skateboard zu hören war. Offenbar wussten die beiden Männer die Geräusche nicht einzuordnen und wurden nervös. Der, der mich gepackt hatte, zischte mich an: ‚Wir kommen wieder‘, und stieß mich zurück auf den Boden. Dann rannten sie hinaus. Kurz darauf erschien Elli.“
Also hatte mein Skateboard die Typen verjagt. Nicht schlecht. Im Hof vor Frau Schmidts Lager war Kopfsteinpflaster verlegt, vor ungefähr hundertfünfzig Jahren oder so. Es sah sehr romantisch aus, aber wenn ich mit dem Skateboard angebraust kam, tat es immer ordentliche Schläge. Oft genug hatte es mir das Board schon unter den Füßen weggehauen, weil das Pflaster wirklich buckelig war. Es hatte doch eben alles sein Gutes.
„Wissen Sie, was die Männer gesucht haben?“, erkundigte sich Julien.
Frau Schmidt zuckte die Achseln. Sie schüttelte nicht den Kopf, das registrierte ich genau.
„Was wissen Sie über die Kameradschaft?“, fragte Julien.
Frau Schmidt rückte sich im Bett zurecht und antwortete dann: „Die Kameradschaft hat zur Hitlerzeit Juden, fahrendes und fl... fahrendes Volk verfolgt und ermordet. Auch Leute, die politisch aktiv waren. Sie nannten uns alle Regimegegner.“
„Aber zur Hitlerzeit waren Sie noch ein Kind“, bemerkte Julien.
„Ich war acht, als er an die Macht kam, und vierzehn, als er den Krieg erklärte. Da waren wir schon in Spanien. Dort lernte ich Simón kennen, meinen späteren Mann. Wir kämpften im Untergrund gegen Hitler und gegen Franco. Nach Kriegsende, als Deutschland von den Alliierten überwacht wurde, konnte die Kameradschaft nicht mehr ungestört operieren und suchte bei Franco Unterschlupf. Als Gegenleistung jagte sie Regimegegner für ihn und folterte oder ermordete sie. Wir standen auf ihrer Liste.“
„Und wie ging es weiter?“
„Als wir von der Liste erfuhren, brachten wir unseren kleinen Sohn in Sicherheit – weit weg, zu Freunden nach Kanada. Wir kehrten zurück und setzten den Kampf fort. Ein Jahr später hörten wir, dass sich in Südamerika eine Gruppe bildete, die so leben wollte, wie wir uns das vorstellten. Wir wollten weg aus Spanien, weg von diesem Diktator, den wir doch nicht stürzen konnten. Wir wollten mit unserem Sohn ein neues Leben beginnen und holten ihn in Kanada ab. Auf dem Rückweg fielen wir der Kameradschaft in die Hände.“ Frau Schmidt machte eine Pause und starrte ins Leere. Schmerz breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Sie atmete schwer, bevor sie fortfuhr: „Sie ermordeten Simón und nahmen meinen Sohn und mich gefangen. Mehrere Wochen später konnten wir fliehen und kamen über Umwege nach Deutschland. Ich träumte weiter davon, nach Südamerika zu gehen, doch mein Sohn sträubte sich mit aller Kraft. Er war traumatisiert und wollte nichts mehr mit unserer Vergangenheit zu tun haben. So sind wir hier geblieben.“
„Und die Kameradschaft?“
„Ich weiß es nicht. Ich hatte eine gute Tarnung und war immer sehr vorsichtig. Bis gestern hatte ich nichts mehr von ihnen gehört, obwohl ich immer damit gerechnet habe. Das sind Bluthunde. Die geben nicht auf, bis man tot ist.“
Während Frau Schmidt erzählte, achtete ich darauf, dass meine Miene nichts verriet. Ich war fasziniert und entsetzt zugleich. Angenommen, sie war wirklich meine Großmutter, dann war ihr kleiner Sohn mein Vater. Oh Gott, wie schrecklich das alles war. Es würde diesen unendlich traurigen und ängstlichen Blick erklären, den mein Vater Zeit seines Lebens hatte. Und vielleicht auch seine Abneigung gegen mein Fliegen. Wenn … Sie hatte das Fliegen nicht erwähnt, doch ich hatte genau zugehört, sie hatte nichts gesagt, was darauf hindeuten würde, dass sie nicht geflogen waren. Mein Vater stritt zwar bis heute ab, dass Großmutter fliegen konnte, von ihm ganz zu schweigen, aber irgendwo musste ich es doch her haben. Außerdem hatte sie sich vorhin korrigiert, als sie davon gesprochen hatte, wen die Kameradschaft verfolgte. Das hätte gut „fliegendes Volk“ heißen können. Ich hoffte, Julien würde seine Befragung weiter fortsetzen, damit ich noch mehr erfahren konnte. Doch es schien ihm genug zu sein.
Er bedankte sich bei ihr und stand auf. „Ich werde eine Bewachung für Sie veranlassen“, sagte er, zog sein Handy aus der Tasche und ging aus dem Zimmer.
Frau Schmidt winkte mich an ihr Bett. „Hast du schon etwas herausgefunden?“, fragte sie mich leise.
Mein Ärger wallte wieder hoch. Ich schüttelte etwas zu heftig den Kopf. Bevor ich diesen Ärger in Worte fassen konnte, fuhr sie fort: „Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du einen Blick in den Laden werfen und mir berichten, wie schlimm es ist? Ich will ein bisschen vorbereitet sein, wenn ich heimkomme.“
„Warum sagen Sie mir nicht, worum es geht?“, wollte ich wissen, ohne auf ihre Bitte einzugehen. „Es ist unfair, vor allem, wenn wir beide in Gefahr sind!“
„Schscht“, machte sie, „Elli, es nützt nichts, wenn du dich aufregst. Ich kann nicht darüber sprechen, das habe ich dir schon gesagt. Ich habe mein Wort gegeben. Du musst es selbst herausfinden. Erinnere dich. Du schaffst das, das weiß ich ganz sicher.“
Ich war noch immer ärgerlich, aber nicht mehr so schlimm. Ihr Vertrauen in mich besänftigte mich seltsamerweise – und machte mich auch stolz, irgendwie.
„Geh aber nicht erst abends hin, und sei sehr vorsichtig, nicht dass du jemandem von der Kameradschaft in die Arme läufst.“
„Oder der Polizei“, ergänzte ich, „die fahren jetzt öfter Streife.“
Frau Schmidt wollte gerade noch etwas sagen, als Julien wieder zur Tür hereinkam. Sie warf mir einen konspirativen Blick zu und sah Julien dann fragend an.
„Alles in die Wege geleitet“, verkündete er, „die Kollegen werden gleich hier sein.“
Nachdem eine Polizistin und ein Polizist eingetroffen waren und Julien die beiden instruiert hatte, machten wir uns auf den Weg.
„Wie findest du die Geschichte?“, frage er mich unterwegs. Ich war ziemlich von den Socken wegen der Zusammenhänge, die ich vermutete. Darüber wollte ich aber noch nicht sprechen.
„Aufregend“, sagte ich deshalb nur.
„Dann bin ich mal gespannt, ob deine Geschichte genauso aufregend ist“, scherzte er und lenkte damit geschickt das Thema auf mich.