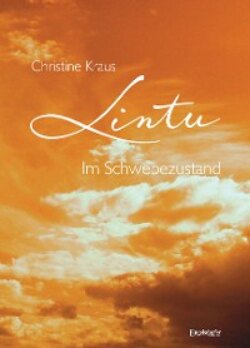Читать книгу Lintu - Christine Kraus - Страница 7
2. Kapitel
ОглавлениеNun war es also so weit. Ich musste Rede und Antwort stehen. Zu meinem Erstaunen bemerkte ich, dass ich das auch wollte – obwohl ich keine Ahnung hatte, wie es inzwischen in Julien aussah, wie er zu meiner besonderen Fähigkeit stand. Er war den ganzen Vormittag über locker gewesen, doch ich war unruhig deswegen. Trotzdem freute ich mich, endlich mal mit jemandem darüber sprechen zu können. Und nicht zuletzt hoffte ich, dass mir während des Redens eine Erkenntnis kommen würde, die mich weiterbrächte im großen Rätselraten.
Julien hielt den Wagen auf einem Waldparkplatz an. Die Sonne ließ die Blätter der Bäume leuchten, auch wenn kein Sonnenstrahl den Boden traf. Es war angenehm kühl im Wald. Draußen Mittagshitze, kein Mensch unterwegs. Perfekt.
„Schieß los“, forderte ich ihn auf.
„Zeig’s mir noch mal“, sagte er als Erstes und klang ein bisschen verschämt. Ich sah ihn verblüfft an und kontrollierte schon routinemäßig die Umgebung.
„Aber nur kurz“, sagte ich, „dann reden wir erst mal.“ Ich hatte das Gefühl, er könnte es besser verarbeiten, wenn er mehr von mir wusste. Fröhlich nickte er.
Ich musste mir tatsächlich ein Herz fassen. Zu zeigen, was ich fast mein ganzes Leben verborgen hatte, war so neu. So aufregend. Ich machte mich leicht und hob ein paar Zentimeter vom Boden ab. Nicht viel, doch Juliens Augen wurden schon kugelrund vor Staunen. Er sah aus wie ein Kind vorm Christbaum. Also gut – ich schwebte ein Stückchen von ihm weg und nach oben, flog ein paar Kreise, ein bisschen hoch und runter und landete dann wieder vor ihm. Was ich wirklich drauf hatte, konnte ich ihm noch nicht zeigen, meine Kunststücke zum Beispiel, denn ich hatte mir vorgenommen, ihn nicht gleich mit allem zu überfallen. Er sollte Gelegenheit haben, sich langsam an die neue Elli zu gewöhnen.
Er strahlte übers ganze Gesicht. „Elli“, hauchte er ehrfürchtig, „das ist das Fantastischste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.“
Dass er so reagierte, stimmte mich froh. Er hätte auch schockiert sein können. Mich ablehnen, weil er es nicht verstand. Nun musste ich mir ernsthaft zureden, nicht übermütig zu werden, weil ich merkte, wie groß mein Verlangen war, ihm alles vorzuführen, was ich auf der Palette hatte.
„Kann ich dich mal anfassen, wenn du schwebst?“, wollte er wissen.
Meine Begegnung mit Frau Schmidt heute Morgen kam mir in den Sinn. So viel Nähe könnte ich im Moment noch nicht verkraften. Doch dann fiel mir ein, dass ich mit Julien schon oft ganz normalen Körperkontakt gehabt hatte und dass die Verbindung von mir hergestellt werden musste, wenn ich schwebte. So war es zumindest bei meiner kleinen Schwester immer gewesen.
„Na klar“, sagte ich, machte mich leicht und legte mich vor ihm in die Luft. Wie diese Damen, die im Fernsehen immer vor dem Magier herumschweben. Er streckte vorsichtig seine Hand aus. Als er mich berührte, rief ich: „Buh.“
Er machte einen Satz nach hinten und schaute mich erschrocken an. Kichernd drehte ich mich zu ihm. „Sorry, es hat mich gerade geritten. Komm her ...“
Ich schwebte auf ihn zu und umarmte ihn.
Er stieß erleichtert die Luft aus. „Wie machst du das? Ich kann nichts Besonderes spüren!“
„Wie jetzt?“, fragte ich, „du spürst nichts Besonderes, wenn ich dich umarme?“
„Ach Elli“, maulte er, „jetzt komm mal wieder runter. Du führst mir hier die absolute Sensation vor und machst dich nur über mich lustig.“
Ich ließ mich bis fast auf den Boden fallen. „Ist das runter genug?“ Herrje, ich war wirklich total daneben. Daran konnte ich schon merken, wie angespannt ich eigentlich war, obwohl er so gut reagierte. „Erstens kommt die absolute Sensation noch“, ich dachte daran, mich mit ihm zu verbinden und ihn mit in die Luft zu nehmen, „und zweitens sei mal nicht so streng, es ist schließlich mein allererstes Comingout.“
„Nee, oder? Außer mir weiß es niemand?“ Julien staunte.
„Meine Großmutter und meine Eltern. Meine Schwester wusste es, als sie ganz klein war, aber sie hat es vergessen.“
„Wow“, sagte er, „und ich dachte immer, ich wäre das arme Schwein von uns beiden.“
Wir liefen den Waldweg entlang.
„Erklärst du mir, wie du es machst?“ fragte er.
Ich zuckte die Achseln. „Ich mache mich leicht.“
„Und wie geht das, dich leicht machen?“
„Ich ändere meinen Zustand.“ Ich überlegte, ob es eine Möglichkeit gab, ihm wenigstens eine vage Vorstellung davon zu geben. Ein paar Baumstämme am Rand des Weges brachten mich auf eine Idee, die vielleicht funktionieren könnte. Den Versuch war es wert.
„Stell dich mal da auf den Baumstamm und spring runter“, sagte ich. „Du musst besonders auf den Moment achten, in dem du dich entschließt zu springen, aber noch keine Bewegung machst.“
Für den Revolverhelden, den er gestern gegeben hatte, kletterte er ein bisschen zu umständlich auf den Baum. Er sprang, nachdem er einen Augenblick innegehalten hatte.
„Und?“ fragte ich.
„Hmm, als ich daran dachte zu springen, habe ich gleichzeitig geschaut, wo ich ungefähr aufkommen würde, und dann habe ich gehofft, dass ich es auch schaffe.“
„Und dann?“
„Dann bin ich gesprungen.“
Okay, das hatte noch nicht geklappt. „Es geht mehr um das, was im Körper passiert als im Kopf. Du musst es nochmal machen.“
„Warum hast du das nicht gleich gesagt“, murrte er, als er noch einmal auf den Baumstamm stieg.
„Diesmal schaffst du es“, ermunterte ich ihn.
„Warte, bis ich wieder unten bin, du freches Gör!“
„Ich kann auch zu dir raufkommen“, grinste ich und beamte mich direkt neben ihn. Hatte mich doch nicht beherrschen können.
Julien verlor fast das Gleichgewicht, weil er nicht damit gerechnet hatte. „Elli!“
„‘tschuldigung. Ich benehme mich jetzt.“ Ich sauste wieder nach unten.
Julien sprang kurz danach. „Mein Körper hat sich bereit gemacht.“ Erwartungsvoll schaute er mich an. Das klang schon besser.
„Wie hat er sich bereit gemacht?“
„Er hat sich sozusagen darauf eingestellt, die Bewegungen zu machen, die ihn durch die Luft bis zum Ziel fliegen lassen.“
„Ja, das kommt ungefähr hin. Das, was du ,bereitmachen‘ nennst, das mache ich auch, bevor ich schwebe.“
„Aber warum kannst du dann oben bleiben und ich nicht?“
„Keine Ahnung, ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der es mir erklären wollte.“
Es sollte lässig klingen, doch in Wirklichkeit war ich traurig darüber. Ich sehnte mich so sehr danach, Gleichgesinnte zu treffen, etwas über mich und meine Herkunft zu erfahren.
„Und wie funktioniert das Fliegen?“, fragte Julien und riss mich aus meinen trüben Gedanken.
„Das ist eigentlich dasselbe wie schweben, nur schneller.“
„Aber wie kommst du vorwärts in der Luft? Du flatterst ja nicht mit den Armen wie ein Vogel. Ich sehe überhaupt nicht, dass du dich bewegst.“
„Naja, ich bewege mich schon. Nur innerlich halt. Ich gehe in die Bereitschaft für eine bestimmte Bewegung, und mein Körper nimmt diesen Impuls auf, als würden sich die Muskeln bewegen. Er begibt sich dahin, wo ich ihn hinschicke. Wenn ich geradeaus oder hoch oder runter will, dann schwebe ich geradeaus oder hoch oder runter. Wenn ich schneller sein will, dann werde ich schneller.“
„Denkst du das dann, oder wie funktioniert es?“
„Nein, es ist genauso, wie wenn man läuft. Man denkt ja nicht: ‚Ich laufe geradeaus‘. Man tut es einfach.“ Wir setzten uns wieder in Bewegung.
„Hast du das gelernt oder konntest du es schon immer?“, fragte Julien.
„Wahrscheinlich habe ich die Anlage schon von Geburt an. Aber zum ersten Mal geflogen bin ich erst an meinem dritten Geburtstag.“
„Erzählst du es mir?“
Ich nickte. „Meine Großmutter hatte einen Spaziergang im Wald vorgeschlagen. Wir kamen auf eine Lichtung und Großmutter tollte mit mir herum. Mitten im Spiel nahm sie mich auf den Arm und warf mich in die Luft. In meinem Kopf hörte ich ihre Stimme: Flieg Ellischatz, aber da flog ich schon. Es ging ganz automatisch. Und es machte einen Riesenspaß. Großmutter behielt mich die ganze Zeit im Auge, ich hörte immer ihre Stimme im Kopf, die mir sagte, wo ich hinfliegen sollte. Ich war sehr lange in der Luft, wollte gar nicht mehr runterkommen. Bis ich bemerkte, dass Großmutter und meine Eltern stritten. Ich wusste nicht, worum es ging, doch als ich in ihre Arme flog, merkte ich, dass Großmutter traurig war. Es gab eine neue Verbindung zwischen ihr und mir, sehr intensiv.“ So wie heute Morgen mit Frau Schmidt, dachte ich.
„Ich konnte fühlen, dass es um mich gegangen war. Als sich Großmutter zu Hause von mir verabschiedete, sagte sie: Ellischatz, ich bin jetzt eine Weile weg. Ich habe dich immer in meinem Herzen, auch wenn du mich nicht hörst. Lass dir von niemandem das Fliegen verbieten. Seitdem habe ich sie nicht mehr wiedergesehen.“
Ich schwieg. Obwohl ich noch so klein gewesen war, hatte ich ihre Worte niemals vergessen. Jeden Tag hatte ich sie mir vorgesagt. Und war unermesslich traurig gewesen, dass sie nicht mehr kam. Immer und immer wieder hatte ich meine Eltern nach ihr gefragt, aber keine Antwort bekommen. „Sie ist in ein anderes Land gegangen“, war die einzige Auskunft meines Vaters. Ich konnte nicht verstehen, dass sie mich verlassen hatte. Als ich älter wurde, versuchte ich, mir ihr Verschwinden mit den verschiedensten Theorien zu erklären. Zuerst mit der Geschichte einer verzauberten Königstochter, später machte ich sie zur Agentin in geheimer Mission und einem Wesen von einem anderen Stern. Meine letzte Figur – an der ich heimlich noch immer festhielt – war Mitglied eines fast vergessenen, uralten Volks. Alle Theorien endeten damit, dass sie zurückkommen würde, um mich zu sich zu holen. Bis jetzt war sie nicht gekommen.
„Erzähl weiter“, forderte Julien mich auf, „ich will alles wissen. Es ist zu spannend.“
„Ich machte nichts anderes mehr als fliegen und nach meiner Großmutter fragen“, nahm ich den Faden wieder auf. „Im Sommer sollte ich in den Kindergarten gehen, doch meine Mutter meldete mich wieder ab. Sie hatte Angst, ich würde das Fliegen dort nicht lassen. Wenn sie mit mir einkaufen ging, hielt sie mich immer fest an der Hand. Überhaupt nahm sie mich nicht mehr oft mit. Ich durfte auch nicht mehr allein nach draußen zum Spielen. Das fand ich zwar blöd, aber da waren meine Eltern eisern. So flog ich halt in meinem Zimmer herum und führte meiner kleinen Schwester Kunststückchen vor. Sie war damals ein Jahr alt und schaute mir immerfort zu, wenn sie wach war. In der restlichen Wohnung durfte ich nicht fliegen. Meine Eltern meinten, ich müsste üben, mich normal zu verhalten, damit ich nicht auffiele. Sie missbilligten meine Freude am Fliegen, aber sie ließen mich gewähren. Eines Tages, meine Schwester war ungefähr zwei Jahre alt, streckte sie ihre Ärmchen nach mir aus, als ich mal wieder in der Luft vor ihr herumhampelte. Sie wollte auch fliegen. Ich fasste ihre Hände an und verband mich mit ihr. Dann war sie auch leicht und ich konnte sie nach oben ziehen. Wir schwebten durch das Zimmer. Sie war ganz still und sah mich mit großen Augen an.“
Ich hörte einen Moment auf zu erzählen, weil die Erinnerung so stark wirkte. Das war ein unglaublicher Augenblick gewesen. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie mir die Verbindung gelungen war, doch das war nicht wichtig. Ich war nicht mehr allein. Olivia war zwar kein Ersatz für Großmutter, aber sie teilte doch immerhin meine Freude am Fliegen.
„Von da an flogen wir bei jeder Gelegenheit gemeinsam, aber ich achtete, so klein ich war, darauf, dass meine Eltern es nicht mitbekamen. Ich hatte Angst, sie würden es uns verbieten. Meine Schwester schien das zu merken, sie war immer ganz leise. Wir schwebten eigentlich nur, unser Zimmer war zu klein, um wirklich zu fliegen. Es ging bestimmt ein halbes Jahr gut, dann wollte sie schneller fliegen und Kunststückchen mit mir machen. Sie quengelte so lange herum, bis ich mit ihr Purzelbäume in der Luft schlug. Das fand sie großartig. Wir kullerten und kullerten und sie fing plötzlich laut zu jauchzen an. Meine Mutter stürzte ins Zimmer und sah uns in der Luft. Sie versteinerte auf der Stelle. Während ich mit Olivia landete, erschrocken von ihrer Reaktion, starrte sie uns nur an. Sie sagte keinen Ton und ging hinaus. Am nächsten Tag räumten meine Eltern ihr Schlafzimmer. Dort wurde ich einquartiert. Meine Eltern schliefen von da an im Wohnzimmer und Olivia blieb in unserem Kinderzimmer. Gemeinsame Zeit verbrachten wir nur noch unter Aufsicht meiner Mutter. Wir litten alle. Ich, weil ich allein spielen musste, Olivia, weil sie nicht mehr fliegen konnte, meine Eltern, weil sie nicht wussten, wie sie mir das Fliegen abgewöhnen könnten. Denn das war es, was sie wollten. Ohne mich zu zwingen. Ein Jahr, bevor ich in die Schule kam, fingen sie ein intensives Training mit mir an. Sie nahmen mich jeden Tag ins Gebet und trichterten mir ein, dass ich niemals, unter keinen Umständen, jemandem davon erzählen oder es gar zeigen durfte. Das hatte ich ja schon lange vorher begriffen, doch sie waren so ängstlich, dass sie mir einfach nicht trauten. Es war die reinste Gehirnwäsche. Nur die Erinnerung an meine Großmutter bewahrte mich davor, mir schlecht vorzukommen.
Danach ließen sie mich wieder mit Olivia allein spielen. Damals begriff ich nicht, dass es ein Test war. Ich bestand ihn, doch es war unglaublich hart. Abgesehen von meinem eigenen Verlangen, mich wieder mit ihr zu verbinden und zu fliegen, drängte sie mich, sobald wir allein waren. Ich ignorierte ihre Fragen, weil ich nicht wusste, was ich antworten sollte. Es war alles so ungerecht. Ich versuchte, sie abzulenken. Es half nicht. Sie bestand darauf, bis ich sie irgendwann anschrie, ich hätte es verlernt. Sie glaubte mir nicht und war von da an böse mit mir. Sie wandte sich von mir ab. Mit den Jahren vergaß sie, dass ich fliegen konnte. Doch die Distanz ist bis heute geblieben.“ Ich hörte auf zu sprechen, hatte einen Kloß im Hals. Meine kleine Schwester war ein schwieriges Thema für mich. Ich hing an ihr und konnte sie doch nicht erreichen.
Julien ging still neben mir her. Dann legte er seinen Arm um meine Schultern und fragte: „Und wie ging es weiter?“ In seiner Stimme lag Mitgefühl und gleichzeitig die Aufforderung, nicht in meinem Schmerz zu versinken. Vielleicht rief ich mich auch nur selbst dazu auf.
„Kurz bevor ich in die Schule kam, zogen wir in das Haus, in dem meine Eltern jetzt noch wohnen. Sie hatten endlich wieder ein Schlafzimmer. Mein neues Zimmer war ein ganzes Stück größer als mein altes, dennoch reichte es mir nicht mehr, immer nur dort herumzufliegen. Ich kam mir vor wie eines der wilden Tiere im Zoo. Immer nur im Kreis herum. In meiner Verzweiflung hatte ich die Idee, nachts abzuhauen, um geradeaus fliegen zu können. Unglücklicherweise lag mein Zimmer zwischen dem Wohnzimmer und dem Schlafzimmer und ging auf die Straße hinaus, wo abends die Laternen leuchteten. Doch ich fand einen Weg über den Dachboden. Dort gab es ein kleines Dachfenster für den Schornsteinfeger. Man konnte den Fensterflügel komplett nach außen klappen und es war so hoch oben, dass man auf die Leiter steigen musste, um es zu öffnen. Das wurde nie kontrolliert. Genau das Richtige für mich. Ich blieb also jeden Abend wach, bis es ganz dunkel war, und schwebte dann leise und schnell zum Dach hinaus. Meine Eltern haben es nie mitbekommen. Sie saßen abends vor dem Fernseher und wenn ich zurückkam, schliefen sie schon. Zum Glück hatten sie nicht diese dumme Angewohnheit, nachts nochmal ihre schlafenden Kinder zu betrachten. Das machen sowieso nur Eltern im Film, glaube ich. Ich habe das bis heute beibehalten, nachts auszufliegen.“
„Und wie ging das mit der Schule?“, unterbrach mich Julien, „warst du nicht müde am Tag?“
„Ein paar Stunden Schlaf hatte ich ja noch bis zum Morgen. Und außerdem verbrauche ich im Schwebezustand nicht viel Energie“, antwortete ich. „Es ist sehr praktisch, ich werde nicht müde, habe keinen Hunger oder Durst, meine Sinne funktionieren besser und ich bin ziemlich stark und schnell.“
„Also doch Superwoman“, neckte er mich.
„Nein, da hab ich echt keine Ambitionen.“ Ich schüttelte mich. Das gestern war zwar aufregend gewesen, aber ob ich das wirklich jeden Tag brauchte? Das Verbrecherjagen überließ ich lieber Julien und seinen Kriminalkollegen. Detektiv spielen ginge da schon eher in meine Richtung. Hauptsächlich in eigener Sache. Was mich wieder zu den ominösen Aufforderungen von Frau Schmidt brachte und meiner Hoffnung, bei meiner Schilderung etwas zu entdecken. Ich war beim Dachboden stehengeblieben.
„Der Dachboden wurde mein Lieblingsort“, erzählte ich weiter. „Dort standen lauter Sachen, die nicht in die Wohnung passten. ‚So wie ich‘, dachte ich damals. Ich verkleidete mich oft und spielte Buchhandlung mit den ganzen alten Büchern. Es gab einen Karton, in dem lagen ein paar Bücher, die mich besonders faszinierten. Eines hatte geheimnisvolle Ornamente und war in einer anderen Sprache geschrieben. Dann gab es noch mehrere handgeschriebene Bücher. Die Schrift konnte ich nicht lesen, vermutlich Sütterlin, ich konnte nur ganz wenige Buchstaben entziffern. Ich spielte immer, es seien die Tagebücher meiner Großmutter und dachte mir die Heldentaten aus, die sie aufgeschrieben hatte.“
„Hast du herausgefunden, wer sie verfasst hat?“, frage Julien.
„Nein, ich habe meine Eltern gefragt, aber die wussten es auch nicht. Sie mutmaßten, dass der Vorbesitzer des Hauses sie zurückgelassen hat. Irgendwann waren die Bücher weg. Ich habe sie gesucht, doch sie blieben verschwunden. Hab sie dann auch aus den Augen verloren. Ehrlich gesagt, erinnere ich mich erst jetzt wieder an sie.“
Ich wurde nachdenklich. Irgendetwas war komisch an der Geschichte. Warum waren die Bücher auf einmal weg gewesen? Damals hatte ich vermutet, dass meine Eltern dahintersteckten. Aber warum sollten sie Bücher beiseiteschaffen, die offensichtlich niemand vermisste und die ich nicht einmal lesen konnte?
Meine Nachfragen hatten nur das berühmte Schweigen hervorgerufen, das auch über Großmutter und meinem Fliegen lag. Sie hatten eine Technik entwickelt, nicht über Dinge zu reden, gegen die ich nicht ankam. Nicht als Kind und auch heute noch nicht. Vielleicht waren es diese Bücher, die ich finden musste.
Vielleicht hatte ich gar nicht so falsch gelegen, und es waren tatsächlich Aufzeichnungen von Großmutter.
Ich erinnerte mich dunkel an die Miene meines Vaters, als ich von dem Karton erzählt hatte. Besorgnis hatte darin gelegen. Das war für mich nichts Neues gewesen – wenn man meinem Vater einen Gesichtsausdruck zuschreiben konnte, dann war es Besorgnis. Deshalb hatte ich mir damals nichts weiter dabei gedacht. Doch jetzt nahm ich mir vor, diesen Karton noch einmal zu suchen, und zwar gründlich und sehr bald. Heute Nacht, genauer gesagt. Frau Schmidt hatte deutlich genug gemacht, dass ich keine Zeit verlieren durfte.
„Ich habe Frau Schmidt versprochen, noch einen Blick in ihren Laden zu werfen“, sagte ich.
„Wenn du mir alles erzählt hast, was ich wissen will, können wir gemeinsam hinfahren“, meinte Julien. „Ich wollte mich sowieso noch einmal dort umschauen, vielleicht fällt mir noch etwas auf.“
„Oder mir.“
„Oder dir. Aber jetzt erstmal zurück. Du hast mir noch nicht erzählt, wie es dir in der Schule ergangen ist.“
Ich zuckte mit den Schultern. „Da gibt es nichts Besonderes zu berichten. Die Schule war langweilig, wie für jeden normalen Menschen. Ich hatte ein paar lose Freundschaften, doch im Grunde blieb ich immer Einzelgängerin. Was sollte ich auch mit Menschen anfangen, denen ich verschweigen musste, was mich interessierte?“
„Hast du dich nie verplappert?“, wollte Julien wissen.
„Nie. Das Einzige, was wirklich schwierig war, war Sport. Ich musste mich immer sehr darauf konzentrieren, nicht in den Schwebezustand zu gehen, damit ich nicht auffiel. Ich vermied Sport, so oft es ging. Ich galt als unsportlich.“
„Typisch Schule“, kommentierte Julien. „Mich nannten sie Weiberheld, weil die Mädchen mich reihenweise anmachten und ich mich für keine entscheiden wollte.“
„Arme Mädels“, grinste ich, „heute wären sie wohl mit ihrem harten Schicksal versöhnt.“
„Sag das nicht“, seufzte er, „es gibt genug Frauen, die meinen, wenn sie sich nur ein bisschen anstrengen würden, könnten sie mich schon umdrehen.“
„Bis heute hattest du es auch echt schwer“, stimmte ich ihm zu. „Doch ab jetzt kannst du dich immer mit mir vergleichen, einem fliegenden Einzelgängersingle. Das müsste dich wirklich trösten.“
„Hast du denn nie jemanden gefunden, der es auch kann?“ Julien ging nicht auf meinen Versuch ein, die Sache ins Lächerliche zu ziehen.
Ich schüttelte den Kopf. „Ich habe alles versucht, was mir eingefallen ist: Jeden Zirkus abgeklappert, der fliegende Akrobaten beschäftigt, sämtliche Büchereien durchstöbert nach Hinweisen in der Literatur, meine Eltern solange mit Fragen genervt, bis sie schon ‚Nein‘ sagten, wenn ich nur den Mund aufmachte, jeder älteren Frau ins Gesicht geguckt und versucht, meine Großmutter in ihr zu erkennen. Ich bin kein Stück weitergekommen. Natürlich habe ich meine Theorien, aber Beweise habe ich keine, geschweige denn Bestätigungen.“
„Erzählst du sie mir?“
„Lieber nicht. Du weißt jetzt schon so gut wie alles von mir, irgendwas muss ich noch für mich behalten. Außerdem ist es mir peinlich.“
Julien nahm meine Antwort tatsächlich an, das hieß jedoch nicht, dass er nichts mehr wissen wollte. „Erzähl mir, was du jede Nacht treibst, wenn du ausfliegst, wie du es genannt hast. Wie lange bist du unterwegs?“
„Ich fliege gegen zwei Uhr los, da ist so gut wie niemand mehr auf der Straße, und komme dann gegen halb fünf wieder heim, bevor die Ersten zur Arbeit fahren. Seit ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, habe ich es ein bisschen leichter. Der Weg in den Wald fällt praktisch weg. Meine Eltern haben immer schon mitten in der Stadt gewohnt, am liebsten dort, wo es am belebtesten ist. Da war die Strecke bis zum Stadtrand nicht so einfach, selbst mitten in der Nacht. Immer von Dach zu Dach und immer auf der Hut. Nicht gerade entspannend.“
„Und was machst du dann, wenn du draußen im Wald bist?“
„Fliegen. Einfach nur so, wie wenn jemand gern rennt oder schwimmt. Und Kunststücke üben, Fertigkeiten trainieren.“
„Ist das nicht blöd, wenn es dunkel ist? Kannst du überhaupt etwas sehen?“
„Ich sehe ziemlich gut, wenn ich im Schwebezustand bin. Bestimmt nicht so gut wie Nachttiere, aber ungefähr so, als wäre Dämmerung. Das ist absolut ausreichend zum Fliegen. Klar wäre es mir lieber, ich könnte tagsüber fliegen, mach ich ja auch bei jeder Gelegenheit. Aber es reicht halt nicht. Also bleibt mir nichts anderes übrig. Ich bin froh, dass es überhaupt geht.“
„Wann bist du eigentlich bei deinen Eltern ausgezogen?“
Meine Güte, gingen dem Mann denn die Fragen nicht langsam mal aus? Ich näherte mich einer Art Erschöpfungszustand. Normalerweise sprach ich nicht sehr viel. Schon gar nicht über mich. „Als ich das Studium anfing. Es war eine gute Gelegenheit. Ich wollte schon länger weg. Auf die Dauer ist es nicht zu ertragen, wenn man sich seinen eigenen Eltern gegenüber verleugnen muss.“
„Wem sagst du das …“, warf er ein.
„Aber du hast es doch erst viel später entdeckt?“, fragte ich verwundert.
„Wäre vielleicht auch anders gewesen, wenn ich nicht versucht hätte, meinen gestrengen Eltern zu gefallen. Und so richtig verleugnen musstest du dich doch auch nicht.“
„Nein, nicht wirklich, aber sie machten immer so deutlich, dass es ihnen nicht recht war. Dass sie es gern sähen, wenn ich das Fliegen endlich aufgäbe. Das quälte mich. Und es wurde über nichts gesprochen. Egal, was ich fragte, es kamen immer ausweichende Antworten oder gar keine. Ich war manchmal so wütend auf meine Eltern, dass es nicht zum Aushalten war. Seit ich nicht mehr bei ihnen wohne, komme ich besser klar damit.“ Trotz meiner locker dahingesagten Worte merkte ich, wie Wut und Traurigkeit in mir aufstiegen. Jetzt wünschte ich mir regelrecht die nächste Frage herbei, bevor es mich ganz ergriff.
Julien ließ mich nicht im Stich. „Als ich mir selbst endlich eingestanden habe, dass ich schwul bin, hab ich ziemlich mit meinem Schicksal gehadert. Nicht wegen der ausgesprochen unangenehmen Begleiterscheinung, dass mir seitdem jede Menge Menschen Gespräche über meine Sexualität aufzwingen oder wenigstens irgendeine Bemerkung dazu loswerden müssen. Das gehört halt jetzt zu meiner Gegenwart. Es war eher die Vergangenheit, die ich beweint habe. Ich hatte das Gefühl, so viel Zeit verschwendet zu haben mit Unzufriedenheit und Unglücklichsein und klagte meine Eltern an, dass sie mir so wenig innere Freiheit gelassen hatten. Aber inzwischen bin ich so weit, dass ich glaube, ich kann frühestens am Ende meines Lebens erkennen, wie alles zusammenhängt und was wofür notwendig war. Wenn meine Eltern nicht solche Moralapostel gewesen wären, hätte ich jetzt keine Martha, und wer weiß, ob ich Gus jemals kennengelernt hätte. Wahrscheinlich auch dich nicht. Ich bin glücklich jetzt – und auch das wird nicht für immer bleiben. Alles ist in Bewegung und es ist ganz schön anmaßend von uns, jede Bewegung zu beurteilen, ohne den Gesamtzusammenhang zu kennen.“
Ich staunte. „Wow, Julien, bist du unter die Erleuchteten gegangen? Du klingst ja wie meine alte Frau Schmidt! Die schwingt auch immer solche Reden.“
„Man tut was man kann“, grinste Julien. „Ganz im Ernst, Gus hat mich auf ein Seminar mitgenommen vor ein paar Wochen, und ich hab richtig Feuer gefangen. Da geht es um inneres Wachstum und universelle Gesetze und so. Die Welt sieht echt ganz anders aus, wenn man sie unter solchen Kriterien betrachtet.“
Hmm. Ich war ein bisschen irritiert. Wenn Frau Schmidt so sprach, dann schrieb ich das immer ihrem Alter und einer daraus entspringenden Weisheit zu. Julien führte das gerade ad absurdum. Er war definitiv nicht alt und es klang sehr schlüssig, was er sagte. Ich war angepiekst. „Erzählst du mir mehr davon?“, fragte ich.
„Sehr gern“, antwortete er, „aber nicht gerade jetzt. Wir sollten uns langsam auf den Weg in Frau Schmidts Laden machen. Ich bin heute Nachmittag noch mit Martha und Gus verabredet und will auf keinen Fall zu spät kommen.“
„Okay, dann – komm ich drauf zurück. Wie siehts aus“, ich schaute ihn an, „bist du bereit für die absolute Sensation?“
„Die hatten wir doch schon“, meinte er, „oder spielst du auf deine geheimnisvolle Bemerkung von vorhin an?“
„Jepp.“
„Tut es weh?“ Das war spaßig gemeint, aber als ich ihn sehr ernst anschaute und den Kopf hin und her wiegte, wirkte er tatsächlich ein bisschen beunruhigt.
„Könnte sein, aber wirklich nicht mehr, als du ertragen kannst.“
Julien räusperte sich. „Können wir es nicht ein andermal machen?“
„Du hast Angst“, grinste ich, „gibs zu!“
„Nein, ich denke nur an die Zeit“, antwortete er mit etwas dünnerer Stimme als sonst.
„Wir sparen Zeit“, entgegnete ich, „und du hast doch Angst!“
„Nein, wirklich nicht – doch, ja, okay! Du bist jetzt Superelli und wer weiß, was du mit mir anstellst …“
„Ich hab nur Spaß gemacht, ehrlich, es tut kein bisschen weh. Es wird dir so viel Freude machen, dass du nicht mehr aufhören willst. Versprochen.“
Er sah mich forschend an und atmete dann hörbar aus. „Also gut, ich vertraue dir ausnahmsweise mal. Was muss ich machen, Superelli?“
„Als Erstes aufhören, mich so zu nennen. Wenn du mir unbedingt einen Spitznamen geben musst, werde ich das wohl nicht verhindern können. Aber der ist wirklich einfallslos. Außerdem bin ich nicht superer als vor zwei Tagen.“
„Das stimmt eigentlich“, sagte er und grinste, „vielleicht eher gemeiner. Du hast schließlich einem Mann den Arm gebrochen.“
Ich zuckte zusammen. Voll erwischt. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht, vor allem nicht, seit Frau Schmidt diese Sachen über die Kameradschaft erzählt hatte. Doch Julien hatte recht. Das war neu an mir und ich musste damit umgehen.
„Also, wie nennen wir dich jetzt“, neckte er mich, „Knochenbrecherelli?“
„Willst du lustig sein?“, fragte ich leicht genervt. Leider musste ich ihm ja innerlich zustimmen und doch wehrte sich alles in mir dagegen, mich so zu sehen. Viel lieber wollte ich weiter so gut sein, wie ich das bisher von mir gedacht hatte. Ich ließ den Kopf hängen.
„Okay, ich gebe zu, ich hab schon bessere Witze gemacht“, sagte er beruhigend, als er sah, wie zerknirscht ich auf einmal war. „Vielleicht bleib ich einfach bei Elli, was hältst du davon?“ Er kam auf mich zu, legte mir die Hände auf die Schultern und gab mir einen Kuss auf die Wange.
Eigentlich hatte ich vorgehabt loszufliegen, wenn Julien mit den Händen auf meinen Schultern hinter mir stand. Jetzt beschloss ich kurzerhand, ihn zu erschrecken, weil er über ein mir sehr ernstes Thema seine Witze riss. Er gehörte bestraft, wenigstens ein bisschen. Also machte ich mich im gleichen Augenblick leicht, verband mich ganz fix mit seinen Zellen und flog los, bevor er richtig kapiert hatte, was mit ihm geschah. Natürlich begriff er sehr schnell, dass er keinen Boden mehr unter den Füßen hatte – und er wirkte noch nicht begeistert. Sollte er ja auch nicht. Ich wollte ihn erst einmal ärgern.
Er schnappte nach Luft und keuchte: „Elli, wir fliegen.“
„Echt jetzt?“ Diesmal grinste ich.
„Ja, echt jetzt“, er wurde richtig laut, „mach keinen Scheiß, lass mich runter! War nicht toll von mir, aber Rache ist keine Option.“
Mist. Er hatte schon wieder recht. Ohne ein Wort schwebte ich sanft zu Boden, entließ ihn auf seine Füße. Sah ihn entschuldigend an und sagte: „Stell dich hinter mich, dann versuchen wir es nochmal, aber diesmal richtig.“
Er lächelte und fragte: „Echt jetzt?“
„Ja, echt jetzt“, antwortete ich und lächelte auch, „na los!“
Juliens Finger wirkten eher wie Klauen, so fest krallte er sie in meine Schultern. Ich wand mich aus seinem Griff und drehte mich zu ihm um. Gab ihm lieber die Hand. Dann verband ich mich mit seinen Zellen und schwebte mit ihm ein paar Zentimeter vom Boden weg. Er schnaufte aufgeregt, hielt aber ganz still in der Luft.
„Siehst du, du brauchst dich gar nicht schlimm festhalten, es geht schon mit einer ganz leichten Berührung“, versuchte ich ihn zu beruhigen.
„Und was ist, wenn wir weiter oben sind und ich abrutsche und runterfalle?“ So leicht war er nicht zu überzeugen.
„Das kann gar nicht passieren“, entgegnete ich, „selbst wenn du abrutschen würdest, könntest du dich immer noch an meinem Bein festhalten und wenn du das nicht erwischen würdest, würde ich dich wieder einfangen, bevor du unten wärst, verlass dich drauf.“
„Beweise es mir“, forderte er. Er war etwas blass um die Nase. Wo war die ganze Begeisterung von vorhin hin? Seufzend stellte ich ihn auf den Boden, schnappte mir einen herumliegenden Ast und schoss ein paar Meter nach oben. „Aufpassen jetzt“, rief ich ihm zu. Ich ließ den Ast fallen, flog parallel mit ihm kopfüber nach unten, ohne ihn zu berühren, und packte ihn kurz vor der Erde. Als ich wieder vor Julien stand und ihn auffordernd ansah, hob er beide Hände.
„Okay, Superel… ‘tschuldigung, ich bin so aufgeregt, war nicht so gemeint, verzeih mir.“
Bevor er noch mehr dummes Zeug stammeln konnte, drehte ich mich um und wartete, bis er seine Hände wieder auf meine Schultern gelegt hatte. Wir hoben sehr langsam vom Boden ab und blieben ein paar Meter bei diesem Schneckentempo, dann legte ich mich in die Waagerechte, damit er meinen ganzen Körper unter sich hatte. Ich flog vorsichtig los, weg vom Weg in den Wald hinein. Wollte nicht riskieren, doch noch einem Spaziergänger zu begegnen und dann nicht schnell genug reagieren zu können mit meinem ungeübten Anhang.
Wir flogen parallel zum Weg in Richtung Parkplatz. Julien entspannte sich zusehends. Er begann nach links und rechts zu schauen und kleine freudige Laute von sich zu geben.
„Sollen wir mal ein bisschen schneller?“, fragte ich.
„Nein“, antwortete er, „jetzt noch nicht, es gibt so viel zu sehen, aber das nächste Mal.“
„Wer sagt denn, dass es ein nächstes Mal gibt?“, neckte ich ihn.
Die Antwort kam prompt. „Ich kann dich zwingen, ich bin Polizist.“
Ich lächelte und schwieg.
Als wir wieder im Wagen saßen, strahlte Julien übers ganze Gesicht. „Ich bin soooo beeindruckt, ich bin geradezu überwältigt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, schade, dass ich es niemandem erzählen kann, ich würde zu gern angeben damit …“
Er beugte sich zu mir herüber, nahm mein Gesicht in beide Hände und drückte mir einen dicken Schmatzer auf den Mund.
Ich musste lachen. „Untersteh dich anzugeben, ganz im Ernst, ich verlass mich auf dich.“
Er hob seinen Zeigefinger an die Lippen und sagte: „Kein Ton, niemals in meinem ganzen Leben, das weißt du.“ Dann startete er den Wagen.
Es war doch später geworden als gedacht, und Julien hatte nicht mehr sehr viel Zeit, als wir am Laden ankamen. Bevor ich aufschloss, warf ich einen Blick durch die Schaufenster. Von draußen war nichts zu sehen, erst als wir im Laden standen. Die Regale der Esoterik- und der Wissenschaftsabteilung im hinteren Bereich waren leergefegt. Alle Bücher lagen kreuz und quer auf dem Boden. Den Rest des Ladens hatten sie in Ruhe gelassen, nur hier und da war ein Stapel umgefallen. Wir gingen weiter ins Lager, wo ich Frau Schmidt gefunden hatte. Hier sah es viel schlimmer aus – so, wie ich es in meiner Erinnerung abgespeichert hatte. Komplettes Chaos, nur Frau Schmidt auf dem Boden fehlte. Kein einziges Buch stand mehr in irgendeinem Regal oder Schrank. Alles lag wild durcheinandergeworfen in mehreren Schichten übereinander. Die Bücher waren zum Teil aufgeschlagen und hatten verknickte Seiten. Manche waren sogar eingerissen. Mittendrin lag der Bildschirm mitsamt allem, was auf dem Schreibtisch gestanden hatte. Wenn diese kranken Hirne nur etwas gesucht hatten, warum hatten sie dann so gewütet? Ich hätte heulen können.
Julien fragte: „Weißt du, welche Bücher Frau Schmidt hier hinten aufbewahrt hat?“
„Nicht genau“, antwortete ich, „zumindest nicht in den Schränken. Die waren immer verschlossen. Sie hat nichts darüber gesagt und ich habe nicht gefragt. Ich nehme an, es sind private Bücher. In den Regalen stand das normale Zeug, was in jedem Buchladen steht, Neuerscheinungen, Bestellungen, Ladenhüter und so weiter.“
Ich sah mir die Titel der oben liegenden Bücher an. Es schien die gleiche Mischung zu sein wie draußen im Laden. Esoterik, Wissenschaft, dazwischen fremdsprachige Bücher, alle alt, gebraucht. Wie ich vermutet hatte, nichts zum Verkaufen. Es waren Frau Schmidts erklärte Interessensgebiete. Nicht umsonst waren genau diese Abteilungen überproportional ausgestattet in ihrem ansonsten viel zu kleinen Buchladen.
„Es macht den Eindruck, als hätten sie gezielt und doch nicht gezielt gesucht“, sagte Julien. „Offensichtlich suchten sie keine Romane.“
„Vielleicht wissen sie es selbst nicht so genau, nur die ungefähre Richtung“, vermutete ich. Ich war mir nicht im Klaren darüber, ob ich Julien sagen sollte, dass Frau Schmidt anscheinend wusste, was sie suchten.
Er nahm mir die Entscheidung ab. „Frau Schmidt hat heute Morgen so eine Andeutung gemacht, dass nur die Kameradschaft etwas Interessantes bei ihr finden könnte – ich glaube, ich muss sie noch mal befragen.“ Guter Polizist. Ich brauchte Frau Schmidt nicht zu verraten.
Julien schaute auf die Uhr. „Wir müssen los, Ellimaus.“
„Ich bleibe noch“, sagte ich, „ich mache ein bisschen Ordnung. Zumindest vorn im Laden.“
Er sah mich besorgt an. „Ich lass dich nicht gern allein hier, das ist dir klar, oder?“
„Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass diese Kameradschaft noch mal in den Laden kommt, solange Frau Schmidt nicht da ist. Es hörte sich viel mehr an, als bräuchten sie sie, um zu finden, was sie suchen. Außerdem ...“, ich zeigte auf mein Handy, „und ...“, ich hob kurz vom Boden ab, „bin ich bestens ausgerüstet.“
Er seufzte. „Du hast deinen Dickschädel nicht erwähnt ...“ Dann legte er mir die Arme um die Schultern und lächelte. „Danke noch mal, dass du mich in dein Geheimnis eingeweiht hast.“
„Gezwungenermaßen“, knurrte ich.
„Egal wie, ich finde es großartig. Und der Probeflug – absolut wiederholenswert!“
„Ich gewöhne mich schon dran, dass jetzt jemand Bescheid weiß“, erwiderte ich, „es fühlt sich gar nicht so schlecht an.“
„Jemand?“, fragte er mit leicht beleidigtem Unterton. „Ich bin dein bester Freund!“
„Zum Glück“, grinste ich, „dann bis morgen.“
„Bis morgen? Sehen wir uns denn?“
„Ich komme natürlich mit, wenn du Frau Schmidt befragst“, sagte ich, „ich befürchte, ich bin mehr in die Sache verwickelt, als mir lieb ist.“
„Was sind denn das jetzt für Andeutungen?“
„Das erkläre ich dir morgen, Schatzi. Deine zwei Süßen warten auf dich, schwirr ab jetzt.“
„Das Schwirren ist ja wohl eher dein Fachgebiet“, maulte er, während er zum Laden hinausschob.
Ich schloss hinter ihm ab und prüfte zur Sicherheit auch noch die Hintertür, die mit einem Vorhängeschloss provisorisch abgesperrt war. Der Türrahmen war ziemlich demoliert, das waren ganz sicher keine Einbruchprofis gewesen. Überall sah man die Spuren einer Brechstange oder etwas ähnlichem. Schon wieder stieg Wut in mir auf. Besser, ich machte mich gleich an die Arbeit.
Obwohl ich mich am liebsten auf die Bücher im Lager gestürzt hätte, fing ich draußen im Laden an. Wenn Frau Schmidt aus dem Krankenhaus kam, sollte sie sofort wieder aufmachen können. Besser, der Laden blieb nicht zu lange geschlossen. Ihr Ordnungssystem war mir vertraut, dazu hatte ich genug Zeit in ihrem Laden verbracht und oft genug geholfen. Ich kam schnell voran mit dem Einräumen. Leider war fast ein Drittel der Bücher beschädigt. Ich stapelte sie aufeinander, um sie nachher ins Lager zu tragen, wenn man sich dort wieder bewegen konnte. Wer bezahlte eigentlich den materiellen Schaden, den diese Verbrecher angerichtet hatten? Ob Frau Schmidt gegen so etwas versichert war? Meine Wut bekam neuen Stoff.
Im Lager wurde es schwieriger mit dem Aufräumen. Nicht nur, dass alles noch schlimmer durcheinandergeworfen war, ich kannte die Bücher nicht und hatte keine Ahnung, was wie zu ordnen sein könnte. Aber ich hatte ja Zeit, musste sowieso warten, bis es dunkel war, um den Ausflug zu meinem Elternhaus zu starten.
Bevor ich loslegte, wollte ich etwas essen. Frau Schmidts Buchladen lag in einer Straße, in der es viele kleine Läden, Cafés und Kneipen gab. Eine eigentümliche Mischung aus alt und modern und die unterschiedlichsten Nationalitäten waren hier vertreten, sowohl bei den Läden als auch beim Publikum. Ich kam gern in diese Straße. Wenn man um die Ecke bog, hatte man das Gefühl, in eine andere Welt einzutreten. Wo andere Gesetze galten als im Rest der Stadt. Alle, die hier ihre Läden hatten oder einkaufen kamen, waren wirklich auf irgendeine Weise anders, selbst wenn sie nicht danach aussahen. „Leben und leben lassen“ schien als unsichtbares Banner quer über der Straße zu hängen. Keiner guckte den anderen schräg an, obwohl das schrägste Volk unterwegs war. Und dazwischen Leute, die man sonst nur in den besseren Einkaufsstraßen sah. Man fiel hier einfach nicht auf, egal wie man daherkam. Dabei herrschte eine Gemütlichkeit, die einen sofort in Ferienstimmung versetzte, selbst wenn man – wie ich – noch nie im Ausland gewesen war. Der Überfall hatte dieses Flair allerdings empfindlich gestört.
Neben Frau Schmidts Laden gab es ein kleines Café, in dem man außer Kuchen auch Bratkartoffeln bekommen konnte. Da ging ich hin. Ich wollte den Nachbarn von dem Überfall berichten und gleichzeitig meinen knurrenden Magen beruhigen. Die Wirtin des Cafés und ihr Mann stürzten sofort herbei. Sie hatten nur den Krankenwagen gehört und wollten alles wissen. Ich erzählte so genau wie möglich, denn ich wusste, dass sie die ganze Straße informieren würden, und dass damit alle ab jetzt ein Auge auf verdächtige Gestalten hätten. Das war der beste Schutz für Frau Schmidt, besser als jeder Personenschutz der Polizei – von dem sowieso fraglich war, ob er weiterging, wenn sie aus dem Krankenhaus kam.
Wieder im Laden begann ich damit, alle Bücher nach Themenkreisen zu ordnen. Musste mich immer wieder zusammenreißen, nicht beim Lesen hängenzubleiben. Es gab so viele interessante Titel. Ich nahm mir vor, Frau Schmidt danach zu fragen, wenn sie zurück war. Die Stapel waren schon ziemlich groß, als mir ein schmales Büchlein auffiel, das ich an seinem Einband wiederzuerkennen glaubte. Es war in einer anderen Sprache geschrieben, einer slawischen vermutlich, und war mit Ornamenten verziert. Ich kam nicht darauf, wo ich es schon einmal gesehen hatte, und warum es mir so wichtig schien. Legte es beiseite, in der Hoffnung, dass es mir noch einfallen würde. Gegen Mitternacht war ich so weit fertig mit dem Sortieren, dass die Bücher nur noch in die Schränke eingeräumt werden mussten. Damit wollte ich warten, bis Frau Schmidt wieder da war. Ich zog meinen Fluganzug an – an so heißen Sommertagen trug ich ihn ausnahmsweise nicht unter meiner Straßenkleidung – packte Skateboard und Klamotten in den Rucksack, stellte das Handy leise und steckte das Büchlein ein. Es hatte etwas mit meiner Suche zu tun, so weit war ich mir unterdessen sicher. Frau Schmidt würde mir gewiss verzeihen.
Heute war ich noch vorsichtiger als sonst auf meinem Weg. Flog von Dach zu Dach, spähte immer wieder nach unten, ob sich irgendetwas bewegte. Doch alles war ruhig. Eine ganz normale Nacht, wenn nicht die Bedrohung dagewesen wäre. Als ich am Haus meiner Eltern ankam, sondierte ich die Umgebung ein letztes Mal, bevor ich das Dachfenster öffnete. Niemand zu sehen. Fast geräuschlos schlüpfte ich hinein und blieb erst einmal ganz oben auf der Leiter sitzen, um mir einen Überblick zu verschaffen. Obwohl ich im Schwebezustand nachts ziemlich gut sehen konnte, brauchte ich eine Taschenlampe. Das Fenster war zu klein, um genug Licht hereinzulassen. Ich hatte eine winzige Funzel eingesteckt, aus Angst, entdeckt zu werden. Die klemmte ich mir zwischen die Zähne, denn ich brauchte beide Hände. Der Dachboden war komplett eingestaubt und roch, wie er immer gerochen hatte. Es sah aus, als hätte er sich nicht verändert in den letzten Jahren. Doch, im vorderen Bereich um die Bodenluke herum waren ein paar Gegenstände dazugekommen, Klappe auf und hineingeschoben. Um die brauchte ich mich nicht zu kümmern. Sie hatten definitiv nichts mit dem Bücherkarton zu tun.
Ich schwebte in Richtung Boden, berührte ihn aber nicht, um so wenig wie möglich Spuren zu hinterlassen. Als ich die Schränke öffnete, sah ich mich alten Bekannten gegenüber. Sie weckten Erinnerungen an die Zeit, die ich hier verbracht hatte. Es kam mir vor, als wären die Sachen seit damals nicht mehr berührt worden. Für meine Suche teilte ich den Dachboden in vier Felder ein und durchkämmte eines nach dem anderen gründlich. Und fand nichts. Das konnte nicht sein.
Ich war mir sicher, dass meine Eltern diesen Karton nicht weggeworfen oder jemand anderem gegeben hatten. Meine Eltern warfen so gut wie nichts weg. Und sie kannten überhaupt niemanden, dem sie vertraut hätten. Wo also hatten sie ihn untergebracht? Der Keller war als Versteck ungeeignet, der Garten ebenso. In der Wohnung würden sie ihn nicht haben wollen. Ich ließ meinen Blick über den Dachboden schweifen und suchte nach Verstecken, auf die ich bis jetzt noch nicht gekommen war. Genau das war es! Das hätte mir auch früher einfallen können – sie hatten den Karton vor mir versteckt, vor niemand anderem! Dann konnte das Versteck nicht in der Höhe liegen. Also der Fußboden. Ich funzelte ihn Brett für Brett ab und wurde schließlich fündig. In einer Ecke waren die Bretter zwischen zwei ankommenden Dachsparren nachträglich mit Schrauben befestigt. Trotz der Staubschicht deutlich zu erkennen. Das musste das Versteck sein.
Schrauben, na klasse! Wo sollte ich jetzt einen Schraubenzieher herbekommen? Im Keller gab es ein bisschen Werkzeug, aber auch noch da runter jetzt? Es war schlimm genug, mich hier oben herumzutreiben, ohne dass meine Eltern davon wussten. Deswegen fühlte ich mich sowieso schon wie eine Einbrecherin. Durch die Wohnung in den Keller zu gelangen, machte es nicht besser. Ich konnte aber auch nicht erst morgen mit einem Schraubenzieher wiederkommen. Die Zeit drängte. Es blieb mir nichts anderes übrig, ich musste hinunter. Bei dem Gedanken fing mein Herz laut zu klopfen an. Ganz leise und vorsichtig öffnete ich die Bodenklappe und schwebte hinaus. Ich wusste, dass sie mich nicht hören würden, aber mein Vater schlief unruhig. Er konnte jeden Augenblick aus dem Schlafzimmer gewankt kommen und mich erwischen.
Deshalb beeilte ich mich. Der Weg war nicht das Problem, eher die Türen. Meine Eltern waren handwerklich nicht interessiert, deswegen quietschten und knarrten die Türen in diesem Haus, seit ich denken konnte. Ich hatte sie ab und zu geölt – gehalten hatte es nie lange. Zum Glück hatte ich noch nicht vergessen, welche Tür ich wie bewegen musste, damit sie möglichst geräuscharm aufging. Mein Training über so viele Jahre ließ sich fast mühelos abrufen. Im Keller, in der Werkzeugschublade mit dem Nötigsten, fand ich den Schraubenzieher, den ich brauchte. Ich huschte zurück nach oben und ging auf die Bretter los. Es dauerte nicht lange, bis ich das erste Brett gelöst hatte. Gespannt lugte ich in das Loch im Boden. Da stand er. Der Karton meiner Erinnerung.
Die Bücher waren gut zu erkennen. Leider schaffte ich es wegen der Dachneigung nicht, an sie heranzukommen. Es blieb mir nichts übrig, als noch ein weiteres Brett abzuschrauben. Dabei versuchte ich, die Staubschicht auf den Brettern und der Umgebung zu erhalten, soweit es ging. Wollte ich nur meine Eltern täuschen oder gar diese grässliche Kameradschaft? Wenn die hier wirklich auftauchen sollte, dann wäre das Versteck wahrscheinlich das wenigste, worum ich mir Sorgen machen müsste …
Vorsichtig nahm ich die Bücher aus dem Karton und packte sie in den Rucksack, ohne sie genauer anzusehen. Dazu hatte ich zu Hause noch Zeit genug. Ich hatte keine Ruhe mehr hier oben. Musste ja noch einmal hinunter in den Keller, um den Schraubenzieher zurückzubringen. Bei der schmalen Ausstattung mit Werkzeug würde das Fehlen dieses einen Schraubenziehers auffallen. Wahrscheinlich nicht sofort, so oft wurde die Schublade nicht benutzt. Doch ich konnte ihn auch nicht hier oben liegenlassen. Und mitnehmen wollte ich ihn schon gar nicht. Sehr umständliche Gedankengänge wegen eines Schraubenziehers – angesichts der drohenden Gefahr und meines Fundes, der vielleicht eines der Rätsel meines Lebens aufdecken würde. Doch so war es. Irgendwie hoffte ich, mit der Herstellung der gewohnten elterlichen Ordnung ihr Leben vor dem Hereinbrechen von unerwünschten Veränderungen bewahren zu können. Obwohl ich wusste, dass es sich anders verhielt, wünschte ich mir, sie hätten nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Sie kamen mir so hilflos vor in all ihrer Ängstlichkeit. In meiner gesamten Kindheit und Jugend hatte ich darunter gelitten, aber genau in diesem Augenblick jetzt konnte ich fühlen, dass sie die eigentlichen Leidtragenden waren.
Während ich die Bretter wieder montierte und den Schraubenzieher wegbrachte, stieg eine tiefe Traurigkeit in mir auf. Ich hatte das unbedingte Gefühl, dass es große Veränderungen in meinem Leben geben würde und dass meine Eltern nur irgendwo am Rande mit dabei waren, weil ihre Angst sie unbeweglich machte. Das schmerzte. Gleichzeitig wollte ich sie beschützen und ihnen ihr erstarrtes Leben lassen, damit sie nicht noch mehr Angst bekämen. Wie bescheuert widersprüchlich. Es bedrückte mich, dass ich keinen Ausweg sah.
Auf dem Heimweg musste ich mich wegen dieser Gefühle und der Neugier auf meine Beute sehr stark konzentrieren. Ich hatte das Bedürfnis, Luftlinie nach Hause zu schießen, und brauchte deshalb all meine Kraft, um mich an meine eigenen Regeln zu halten. Immer im Schatten der Dächer, alle Straßen vor dem nächsten Abschnitt absuchen. Ich wusste, dass das absolut notwendig war und war gleichzeitig entsetzlich ungeduldig. Die Abschnitte flog ich in Rekordzeit. Nachdem ich endlich die Balkontür hinter mir geschlossen hatte, streifte ich im Flug die Schuhe von den Füßen und landete polternd auf meinem Bett. Zerrte mir den Rucksack vom Rücken und leerte den gesamten Inhalt vor mir aus.