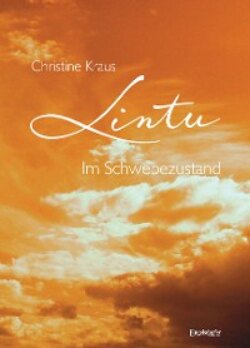Читать книгу Lintu - Christine Kraus - Страница 8
3. Kapitel
ОглавлениеDa lagen sie nun. Das schmale Bändchen aus Frau Schmidts Buchladen und vier ebenso kleine Bücher aus dem Karton. Eins davon sah dem aus Frau Schmidts Laden verdammt ähnlich. Na also. Hatte mich meine Erinnerung nicht getäuscht. Ich sah mir die beiden Bücher genauer an. Sie hatten den gleichen Einband mit dem gleichen Titel: „Lintu“. Ich schlug das Büchlein aus dem Karton auf und las den Untertitel auf der ersten Seite: „The Flying People“. Mir stockte der Atem. Die abgebrochene Bemerkung von Frau Schmidt dröhnte in meinen Ohren. Sie hatte „fliegendes Volk“ sagen wollen, ganz bestimmt. Wenn es das war, was ich glaubte, dann hielt ich ein Buch über mich in den Händen. Über mein Volk.
Ich gehörte zu einem Volk! Bei dem Gedanken wurde mir ganz flau. Gut, dass ich auf meinem Bett saß. Elli – ruhig, befahl ich mir. Du weißt, deine Fantasie ist grenzenlos. Lies erst einmal nach, worum es sich handelt. Obwohl ich mich zur Vernunft rief, probierte ich den Namen schon aus, während ich nach den restlichen Büchern griff. Lintu – wollte ich so heißen? Guten Tag, ich bin eine Lintu. Hello, I belong to the Flying People. Das hörte sich gut an. Sehnsucht stieg in mir auf. Seufzend wandte ich mich den anderen Büchern zu. Sie waren alle gleich, mit einem weichen braunen Ledereinband, keine harten Deckel, eher Hefte. Sie waren alle eng beschrieben, in einer leicht schräg gestellten, kleinen Handschrift. Es machte den Eindruck, als hätte sich jemand Mühe gegeben, so klein zu schreiben, damit mehr hinein passte, denn nirgends war ein Rand gelassen. Die Schrift war kein Sütterlin, wie ich ursprünglich angenommen hatte. Ich war wohl nur als Kind nicht mit ihr zurechtgekommen, genau wie mit der englischen Sprache des Büchleins. Ich entzifferte die ersten Zeilen:
Tagebuch von Elisabeta Marante. Elisabeth, mein Vorname.
13. Januar 1955. Simón und ich geben den Kampf auf. Wir werden Alfonso, unseren kleinen Sohn, holen und nach Südamerika gehen. Zu den Letzten unseres Volkes.
Da, schon wieder dieses betörende Wort. Ich war so aufgeregt, dass ich fast nicht atmen konnte.
Simón hat endlich eingesehen, dass sich unsere Gruppe in eine Richtung bewegt, die immer weiter von unseren Idealen abweicht. Zu Beginn traten wir für die Befreiung der spanischen Bevölkerung von Franco ein. Die stolzen Spanier jedoch ließen sich von Francos Regime einschüchtern wie seinerzeit die Deutschen von Hitler. Als Tomás, Bodo und Rosaura sich vor sechs Monaten von uns trennten, wollte Simón diese Entwicklung so wenig wahrhaben wie Javier, unser Anführer. Der Kampf gegen Hitler mündete in die Freiheit der Überlebenden. Der gleiche Kampf gegen Franco wird ins Abseits führen. Wir müssen erkennen, dass nicht alles, was bei dem einen geholfen hat, bei dem anderen ebenso fruchtet. Javier jedoch will nicht aufgeben, obwohl es immer weniger Rückhalt in der Bevölkerung gibt. Er hat sich ein neues Ziel gesteckt, neue Mitstreiter gewonnen – und wird immer radikaler. Sein Kampf gilt nun der Unabhängigkeit. Er schreckt nicht davor zurück, Anschläge zu planen, Opfer auszuwählen, um Franco in die Knie zu zwingen und die Welt aufzurütteln, wie er sagt. Doch wir sind Kämpfer, keine Terroristen. Ich kann darin keinen Sinn erkennen. Ganz im Gegenteil halte ich diese Vorgehensweise für falsch. Simón ist meiner Ansicht. Es tut mir leid um Javier, dennoch bin ich froh, dass wir die Gruppe rechtzeitig verlassen werden.
Ich musste eine kurze Pause einlegen. Wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte über das, was ich da las. So lange hatte ich darauf gewartet, etwas über mich, über meine Vergangenheit zu erfahren, und jetzt wusste ich nicht, ob ich es wirklich erfahren wollte. Ob ich das wissen wollte, was sich da ankündigte. Etwas ganz und gar anderes als eine einfache, normale Vergangenheit. Das gehörte alles zu mir, soviel konnte ich fühlen. Aber nicht mehr. Wo würde es hinführen? Frau Schmidt musste Elisabeta sein! Es ging nicht anders. Sie musste meine Großmutter sein! Und Alfonso mein Vater, Alfons, er hatte nur das O weggelassen. Wenn mein Vater ein Lintu war, warum konnte er nicht fliegen? Warum hatte seine Mutter ihn verlassen, wo sie ihn doch so offensichtlich liebte? Oder hatte er sie weggeschickt? Warum hatte sie mich verlassen? Liebte sie mich nicht? Sie hatte mich geliebt. Liebte sie mich nicht mehr? Warum schwiegen sie – alle? Warum sollte ich jetzt diese Bücher suchen? Warum jetzt alles erfahren? Sollte ich alles erfahren? Oder wieder nur so viel, wie es ihnen passte? Wer waren „sie“? Ich ächzte. Das Heft glitt mir aus der Hand. Ich ließ es liegen, schloss die Augen.
All die Fragen, die ich mir jemals zu meiner Familie und meiner Vergangenheit gestellt hatte – und das waren unzählige – brachen hervor. Als hätten sie direkt unter der Oberfläche auf eine günstige Gelegenheit gelauert. Verbanden sich mit der Flut an neuen Fragen, die nach der Lektüre dieser wenigen Zeilen aufgetaucht war, zu einem wogenden Meer. Ich hatte das Gefühl, ich müsste unter seiner Masse zusammenbrechen. Doch es hörte nicht auf anzuwachsen. Es wurde immer schlimmer. Vielleicht waren meine Fragen ja noch nicht einmal die richtigen Fragen! Die meisten basierten auf meinen Annahmen, meinen Schlussfolgerungen, die sich in all den Jahren des familiären Schweigens mühsam entwickelt hatten. Ich war ein Kind gewesen, als ich die ersten Mutmaßungen angestellt hatte. Wenn nun nichts von alledem stimmte – konnte ich das ertragen? Wenn Frau Schmidt wirklich meine Großmutter war, würde ich damit zurechtkommen? Und wenn sie es nicht war, was war dann? An jede einzelne Frage schlossen sich hundert neue an.
Unerträglich. Unerträglich.
Ich sank auf dem Bett zusammen. Versuchte mich zu orientieren, versuchte krampfhaft, wieder normal zu denken, mich daran zu erinnern, wer ich war. Es gelang mir nicht. Alles kreischte durcheinander, Bilder, Sätze, Feststellungen, Aussagen, neue Bilder, neue Fragen. Mir wurde schlecht. Auf meiner Stirn bildeten sich Schweißperlen. Das Durcheinander in meinem Kopf steigerte sich zu einem ohrenbetäubenden Dröhnen. So sehr ich es versuchte, ich konnte mich nicht mehr gegen die Last der Fragen stemmen. Sie drückten mich unter die Oberfläche, in die Dunkelheit – und ich gab nach … Plötzlich war alles still.
Schwärze in meinem Kopf, Schwärze in der Brust.
Mein Körper – taub. Mein Gefühl – taub. Gedanken – gab es nicht.
Ich lag auf dem Bett und starrte an die Decke. Durch die Decke hindurch.
Ins Nichts. Es gab nichts mehr um mich herum.
Es gab nichts mehr in mir. Nicht einmal mehr Schwärze.
Es gab mich nicht mehr.
Nichts. Unendliches Nichts …
Unendliches, ewiges Nichts.
Und dann, inmitten dieser Unendlichkeit, wurde aus dem Nichts Alles.
Etwas erwachte. Ganz entfernt, wie eine Ahnung. Wie ein durchsichtiger Hauch. Etwas wuchs, gewann an Bedeutung. Begann eine nebelige Gestalt zu formen, in Gewebe umzuwandeln, das an meinen Körper erinnerte, begann Farben zu erzeugen, Bilder, die ich kannte. Ich konnte etwas wahrnehmen, das ich war. Ich konnte spüren, wie es sich ausbreitete, meine Zellen neu bildete. Es ließ mich meinen Atem empfinden, meinen Herzschlag, meinen Leib, meine Gliedmaßen. Es machte mich stark. Als es in meinem Gehirn angekommen war, konnte ich es definieren. Es war Mut. Der Mut hinzuschauen. Das zu betrachten, was gewesen war. Das anzunehmen, was daraus folgte. Das zuzulassen, was deshalb werden würde. Ja. Ich konnte es deutlich fühlen, war ganz ausgefüllt davon. Ja! Ja, ich will! Ich will alles erfahren! Egal, was dabei herauskommt. Das ist mein Leben. So ist mein Leben. Es wird mich nicht umbringen. Ich bin stark genug. Ich bin Elli, Tochter der Lintu.
Da war ich also wieder und die Theatralik hatte mich zurück. „Ich bin Elli, Tochter der Lintu.“ Ich hatte definitiv einen Hang zum Dramatischen. Nicht nur Julien. Aber das machte mir jetzt gerade gar nichts aus. Ich fühlte mich wie neugeboren. Sauste in die Küche, pumpte eine volle Flasche Wasser ab – und las die ganze restliche Nacht, bis der Morgen dämmerte.
Ich hatte noch nicht die Hälfte durch. Trotzdem war nichts mehr so, wie es vorher gewesen war. Elisabeta Marante, Simón und ihr kleiner Sohn Alfonso flogen – so wie ich! Da stand es, in dieser leicht schräg gestellten kleinen Schrift, schwarz auf weiß. Elisabeta und Simón flogen nach Kanada, um Alfonso abzuholen und dann flogen alle drei zurück. Natürlich konnte nirgends stehen, dass ich mit diesen Lintu verwandt war, doch es konnte auch nicht anders sein. Und Frau Schmidt war Elisabeta und meine Großmutter. Ob sie sich jetzt, nachdem ich die Bücher gefunden hatte, dazu bekennen würde?
Ich war noch nicht weit genug mit der Lektüre, um alle Rätsel lösen zu können, die mich mein Leben lang gequält hatten. Doch immerhin wusste ich nun, woher meine Fähigkeit zu Fliegen kam. Mein Vater konnte es also, oder hatte es zumindest gekonnt, als er klein war. Obwohl ich nicht glaubte, dass man das jemals verlernen könnte. Er hatte mich angelogen. Meine Mutter wusste es bestimmt. Auch sie log. Meine Großmutter – Frau Schmidt – log ebenfalls, indem sie schwieg. Das schmerzte ganz außerordentlich, hatte schon immer geschmerzt. Seit Großmutter mich verlassen hatte, war es vorbei gewesen mit meinem Vertrauen in die Erwachsenen. Alles hatte sich falsch angefühlt, auch wenn ich es nicht beweisen konnte. Diese Bücher hier legten Zeugnis davon ab, dass ich immer richtig gefühlt hatte.
Seltsamerweise kam der Beweis nicht als Triumph daher, sondern färbte das Geheimnis, hinter das ich kommen wollte, noch dunkler. Es hatte an Realität gewonnen, an Gewicht. Als ob es schwerwiegende Gründe für seine Existenz gäbe, nicht die bloße Bosheit von Eltern, die ihr Kind ärgern wollten. Diese Veränderung machte es mir leichter, die Geduld aufzubringen, mit meinem Urteil bis zum Ende der Lektüre zu warten. Es ließ sogar einen neuen Gedanken in mir erwachen, einen Gedanken, den ich bis dahin niemals für möglich gehalten hätte. Was, wenn das Geheimnis kein Akt der Willkür, sondern im Gegenteil eine Notwendigkeit gewesen wäre?
Das erste Buch von Elisabeta handelte von ihrem Kampf gegen das Francoregime und die Verfolgung durch die Kameradschaft. Sie beschrieb die Stationen dieses Kampfes, ihre eigene Rolle, die der Mitglieder ihrer Gruppe. Ich konnte mir gut vorstellen, warum die Kameradschaft diese Bücher haben wollte. Ich war mitten im zweiten Buch, als mir die Verantwortung bewusst wurde, die seit heute Nacht auf meinen Schultern ruhte. Elisabeta und Simón hatten gerade ihren Sohn wiedergesehen. Auch hier gab es auf dem Weg der beiden nach Kanada eine Menge Menschen, deren Namen vor der Kameradschaft geschützt werden mussten. Mein Herz begann sehr laut zu klopfen. Niemals, unter keinen Umständen, durften die Bücher in die Hände der Kameradschaft fallen. Als Erstes musste ich mit Frau Schmidt – ich konnte mich noch nicht daran gewöhnen, dass die Person im Tagebuch und meine Großmutter und Frau Schmidt identisch waren – darüber sprechen, was mit den Büchern geschehen sollte, wenn ich sie fertig gelesen hatte.
Ich warf einen Blick auf die Uhr. Es war kurz vor fünf. Zu früh, um im Krankenhaus zu erscheinen. Ich hatte noch Zeit weiterzulesen. Doch ich zögerte. Bis jetzt war alles gut gegangen in der Geschichte. Nun musste der schlimme Teil kommen. Den Frau Schmidt – Großmutter – schon angedeutet hatte. Es musste eine schlimme Geschichte sein, sonst wäre kein Geheimnis nötig gewesen. Sonst wäre mein Vater nicht, wie er war, sonst würde meine Großmutter nicht schweigen. Plötzlich wurde mir klar, dass ich keine Tagebücher im klassischen Sinn vor mir hatte. Es war eine Beschreibung der Geschehnisse, nachdem das Schreckliche eingetreten war. Es klang aus jeder Zeile, lugte hinter jedem Wort hervor. Es hatte von Anfang an mitgeschwungen. Seit ich mit dem Lesen begonnen hatte, erwartete ich es. Nun wollte ich nicht eintauchen in dieses Schreckliche und dann mittendrin aufhören müssen, weil die Zeit nicht reichte. Doch es gab noch einen anderen Grund für mein Zögern. Ich fürchtete mich ganz einfach davor, mehr zu erfahren. Dieses über zwanzig Jahre gehütete Geheimnis aufzulösen und vielleicht den Preis nicht bezahlen zu können. Die Wirklichkeit vielleicht nicht zu verkraften.
Hatte ich das jetzt ernsthaft gedacht? Ich hatte immer noch Angst davor, die Wirklichkeit nicht zu verkraften? Was war ich denn für ein Feigling? Meine Großmutter, mein Vater, meine Mutter mussten mit dieser Wirklichkeit leben. Niemand hatte Rücksicht auf ihre Gefühle genommen. Aber Sensibelchen Elli beanspruchte Schonfrist vor der Wirklichkeit. „Ich bin Elli, Tochter der Lintu.“ Wann hatte ich das noch gleich gedacht? Und mich wie eine Heldin gefühlt? Eine knappe halbe Nacht war das her. Na klasse.
Jetzt musste ich ganz schnell etwas tun, um nicht gleich wieder in ein Loch zu fallen. Herrje, es war aber auch schwierig gerade. Und ich war so ungeduldig! Vielleicht sollte ich ein bisschen Verständnis für mich selbst aufbringen? Seit vorgestern lief doch nichts mehr nach Plan. Mir fiel ein Spruch ein, den ich vor kurzem gehört hatte: „Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach Pläne“ – oder so ähnlich. Damit waren wahrscheinlich die Pläne gemeint, die nichts mit dem richtigen Leben zu tun hatten. Mein Leben kam mir gerade so vor, als sei es bisher neben dem richtigen Leben hergelaufen. Ich ging in den Schwebezustand. Das half immer. Und anschließend unter die Dusche. Das half diesmal auch – abgesehen davon, dass ich es nötig hatte.
Danach machte ich mich auf den Weg zu Frau Schmidt, nein, zu Großmutter. Nein, zu Frau Schmidt – noch hatte sie sich nicht zu erkennen gegeben. Unterwegs spielte ich verschiedene Szenarien durch, wie ich ihr begegnen würde. Ich könnte mit dem Satz: „Ich habe es gefunden“ ins Zimmer treten. Ich könnte eintreten und „Großmutter“ sagen, nichts weiter. Oder ohne ein Wort ins Zimmer kommen, an ihr Bett treten und ihre Hand nehmen. Die Verbindung herstellen. Entscheiden konnte ich mich nicht. Jede einzelne Möglichkeit hatte das Potential zu einer schmissig dramatischen Szene, die ich mir bis ins Detail ausmalte, um nicht vor Aufregung in die Knie zu gehen.
Der Pförtner ließ mich nicht vorbei. Er zeigte mit vorwurfsvoller Miene auf eine Uhr an der Wand. Oha, es war immer noch erst kurz nach sechs, obwohl nach meinem Gefühl mindestens zwei Stunden vergangen waren, seit ich aufgehört hatte zu lesen. Also trollte ich mich zurück auf den fast leeren Parkplatz, um mir die Zeit mit dem Skateboard zu vertreiben.
Die wenigen Bäume, die hier herumstanden, waren überbevölkert mit zwitschernden Zeitgenossen, die genauso hellwach waren wie ich. Es würde wieder heiß werden heute, ein weiterer richtiger Hochsommertag. Jetzt am Morgen war es noch schön kühl. Wenn ich im Schwebezustand war, machte mir das jeweilige Wetter allerdings nicht viel aus. War es heiß, schwitzte ich selten und fror fast gar nicht, wenn es kalt war. Das war sehr praktisch, weil zu viele Klamotten beim Fliegen störten. Auf das Wetter von morgen hingegen reagierten meine Zellen empfindlich. Ich spürte jeden Wetterumschwung immer ungefähr einen Tag im Voraus. Wetterfühlig wie Frösche oder Kriegsversehrte. Ausgesprochen nützliche Fähigkeit.
Bis auf wenige Fahrzeuge gehörte der Parkplatz mir. Ich ging mein Repertoire an Kunststücken durch und stellte verwundert fest, dass diese Zeit vorbei war. Es war nett, sie zu können, das schon, aber nicht mehr lebenswichtig, wie gestern noch. Die Tagebücher hatten nicht nur meine Pläne auf den Kopf gestellt. Sie hatten mich verändert. Ein neues Elli-Zeitalter war angebrochen. Um halb sieben hatte ich genug gewartet. Drehte noch eine letzte Parkplatzrunde, um mich dann zu Frau Schmidt aufzumachen, hielt routinemäßig Ausschau nach eventuellen Beobachtern. In einem der parkenden Autos saßen zwei Personen. Die hatte ich nicht bemerkt, als ich vorhin auf den Parkplatz gekommen war. Komisch. Ganz beiläufig warf ich einen Blick in das Auto. Ein Mann und eine Frau. Sie schienen sich zu unterhalten und mich gar nicht wahrzunehmen. Irgendwie machte mich die Szene stutzig. Es gab so eine inszenierte Unauffälligkeit. Und – was machten die so früh hier? Warum stiegen sie nicht aus? Ich lenkte das Board hinter den Wagen und sauste dann so weit weg, dass sie annehmen mussten, ich könnte nichts mehr erkennen. Richtig vermutet. Beide hatten sich nach mir umgedreht und die Frau blickte durch eine Kamera mit einem ziemlich großen Objektiv. Bevor sie mich fotografieren konnte, war ich schon wieder weg. Ich durfte mich zwar nicht durch meine Geschwindigkeit verraten, konnte aber auf dem Board so herumwackeln, dass sie nur irgendetwas Verwischtes auf dem Foto haben würde. Trotzdem war ich aufs Höchste alarmiert. Entfernte mich schleunigst vom Parkplatz und mogelte mich durch den Lieferanteneingang nach drinnen, bevor sie mir folgen konnten.
Frau Schmidt saß aufrecht im Bett, als hätte sie mich schon erwartet. Ich sah ihr in die Augen und sie lächelte mich an. Sie wusste, dass ich wusste. Und sie freute sich.
„Ich habs gefunden“, sagte ich und sparte mir die Begrüßung.
Sie nickte. „Wie viele?“
„Drei Tagebücher, ein englisches Buch. Das gleiche lag im Lager, aber in einer anderen Sprache. Das habe ich mitgenommen.“
„Wo hast du sie?“
„Hier, in meinem Rucksack.“
Sie nickte wieder. „Gut. Lasse sie nicht mehr aus den Augen.“
Jetzt wollte ich eine Frage stellen, zögerte jedoch, weil ich mich scheute, sie einfach so mit „du“ anzusprechen. Aber die eigene Großmutter siezen ging gar nicht. Ich holte tief Luft. „Willst du sie sehen?“
„Nein.“ Keine Reaktion auf meine Anrede. Gut.
„Warum nicht?“
„Es ist besser, sie bleiben verborgen.“
Dann schwieg sie. Ich wartete, aber sie sagte nichts mehr. Irritierend. Sie musste doch jetzt noch etwas sagen. Irgendetwas, was mir einen Hinweis gab, wie es weitergehen sollte. Doch sie schwieg. Beharrlich. Freundlich. So, dass ich wieder nichts zu fragen wagte. Sie war jetzt zwar meine Großmutter, aber nicht weniger streng, und eigenwillig wie vorher. Erst kurz bevor Julien eintreffen sollte, begann sie zu sprechen. Sie sah mich eindringlich an, ließ mich nicht aus den Augen und sagte sehr leise: „Du musst weg von hier, raus aus Europa. Melde dich in Moskau an der Universität zu einem Auslandssemester an. Gib deine Wohnung auf, verabschiede dich von allen und fahre dorthin, so bald du kannst. Du darfst keine Zeit verschwenden. In Moskau kommst du offiziell an, mit Gepäck und allem drum und dran. Das Gepäck entsorgst du dann so, dass niemand deine Spur nachverfolgen kann und machst dich sofort auf den Weg nach Paris. Illegal. Die Adresse steht im Tagebuch. Dort bekommst du Papiere in jedes Land der Welt.“
Paris. Bis dahin hatte ich noch nicht gelesen. Sie wollte tatsächlich, dass ich Deutschland verließ, nein, Europa. Ich hatte schon oft daran gedacht wegzugehen, meine Wurzeln zu suchen, wenn … Es gab viele Wenns. Aber zum ersten Mal, und das erst seit vorgestern, ein konkretes. Das ging ganz schön schnell. Na gut. Ich würde also für eine Weile mein Studium unterbrechen und die Wurzelsuche vorziehen. In Südamerika. Wie auch immer ich die Stecknadel im Heuhaufen finden wollte.
„Für wie lange?“, fragte ich.
„Solange die Kameradschaft gefährlich für dich ist.“
Das hörte sich nicht gut an. Gar nicht gut. Mein Zwerchfell wurde bretthart. Ich bekam kaum noch Luft. „Wie lange ist das?“, flüsterte ich.
„Mindestens ein paar Jahre“, antwortete sie. „Vielleicht für immer.“
Für immer … Für immer! Das war neu. So war der Plan nicht gewesen. Mein Plan nicht!
Meine Gliedmaßen wurden so taub wie heute Nacht, in meinem Kopf breiteten sich dumpfe Schwaden aus, meine Brust war von einem riesigen Stein ausgefüllt. Ich konnte nichts fühlen, nichts spüren. In meinem Verstand drehten sich diese beiden Wörter im Kreis.
Für immer.
Alle verlassen, die ich liebte.
Für immer.
Meine kleine Schwester. Julien, Martha, Gus. Meine Eltern.
Für immer.
Meine – Großmutter!
„Und – du?“, fragte ich. Es war mir jetzt egal, wie sie das fand. Es gab nichts mehr zu verlieren. Ich musste weg, für immer!
Sie sah mich an und schwieg.
„Ich gehe nur, wenn du mitkommst.“
Sie schwieg.
„Großmutter, ich gehe nicht ohne dich.“
Sie schwieg.
„Du kannst mich nicht dazu zwingen.“
Scheinbar doch – sie schwieg.
Verzweifelt suchte ich nach einem Ausweg. Fand keinen. Mir fiel nichts ein als mein eigener Spruch auf dem Parkplatz: „Ein neues Elli-Zeitalter ist angebrochen.“ Wie bitter der Beigeschmack auf einmal war.
Ich spürte, wie die Tränen in mir aufstiegen, da kam Julien zur Tür hereinspaziert. Großmutter wollte nicht, dass Julien etwas mitbekam, das war nicht schwer zu erkennen. Also kämpfte ich die Tränen hinunter und ging unauffällig in den Schwebezustand. Das half auch in solchen Fällen. Vorläufig hatte Großmutter das letzte Wort. Doch ich würde weiter nach einem Ausweg suchen und später darauf zurückkommen. Sie war nicht der einzige sture Mensch in diesem Zimmer.
Ich erzählte Julien von dem Wagen mit den zwei Beobachtern. Wir fanden ein Fenster im Flur, von dem aus man den Parkplatz ziemlich gut überblicken konnte. Der Wagen war weg. Wie hätte es anders sein können. In jedem vernünftigen Kriminalfilm war das so. Allerdings hätte ich jetzt lieber in einer Komödie gesteckt. Auf dem Weg zurück zum Krankenzimmer musterte ich Julien von der Seite. Versuchte vergeblich, mir vorzustellen, dass ich diesen lieben Menschen nicht mehr wiedersehen sollte. Nie mehr. War es überhaupt möglich, sich klar zu machen, was diese Begriffe wirklich bedeuten: „für immer“, „nie mehr“? Solche Abschiede waren bisher in meinem Leben nicht vorgekommen. Selbst als Großmutter verschwunden war, war ich der festen Überzeugung gewesen, dass ich sie wiedersehen würde. In diesem Fall hatte ich recht behalten, auch wenn es verdammt lange gedauert hatte. Konnte das schon als ausreichende Begründung für einen weiteren Versuch gelten, „für immer“ und „nie mehr“ einfach nicht zu akzeptieren?
Julien unterbrach meine trotzigen Bemühungen, der Realität ein anderes Gesicht zu geben. Er ging seiner Arbeit nach, bat mich um eine Beschreibung des Wagens und der Insassen, gab die Daten an seine Kollegen weiter und wandte sich dann an Großmutter mit den Fragen, die er ihr gestern nicht gestellt hatte. Wieder einmal war ich froh über die Sachlichkeit, die er damit in meine Gedanken brachte. Stürzte mich auf sie, als gäbe es nichts Wichtigeres. Ich war aber auch tatsächlich gespannt, wie Großmutter seine Frage beantworten würde, was die Kameradschaft bei ihr gesucht habe. Sie erzählte ihm von den Büchern, schilderte in groben Zügen den Inhalt.
„Wie konnte die Kameradschaft von den Büchern erfahren?“, fragte Julien.
„In der ersten Zeit, als ich nach Deutschland zurückgekehrt war, nahm ich Kontakt mit Javier auf“, antwortete Großmutter, „wir schrieben uns regelmäßig. In meinem vorletzten Brief fragte ich ihn, was er davon hielte, wenn ich unsere Geschichte aufschriebe, um sie der Nachwelt zu erhalten. Er antwortete nicht, auch nicht, als ich ihm noch einmal schrieb. Das beunruhigte mich außerordentlich. Er lebte damals in Madrid und ich beschloss, mit Alfonso nach Madrid zu fahren, um nach ihm zu sehen. Wir hatten ja beide kein Telefon. Javier wohnte nicht mehr dort, wo ich meine Briefe hingeschickt hatte. Eine Nachbarin sagte, er sei weggezogen. Niemand im Viertel wusste wohin. Ich fragte jeden, der mir über den Weg lief – ohne Erfolg. Es gab weder eine Spur von ihm noch von den Briefen.“ Großmutter schwieg einen Augenblick. Dann fuhr sie fort: „Nach mehreren Tagen erfolgloser Suche kam mir auf der Straße eine junge Frau entgegen und sagte im Vorbeigehen so schnell, dass ich es kaum verstand, ich solle aufhören, herumzufragen, wenn mir mein Leben und das meines Sohnes lieb seien. Auf mein eigenes Leben gab ich zu dieser Zeit nicht viel, doch ich wollte Alfonso nicht noch einmal irgendeiner Qual aussetzen. Mein armes Kind hatte bereits genug für mehrere Leben durchgemacht. Ich lief der Frau hinterher, um mit ihr zu sprechen, aber sie bog um eine Straßenecke und verschwand spurlos. Ich nahm die Warnung sehr ernst und reiste wieder ab. Seit diesem Tag nahm ich zu allen meinen Freunden nur noch Kontakt auf, wenn es wirklich sein musste. Von Javier habe ich nie mehr gehört.“
Sie schüttelte gedankenverloren den Kopf. Dann sah sie Julien direkt an. „Dass die Kameradschaft von den Büchern weiß, kann nur bedeuten, dass sie Javier aufgespürt haben und dass er jetzt tot ist. Freiwillig hätte er ihnen meine Briefe niemals überlassen. Ich frage mich allerdings, warum er sie aufgehoben hat. Das war nicht besonders klug. Genauso wenig, wie sie überhaupt zu schreiben.“ Großmutter starrte vor sich hin, ein tiefes Bedauern spiegelte sich in ihrer Miene.
„Wo sind die Bücher jetzt?“, wollte Julien wissen.
„Ich habe sie schon vor zwanzig Jahren jemandem gegeben, damit er sie für mich aufbewahrt. Ich fürchtete immer, sie könnten der Kameradschaft in die Hände fallen, nachdem Javier verschwunden war.“
„Und dieser Jemand …?“, fragte Julien.
„… ist letztes Jahr gestorben“, ergänzte Großmutter. „Als ich von seinem Tod erfuhr, hatten seine Kinder den Nachlass schon aufgeteilt. Die Bücher waren nicht mehr da.“
Sie log! Sie wollte nicht, dass die Bücher bei der Polizei landeten. Sie wollte unser Volk schützen. Nicht auszudenken, was geschehen würde, wenn die Bücher in die falschen Hände gerieten. Nicht nur irgendwelche Leute von der Kameradschaft, auch Wissenschaftler, Politiker, Journalisten hatten in diesem Zusammenhang falsche Hände. Nicht auszudenken, was allein mit meinem Vater, ihr und mir geschähe, wenn unsere Herkunft bekannt würde. Ich war ihr dankbar, auch wenn es Julien war, den sie anlog. Den wir gemeinsam anlogen. Julien ließ sich von ihr den Namen des Verstorbenen geben und die Adresse seiner Verwandten. Er würde nicht so schnell aufgeben.
Die Tür wurde geöffnet und ein Arzt kam herein. Er hielt ein Klemmbrett mit Unterlagen in der Hand und trat an Großmutters Bett.
„So, dann wollen wir mal sehen, ob wir Sie heute entlassen können“, sagte er in dem munteren Medizinertonfall, der meinem Eindruck nach besonders häufig bei alten Leuten angewendet wurde. Er nahm ein paar flüchtige Untersuchungen an ihr vor und nickte dann. „Sie können sie gleich mitnehmen“, wandte er sich an Julien und begann, die Papiere auszufüllen. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätte noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Hier war sie wenigstens sicher. Wenn sie wieder im Laden wäre, würde nur das Gebäude überwacht. Doch Julien und Großmutter verbündeten sich mit dem Arzt, und mir blieb nichts übrig, als ihre Siebensachen einzupacken.
Julien ließ es sich nicht nehmen, sie persönlich nach Hause zu bringen. Im Laden verabschiedete er sich, nachdem er die Überwachung organisiert hatte. Ich fragte mich, der wievieltletzte Abschied das wohl war und die Traurigkeit hatte mich wieder, nun, da ich niemandem mehr etwas vormachen musste.
Bei Großmutter setzte ich an der gleichen Stelle an, an der ich im Krankenhaus hatte aufhören müssen. Auch sie nahm den Faden wieder auf, gleiches freundliches Lächeln, gleiches Schweigen. Ich hatte die Wahl zwischen Wut und Verzweiflung, mehr fiel meinem System in diesen Stunden der Entscheidung nicht ein. Ich wählte die Wut, alles war besser als zu verzweifeln. Verzweifeln hieß aufgeben. Das hatte ich nicht vor. Probehalber funkelte ich Großmutter an und stellte meine Forderung noch einmal: „Ohne dich gehe ich nicht weg.“
Großmutter hatte meinen Stimmungsumschwung wohl bemerkt und setzte einen ihrer strengsten Blicke auf. „Du wirst jetzt unsere kostbare Zeit nicht mit dieser Albernheit verschwenden“, sagte sie kühl. „Schwing dein Hinterteil aus dem Laden und beginne mit den Vorbereitungen. Heute Abend will ich Ergebnisse sehen.“ Damit wandte sie sich um und ging, noch etwas wackelig, nach hinten in ihr Lager.
Diese Art von Ansagen kannte ich bereits aus der Frau-Schmidt-Zeit. Nichts mehr zu machen. Auch wenn es mich ärgerte, dass sie mich behandelte wie ein kleines Kind, trollte ich mich seufzend. Vielleicht benahm ich mich ja wirklich so. Ich sollte mich einfach auf das konzentrieren, was jetzt zu tun war. Wenn sie es so dringend machte, dann war es dringend.
Den Rest des Tages verbrachte ich damit, einen Aktionsplan aufzustellen und die Informationen zusammenzutragen, die ich benötigte. Als Erstes kündigte ich die Wohnung, sie hatte die längste Frist. Ansonsten konnte ich innerhalb einer Woche hier verschwinden und alles so hinterlassen, als käme ich in einem Jahr wieder. Das war der Plan. Die Kameradschaft würde mir in Russland hoffentlich nicht allzu genau auf den Fersen bleiben, um sich nicht unter die „Kommunisten“ begeben zu müssen. Sie würde in Deutschland auf meine Rückkehr warten. Auf diese Weise könnte ich mir ein Jahr Vorsprung verschaffen, wenn alles gut ging.
Es wurde schon dunkel, als ich mich auf den Weg zum Laden machte. So warm, wie es noch war, hoffte ich, Großmutter zu einem kleinen Getränk im Café nebenan überreden zu können. Man saß dort sehr nett draußen. Außerdem wollte ich wenigstens ein paar Antworten bekommen, bevor ich mich verabschieden musste. An meinen Besuch bei Großmutter würde ich endlich wieder eine Flugnacht hängen. Zwei Tage ohne kamen mir viel zu lang vor. Skaten konnte das nicht ersetzen.
Mit ziemlicher Geschwindigkeit bog ich um die letzte Ecke – und befand mich mitten in einer Schießerei. Zumindest dem Hören nach. Das Geballer kam aus der Richtung des Ladens. Für einen Augenblick verkrampfte ich mich ganzkörperlich. Gleichzeitig begann mein Herz bis zum Hals zu schlagen. Ich verdoppelte mein Tempo und war in wenigen Sekunden an der Hintertür des Ladens angelangt. Das Vorhängeschloss war zu. Vorn im Laden wurde geschossen. Mit zitternden Fingern nestelte ich den Schlüssel aus dem Rucksack und öffnete das Schloss. Außer den Schüssen konnte ich fast nichts hören, weil mein Herz bis in die Ohren schlug. Ich schlüpfte durch die Tür und blieb im Dunkeln stehen. Musste mich erst einmal beruhigen, um wieder handlungsfähig zu werden. Erstaunlicherweise half der Schwebezustand gerade wenig. Nach einer Ewigkeit, obwohl wahrscheinlich nicht mehr als eine Minute vergangen war, hatte ich wieder alle Sinne beisammen. Vorsichtig ging ich ein paar Schritte in Richtung Laden. Die Tür stand halb offen. Ein schwaches Licht fiel herein und in diesem Lichtschein lag Großmutter auf dem Boden.
Ich kam mir vor, als hätte ich ein Déjà-vu. Wollte es nicht glauben, doch da lag sie, mit geschlossenen Augen wie beim ersten Mal, nur diesmal war es richtig schlimm. Auf ihrer Bluse hatte sich ein großer roter Fleck gebildet. Meine Kehle schwoll schlagartig zu, ich konnte keinen Ton herausbringen, obwohl ich am liebsten geschrien hätte. Warf mich neben ihr auf die Knie und legte meine Hand an ihr Gesicht.
Ehe ich etwas sagen konnte, hörte ich ihre Stimme: Bring mich hier weg, bevor die Sanitäter kommen.
Sie hatte nicht gesprochen, sie hatte nicht einmal die Augen geöffnet. Aber die Verbindung zu ihr war so stark wie gestern im Krankenhaus. Ich hörte ihre Worte in meinem Kopf. Und dachte nicht daran, sie wegzubringen. Sie war doch verletzt!
Bring mich weg, Elli, ich sterbe, ich will bei meinen Leuten sterben.
Nein! Nein, das ging nicht, das konnte jetzt nicht sein! Die Sanitäter –
Die können mir nicht helfen! Nur du kannst mir jetzt helfen. Ich muss nach Hause, zu Simón …
Aber wie soll das gehen, das viele Blut …
Elli, wenn du mich nicht sofort wegbringst, dann hängen sie mich im Krankenhaus an ihre Geräte und ich sterbe trotzdem. Du siehst mich dann nur noch durch eine Glasscheibe. Wenn du mich wegbringst, kannst du mir so viel Energie geben, wie ich brauche, um am Leben zu bleiben, bis wir dort sind, wo meine Leute liegen – unsere Leute, Elli, unser Volk.
Unser Volk. Sie stirbt. Du stirbst.
Ja, ich sterbe.
Aber ich habe dich doch gerade erst wiederbekommen!
Elli, bitte, du kannst mich nicht retten. Du musst dich entscheiden. Hilf mir! Ich will zu Simón!