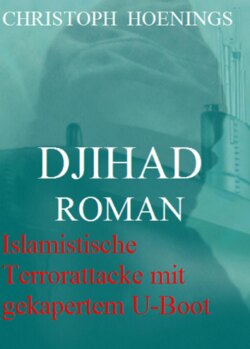Читать книгу Djihad - Christoph Hoenings - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Mahmud
ОглавлениеDJIHAD
Sommer 2009
Lieutenant-Commander US-Navy Carl Almaddi kratzte sich hilflos den Hinterkopf. Er war ratlos, was den Inhalt des Telefonates anging.
Das Gespräch war kurz:
Der Anrufer: „Ich bin´s.“
Der Angerufene: „Code?“
Anrufer: „Grüner Tee ist ein gütiges Geschenk Allahs. Ewig sei Er für Seine Gnade gepriesen.“
Angerufener: „Um was geht es?“
Anrufer: „Um Hilfe bei U-Booten, die wir gegen den Großen Teufel einsetzen wollen.“
Hier muss der Sorgfalt halber gesagt werden, dass es den Begriff U-Boote im Arabischen nicht gibt. Genaugenommen sagte der Anrufende: Um Hilfe bei Schiffen, die unter Wasser segeln.
Angerufener: „Um was genau?“
Anrufer: „Nur mündlich.“
Angerufener: „Wo? Wann?“
Anrufer: „Am üblichen Platz, so Allah will. So schnell wie möglich!“
Mitgeschnitten und zur Analyse vorgelegt war das Gespräch, weil die angewählte Rufnummer einer fundamentalistischen Koranschule in Peshawar in Pakistan gehörte.
Peshawar liegt nur wenige dreißig Kilometer entfernt vom Khyberpass, einem der wichtigsten Grenzübergänge zwischen Pakistan und Afghanistan. Auf afghanischer Seite befand sich die Hochburg der Taliban. Die Koranschule hatte es in sich! Carl Abdul Almaddi hatte Bilder von dem Gebäude angesehen. Ein Haus in einer engen Gasse der pittoresken Altstadt Peshawars, die Fenster verborgen hinter kunstvoll aus Holz geschnitzten Gittern, in der Gasse basarähnliche mobile Marktstände mit Gemüse, Fleisch, Textilien, Lederwaren.
Sämtliche Dienste waren sich einig. Hier war eines der Nester, in denen die afghanischen Taliban pakistanische Helfer rekrutierten.
Was die US-Air Force davon abgehalten hatte, das Haus gezielt zu bombardieren – technische Mittel für einen punktgenauen Raketenbeschuss standen zur Verfügung– war neben der Anzahl der Marktbesucher, die sich täglich in der Gasse drängten die Tatsache, dass mindestens fünfzig halbwüchsige Knaben in dem Haus als Internatsschüler untergebracht waren und rund weitere fünfzig Kinder jeden Morgen als Tagesschüler dort eintrafen.
Zum Zeitpunkt des Gesprächs hatte sich der Anrufer im Garten des Grand Hyatt Hotels an der Old Airport Road in Riyadh aufgehalten. Das hatten Aufzeichnungen der Saudi Telecom ergeben. Als Anrufer war eine anonyme und bis zu diesem Zeitpunkt unbenutzte niederländische Mobilfunknummer identifiziert worden. Die Niederlande waren zum Leidwesen der Amerikaner eines der Länder, in denen man anonym SIM-Karten kaufen konnte, ohne Namen oder Adresse hinterlassen zu müssen.
Alle Telefonate aus Saudi Arabien heraus werden zunächst von Computern der saudischen Behörden mitgeschnitten. Die Computer sind so programmiert, dass sie die Gespräche auf bestimmte Wörter untersuchen. Sollte eines der im Programm eingegebenen Worte fallen, wird das Telefonat ausgeworfen und von einem Mitarbeiter analysiert.
Die US-Behörden analysieren ebenfalls eine Unzahl national und international geführter Telefonate. Dabei hilft ihnen, dass fast alle interkontinentalen Ferngespräche über von der NASA in den Himmel geschossene Kommunikationssatelliten laufen.
Lieutenant-Commander Carl Abdul Almaddi und verschiedene US-Stellen beschäftigte die Frage, was eine als verdeckte Vertretung der Taliban fungierende Koranschule in Peshawar, von der nächsten Küste tausend Kilometer entfernt, mit U-Booten zu tun haben könnte.
Beide Gesprächsteilnehmer hatten Arabisch miteinander gesprochen. Nicht Urdu, die aus Hindi und Arabisch und Persisch zusammengewürfelte Landessprache Pakistans.
Lieutenant-Commander Carl Abdul Almaddi hatte seinen Arbeitsplatz in Crystal City, einem Vorort Washingtons auf dem rechten Ufer des Potomac River. Hier sind auf wenigen Quadratmeilen in zahlreichen gesichtslosen Bürogebäuden die den US-Verteidigungsbehörden nachgeordneten Stellen untergebracht. Die Büros liegen in unmittelbarer Nähe des Flughafens Washington National, und das Pentagon, das Verteidigungsministerium der USA, ist nur eine U-Bahnstation entfernt. Hier sitzt auch die nach den Anschlägen des 11. September 2001 eingerichtete Heimatschutzbehörde.
Carl Abdul Almaddi war der Sohn der deutschstämmigen Amerikanerin der dritten Generation, Heidi Huckting, die sich einem glutäugigen charmanten Restaurantbesitzer in Los Angeles hingegeben hatte, dem aus dem Libanon stammenden Kemal Almaddi.
Kemal Almaddi war mit seiner Familie in den Libanon zurückgekehrt, wo sein Sohn Carl Abdul auf den Straßen Beiruts und in der Internationalen Schule seine Kenntnisse der arabischen und der englischen Sprachen vervollständigte. Als Carl zwölf wurde, übersiedelte die Familie zurück in die USA.
Carl hatte die schwarzglühenden Augen seines Vaters. Obwohl erst 32 Jahre alt, war er schon zum zweiten Mal geschieden.
Nach der High-School hatte Almaddi sich bei der US-Navy beworben, bekam trotz der hohen Anzahl der Mitbewerber einen Studienplatz an der Naval Academy in Annapolis und begann seine Karriere als Marineoffizier. Als man feststellte, wie perfekt er Arabisch sprach, wurde er unverzüglich in die Heimatschutzbehörde eingeladen.
Eigentlich ist nicht der Heimatschutz dafür zuständig, den weltweiten Telefon- und Funkverkehr zu überwachen. Dies tut die geheimnisumwobene National Security Agency in Fort Meade in der Nähe von Baltimore in Maryland. Die NSA geht mit Informationen, die sie betreffen, mit allergrößter Zurückhaltung um. So groß, dass häufig gefrotzelt wird, NSA stünde für Never Say Anything – sag nie was! In dem großen Glasklotz, der ihr als Hauptquartier dient, arbeiten schätzungsweise 15-18.000 Personen, ein großer Teil davon Mathematiker, Kryptographen, Experten, beschäftigt, Codes zu knacken und Daten zu sammeln.
Das Signals Intelligence Directorate wertet diese Daten aus und gibt sie an weitere Behörden.
Auch wenn die Heimatschutzbehörde vor allem terroristische Bedrohungen erkennen und eliminieren soll, die innerhalb der USA oder in den angrenzenden Staaten entstehen, ist der weltweite Kampf gegen Terrorismus ebenfalls eine ihrer Aufgaben.
Da die terroristische Bedrohung der USA in erster Linie aus strenggläubigen arabischen Ländern kommt, war ein Mann mit den Kenntnissen Almaddis in der Heimatschutzbehörde äußerst willkommen.
Mit Religion hatte Carl Almaddi nichts am Hut. Seine Mutter hatte darauf bestanden, ihn christlich zu taufen, der Vater hatte aus Trotz auf einer Beschneidung bestanden.
Carl Abdul Almaddis goldener Mittelweg war gewesen, sich aus Religionen herauszuhalten.
Carl hatte seine Karriere als Marineoffizier zumindest zeitweilig aufgegeben. Dafür übersprang er mehrere Rangstufen, weil er eine im Moment sehr wichtige Sprache beherrschte.
Die Abteilung, für die er tätig war, das Office of Intelligence and Analysis OIA, gehörte zu den Institutionen, die von Geheimdienstagenten im Mittleren Osten mitgeschnittene oder direkt von den Experten der NSA aufgefangene Nachrichten auswerteten.
Wie Almaddi wusste, war im Nahen und Mittleren Osten eine ganze Menge amerikanischer Dienste unterwegs. Die wichtigsten: Die Central Intelligence Agency CIA, die Intelligence Community, das Directorate of National Intelligence und natürlich die National Security Agency NSA.
Initiator der an Carl Almaddi gerichteten Anfrage war die NSA, deren Rechner das Gespräch aufgefangen und aus Millionen von Telefonaten herausgefiltert hatten. Aber alle, einschließlich des FBI, interessierten sich für Almaddis Meinung zu dem abgehörten Gespräch.
Hilfe bei Schiffen, die unter Wasser segeln.
Was, zum Teufel, sollte das?
Afghanistan hatte keine Küste!
Pakistan hatte eine Küste. Pakistan besaß U-Boote. U-Boote der Daphne-Klasse aus Frankreich. U-Boote der Scorpene-Klasse aus Frankreich noch im Bau. Kleinst-U-Boote aus Deutschland.
Saudi Arabien besaß kein einziges U-Boot!
Nun war den Taliban ziemlich alles zuzutrauen.
Aber ein Angriff auf die USA mit einem U-Boot? Eine Kriegshandlung?
Wie sollten die an ein U-Boot kommen?
Es konnte also nur darum gehen, an ein Boot aus einem anderen muslimischen Land zu gelangen. Auch, wenn die meisten dieser Staaten als gemäßigt galten, gab es überall, selbst in den Streitkräften, durchgeknallte Fundamentalisten, denen jede Verrücktheit zuzutrauen war.
Wenn Almaddi die Türkei ausschloss: Iran, Pakistan, Indonesien, Ägypten, Algerien, demnächst noch Malaysia, all diese Staaten waren mit dieselelektrischen U-Booten ausgestattet. Mit Booten, die extrem leise und fast unaufspürbar waren. Mit Booten, die in der Lage waren, aus ihren Torpedorohren Raketen abzuschießen.
Keine ballistischen Raketen, aber Marschflugkörper, die bis zu 1000 Meilen fliegen und je nach Sprengkopf erheblichen Schaden anrichten konnten. Und Seaskimmer, die dicht über der Wasseroberfläche flogen und auf Radarschirmen faktisch unsichtbar waren!
Der große Teufel! Die USA!
Die von dieselelektrischen Booten ausgehende Gefahr war nicht zu unterschätzen!
Aber die Chance, dass ein U-Boot nach einem Angriff auf sein Land ungestraft davon kommen könnte, sah Almaddi nicht. Der Angriff müsste schließlich auf See stattfinden. Die US-Navy würde dafür sorgen, dass es nicht überlebte. Und das war den Leuten an Bord bewusst!
Es gab in jedem dieser Länder verwirrte Gestalten, die glaubten, sie würden im Himmel von Jungfrauen verwöhnt, wenn sie bei Anschlägen gegen Almaddis Land ihr Leben verlören.
Zehn, fünfzehn Leute zum kollektiven Selbstmord zu bewegen, so wie bei den Anschlägen des 11. September 2001, mochte noch angehen. Aber eine U-Bootbesatzung von dreißig, vierzig Personen?
Modernere Boote hatten mit dem hohen Automatisierungsgrad kleinere Besatzungen, aber selbst da waren es immer noch mehr als zwanzig Personen.
Nun mochte es angehen, dass die U-Bootsführung die Besatzung nicht in ihre Pläne einweihte. Das sähe den Halunken ähnlich: Auf ihrem Weg zum Himmel etliche Glaubensbrüder ungefragt und ungebeten mitzunehmen! Andererseits, zumindest Kommandant und Offiziere müssten abgestimmt vorgehen und die Besatzung im Dunkeln lassen. Aber hier ging es nicht wie in Tom Clancys Buch Roter Oktober darum, in die Freiheit zu fliehen, sondern in den sicheren Untergang zu fahren!
Dass gleich mehrere gut ausgebildete, gutverdienende Männer sich in kollektiven Selbstmord stürzten, hatte es bisher nicht gegeben.
Carl Almaddi wusste, die meisten Selbstmordattentäter waren entweder bitterarme Schlucker, denen für ihre Familien großzügige finanzielle Absicherung versprochen worden war, oder junge Frömmler, die wirklich an den Unfug mit den siebzig im Himmel wartenden Jungfrauen glaubten.
Eine Meuterei durch Mitglieder der Besatzung? Eine Handvoll Leute, die die Offiziere beseitigt, das Kommando übernimmt, und auf eigene Faust handelt? Ebenfalls wenig wahrscheinlich. Die würden ohne kompetente Führung den Weg nicht finden.
Lieutenant-Commander Carl Abdul Almaddi rief sich über Jane´s Fighting Ships, dem jährlich überarbeiteten Almanach mit der Beschreibung sämtlicher auf der Welt existenter Kriegsschiffe die Leistungsdaten der U-Boote der infrage kommenden Staaten auf seinen Bildschirm. Egal ob französische Daphnes, russische Kilos, deutsche 209er, alle waren extrem leise und brandgefährlich. Die alten Romeos der Ägypter würde man hören. Die Pakistanis hatten zudem noch eine Handvoll Mini-U-Boote, zu klein, um über den Atlantik zu schippern, es sei denn, sie würden in einem Mutterschiff zu ihrem Operationstheater gebracht. Almaddi war sicher, dass es in diesem perfiden Pakistan einen zum Dockschiff umgebauten Frachter oder Tanker gab, mit dem die Boote unerkannt überallhin gebracht werden konnten. Aber hier wäre die Anzahl der Mitwisser noch größer! Sicherheitshalber vergewisserte er sich, dass Saudi Arabien nicht über U-Boote verfügte. Aber Saudi Arabien würde nicht die USA angreifen!
Oder dachte er in die falsche Richtung? War statt gegen die USA etwas gegen Israel geplant?
Er hörte sich das Gespräch noch mal an. Es war vom Großen Teufel die Rede gewesen!Damit waren gemeinhin die USA gemeint.
Trotzdem beschloss Lieutenant-Commander Carl Abdul Almaddi, den Marineattaché der Israelischen Botschaft in Washington, Chaim Zimmerman anzusprechen.
Es gab noch etwas, das Carl Almaddi wissen wollte.
Er rief seinen Freund Peter Huntzinger an.
Peter arbeitete seit kurzem bei Navy-International Programs, NIPO, und dort für das Royal Saudi Navy Support Office.
Nach kurzer Begrüßung fragte Carl:
„Peter, weißt du, ob Saudi Arabien sich mit U-Booten beschäftigt? Bei Jane´s finde ich nichts.“
„Kannst Du nicht! Die haben keine U-Boote! Die Saudis können kaum mit ihren Überwasserschiffen umgehen! An U-Boote trauen die sich nicht ran! Außerdem kenne ich die Budgetplanung für die nächsten Jahre. Kein Wort über U-Boote!“
September 2009
Rupert Graf war gerade von einem Abendessen mit Geschäftspartnern in seine Wohnung zurückgekehrt und hörte sich die auf seinem Anrufbeantworter eingegangenen Gespräche an.
Einen der Anrufe musste er mehrmals abspielen, bis er verstand, was der Sprecher wollte.
Der Mann hatte sich in stark dialektgefärbtem Englisch als Mahmut vorgestellt und um ein Treffen innerhalb der nächsten Tage gebeten, der Ort sei egal.
Es gehe um ein äußerst wichtiges Vorhaben.
Die hinterlassene Rufnummer war, wie Graf feststellte, die eines Anschlusses in Genf. Da eine Zimmernummer genannt worden war, vermutete Graf, dass sich der Anrufer aus einem Hotel gemeldet hatte.
Rupert Graf putzte sich in aller Ruhe die Zähne und machte es sich vor dem Fernsehgerät bequem, um die Spätnachrichten und eine anschließende Talkshow zu verfolgen.
Erst dann wählte er die angegebene Nummer.
Er erreichte eine freundliche Dame, die sich mit Hotel Beau Rivage meldete, und wurde unverzüglich zu der genannten Zimmernummer durchgestellt.
Dort wurde so prompt abgehoben, dass Graf den Eindruck hatte, der Bewohner habe direkt neben dem Telefon gesessen und auf seinen Anruf gewartet.
„Ja?!“
Mehr nicht.
„Ich bin von Mr. Mahmut gebeten worden, diese Nummer anzurufen. Mein Name ist Graf.“
„Einen Moment.“ Kein `Bitte`!
Das war nicht die Stimme auf dem Anrufbeantworter.
Graf hörte im Hintergrund Stimmengewirr, das er als Arabisch deutete, Stimmen ausschließlich von Männern, Gelächter. Zumindest hatte er niemanden aus dem Schlaf geschreckt. Wahrscheinlich lief dort ein Kartenspiel, und anschließend würde man essen gehen. Genf, so wusste Graf, hatte sich auf arabische Gäste bestens eingestellt, und dort würde ungeachtet jeder Polizeistunde auch um drei Uhr früh noch Essen serviert, solange gut bezahlt würde.
Der Hörer wurde wieder aufgenommen.
„Vielen Dank für Ihren Rückruf, Mr. Graf. Wann können wir uns sehen?“
Das war die Stimme des Anrufers auf seinem Band.
„Darf ich fragen, um was es geht?“
„Das ist nichts für das Telefon. Aber es ist sehr wichtig. Wann?“
„Woher haben Sie meinen Namen und meine Rufnummer?“ fragte Graf ungerührt.
„Von einem Freund. Einem gemeinsamen Freund aus Monaco. Er liebt es, viel und gut zu essen.“ Gelächter.
„Die nächsten zwei Wochen bin ich ausgebucht,“ antwortete Graf. „Danach gerne.“
„Solange kann ich nicht warten. Entweder Sie sagen jetzt zu, mich in den nächsten drei Tagen zu treffen, oder ich wende mich heute noch an einen Ihrer Wettbewerber.“
Graf verfluchte Norbert Schmehling. Nur Schmehling konnte es gewesen sein, der diesem unverschämten Patron seine Rufnummer gegeben hatte. Trotzdem bemühte er sich, höflich zu bleiben.
„Ich müsste andere Termine umschichten. Das kann ich um diese Tageszeit nicht. Können Sie nach Deutschland kommen?“
„Kommen Sie zu mir! Ich bin ab morgen in Cannes. Im Carlton. Kommen Sie dorthin! Ich schicke ein Flugzeug, das Sie abholt.“
„Ich kann das jetzt nicht zusagen. Ich rufe Sie morgen wieder an.“
„Ich muss jetzt wissen, ob Sie kommen, oder ich rufe sofort einen Ihrer Konkurrenten an. Die kommen!“
Rupert Graf hatte oft genug mit Vertretern aus arabischen Ländern zu tun gehabt, um zu wissen, dass dort gerne und häufig mit Erpressung gearbeitet wurde. Das war wie auf einem Bazar. Wenn er jetzt nachgab, würde Mahmut ihm gegenüber immer wieder zu diesem Mittel greifen, um was auch immer es gehen mochte.
„Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Mr. Mahmut.“ sagte Graf und legte auf.
Trotz der dort schon viel weiter fortgeschrittenen Stunde saßen in einem Privathaus in der saudischen Hauptstadt Riad drei Männer zusammen. Sie hatten erst gegen 23 Uhr begonnen, zu Abend zu essen. Der Besitzer des Hauses, Vize-Admiral der Königlich Saudischen Marine Zaif al Sultan, hatte seine Frau gemeinsam mit den beiden philippinischen Hausmädchen ein erlesenes Mahl zubereiten lassen. Der Sohn von Zaif, Hakeem, hatte bei dem Essen dabei sein dürfen, um den Gästen die Teller zu füllen, sobald sie leer waren.
Hakeem bin Zaif war Student, zwanzig Jahre alt, und würde in Kürze nach Europa gehen, um an einer Technischen Hochschule eine Ausbildung zum Maschinenbauingenieur aufzunehmen.
Die beiden Gäste hatten weder die Frau von Zaif, Jasmin, noch eines der Hausmädchen zu Gesicht bekommen.
Jetzt servierte Hakeem den Tee.
Sein Vater und seine beiden Besucher saßen in dem großen Wohnraum, an dessen Wänden Sofas und Sessel standen, mit jeweils kleinen Tischen davor.
Hakeem waren beide Männer gut bekannt.
Abdallah bin Athel war einer der Stellvertreter seines Vaters in der Marine, im Rang eines Konteradmirals, zuständig für Planungen und Beschaffungen.
General Faisal bin Salman war als Mitglied des Generalstabes verantwortlich für Fragen der Strategie der Streitkräfte.
Auch wenn alle drei Herren tagsüber Uniform zu tragen pflegten, waren sie jetzt in Burnusse gehüllt und trugen auf dem Kopf das landesübliche Tuch, die Kufiya, gehalten von mehreren elastischen Ringen.
Eindringlich hatte Admiral Zaif während des Essens die Notwendigkeit erläutert, die Saudische Marine mit U-Booten auszustatten. Eine Marine ohne U-Boote war keine richtige Marine! Und trotz der Fregatten der Sawari-Klasse, die in den achtziger Jahren in Frankreich gekauft worden waren, fehlte der Marine eine wesentliche Komponente, die der Kriegsführung unter Wasser!
Konteradmiral Abdallah hatte Zaif nur halbherzig unterstützt. U-Boote waren sicherlich wichtig, aber die Saudische Marine hatte schon genügend Probleme, ausreichend ausgebildete Mannschaften für ihre Überwasserflotte zusammenzubekommen. Fachleute zum Betrieb von U-Booten auszubilden, würde noch viel schwieriger.
General Faisal hatte seine Skepsis offen zum Ausdruck gebracht.
Er hielt nichts von einer Waffe, die die meiste Zeit unter Wasser und für den Feind somit unsichtbar war. Nicht, dass ihm die Argumente Zaifs nicht einleuchteten: Eine derartige Waffe vermochte ungeheuren Schaden anzurichten. Faisal widerstrebte es, dem Kauf von etwas zuzustimmen, das unsichtbar und ungeeignet war, Freund und Feind zu beeindrucken. Zudem teilte er die Ansicht Abdallahs, die Marine verfüge nicht über genügend ausgebildetes Personal für eine neue Waffengattung.
Zaif hatte nicht locker gelassen.
Hakeem hatte aufmerksam zugehört, als sein Vater beiden Offizieren strategische und taktische Vorteile von U-Booten auseinandersetzte. Zaif beabsichtigte nicht, die Marine mit großen Booten auszustatten, sondern zunächst eine Anzahl kleiner Einheiten zu beschaffen. Auf denen konnten Experten ausgebildet werden, die ihrerseits zu einem späteren Zeitpunkt als Nukleus für die Ausbildung von Mannschaften für größere U-Boote dienen könnten.
„An welche Bootsgröße denken Sie?“ hatte General Faisal schließlich gefragt.
„Zweihundert, dreihundert Tonnen.“
„Wie groß sind U-Boote normalerweise?“
„Nehmen wir die Scorpene aus Frankreich oder die Sauro-Klasse aus Italien, oder den Typ 209, den die Deutschen in alle Welt geliefert haben. Das sind Boote in der Größenordnung von 1.200 bis 1.800 Tonnen. Ich spreche von einem winzigen Boot!“
„Und das soll taktische Vorteile bieten?“ hatte General Faisal gefragt.
„Ja sicher. Auch ein so kleines Boot kann Torpedos und Raketen abfeuern, die Computersysteme sind fast die gleichen wie an Bord der großen Boote, lediglich Reichweite und Seeausdauer sind eingeschränkt. Und die Anzahl der Waffen. Seine Gefahr liegt darin, dass niemand weiß, wo es ist!“
Faisal hatte nach den logistischen Problemen gefragt, die durch die Beschaffung von U-Booten, selbst so kleiner Einheiten, entstehen mochten. Müssten die Marinebasen in Jeddah und Dhahran ausgebaut oder verändert werden? Was war mit der Ersatzteilhaltung? Waren hierzu große zusätzliche Investitionen notwendig?
Zaif hatte auf alle Fragen passende Antworten.
Schließlich fragte Faisal:
„Was kosten derartige Boote?“
„Zweihundert fünfzig bis dreihundert Millionen Dollar das Stück,“ antwortete Zaif. „Ich habe mich bei anderen Marinen vorsichtig erkundigt.“
„Und die großen Boote, die Sie vorhin erwähnt haben?“
„Weit mehr als das Dreifache. Da wären allerdings auch umfangreiche Ausbauarbeiten an unseren Marinebasen notwendig. Große Boote haben einen so großen Tiefgang, dass wir tiefere Hafenbecken bräuchten, und die Fahrrinnen ebenfalls müssten ausgebaggert werden.“
Zaif behielt tunlichst für sich, dass er den marktüblichen Preis für U-Boote soeben vervielfacht hatte. Zaif schlug sich zu diesem Zeitpunkt lieber auf die sichere Seite.
General Faisal wiegte den Kopf.
Das war viel Geld.
Vor wenigen Jahren noch wären die von Zaif genannten Beträge ein besseres Taschengeld für das Königreich gewesen. Aber der erste Golfkrieg hatte eine Menge Geld gekostet. Achtzig Milliarden Dollar waren von Saudi Arabien an die Amerikaner bezahlt worden dafür, dass die USA das Land beschützt hatten. Dabei hatte das Königreich den Schutz nicht einmal gewollt! Dem Königshaus und der einheimischen Bevölkerung wäre eine arabische, auf dem Verhandlungswege mit Saddam Hussein erzielte Lösung lieber gewesen!
„Ich werde mit Nummer Zwei darüber sprechen, Zaif. Wenn Sie mir jetzt meinen Wagen rufen lassen wollten!“
Hakeem wusste, Nummer Zwei war die im Lande übliche Bezeichnung für Prinz Sultan bin Abdul Aziz, den Verteidigungsminister.
Als General Faisal aufstand, sprang Hakeem auf die Füße. Auch Zaif und Abdallah standen auf.
Faisal wickelte seinen Burnus enger, als sie in den Patio traten. Es war um diese Nachtstunde empfindlich kühl im Freien. Der General dankte ausgiebig für die erwiesene Gastfreundschaft und lobte das Essen mit so lauter Stimme, dass Hakeems Mutter dies nicht überhören konnte, auch wenn sie sich bereits ein Stockwerk über ihnen in ihren Gemächern befand. Zum Schluss fragte Faisal:
„Zaif, wie ich festgestellt habe, haben Sie sich eingehend mit der Materie befasst. Wer liefert die besten dieser Produkte?“
„Deutschland, General. Eindeutig Deutschland!“
Rupert Graf hatte nach dem Telefonat mit Mahmut die verschiedenen Nummern von Norbert Schmehling angerufen.
Schmehling war ihm seit vielen Jahren bekannt. Sie hatten einige Geschäfte zusammen durchgezogen.
Norbert Schmehling lebte davon, seine Kontakte zur deutschen Politik und seine Auslandskontakte gewinnbringend einzusetzen. Hierbei half ihm seine enge Freundschaft zu einem Mitglied des deutschen Regierungskabinetts, über das er bei der Parteienfinanzierung hilfreich eingriff. Dies wiederum konnte er dank seines Wohnsitzes in Monaco tun, ohne dass dies bei den deutschen Steuerbehörden auffällig geworden wäre. Schmehling hatte Graf niemals verraten, wie ein Teil der an ihn gezahlten Provisionen nach Deutschland zurückfloss, und Graf hatte es tunlichst unterlassen, ihn zu fragen.
Trotz mancher harter Verhandlungen und bis an die Grenzen der Fairness geführten Diskussionen waren sie so etwas wie Freunde.
Graf erreichte Schmehling schließlich auf einem von dessen Handies. Wie Schmehling sagte, befand er sich in einer Bar in Nizza.
„Ich hatte vorhin ein Telefonat mit einem Menschen namens Mahmut. Haben Sie mir den auf den Hals geschickt?“
„Oh, hat der schon angerufen? Ich hätte mich morgen bei Ihnen gemeldet.“
Schmehling klang regelrecht begeistert.
Graf fragte:
„Was ist das für ein Geist?“
„Ein interessanter Mann! Sie müssen sich unbedingt treffen! Ein lohnendes Geschäft!“
„Ich treffe mich überhaupt nicht mit Leuten, die schon am Telefon versuchen, mich zu erpressen.“
Schmehling lachte.
„Typisch Mahmut! Sie wissen doch, wie die Araber sind! Aber Mahmut hat seine Kontakte bis hinauf in die absolute Spitze!“
„Was will er?“
„Es geht um ein paar Ihrer wasserdichten Konservenbüchsen. Ich habe viel Mühe aufgewandt, Mahmut zu überzeugen, dass er nirgends besser aufgehoben ist als bei Ihnen!“
Graf glaubte Schmehling kein Wort. Wahrscheinlich hatte der durch Zufall von einem möglichen Bedarfsfall erfahren, und jetzt hatte er diesen unangenehmen Typen am Hals!
„Aber wenn Sie nicht wollen, Herr Graf,“ sagte Schmehling gerade, „dann lassen Sie es! Ihre Wettbewerber werden sich die Finger lecken! Das ist dann aber das letzte Mal gewesen, dass ich Sie jemandem empfohlen habe. Im Übrigen habe ich auch Freunde hier in Frankreich.“
Norbert Schmehling hörte sich ausgesprochen beleidigt an.
„Welches Land?“ fragte Graf.
„Das größte.“
„Genehmigung?“
„Das überlassen Sie mir!“
„Gut. Rufen Sie Ihren Freund an und sagen Sie ihm, ich würde meinen Terminkalender überprüfen. Im Laufe des morgigen Tages werde ich ihn wissen lassen, wann ein Treffen möglich ist.“
Ahmed Falouf beobachtete im Rückspiegel den im Fond sitzenden General Faisal bin Salman. Wieder war es spät geworden. Jetzt, um drei Uhr früh, waren die Straßen Riads leer, und Ahmed dachte nicht daran, sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Um sieben Uhr, direkt nach dem Morgengebet, würde er den General zu seinem Büro im Verteidigungsministerium fahren müssen, und bis dahin wollte Ahmed noch etwas schlafen.
Ahmed Falouf war Palästinenser. Für die Erledigung niederer Arbeiten hielten sich die Saudis Ausländer. Diese Ausländer, so hatte Ahmed einmal gelesen, machten inzwischen einen größeren Anteil an der Bevölkerung des Königreiches Saudi Arabien aus als die Saudis selbst. Gut, manche der Ausländer hatten die Chance, als Kaufleute oder als Anwälte bedeutende Positionen zu erreichen, aber immer würde, egal was sie taten, über ihnen noch ein Saudi stehen.
Offiziell war Ahmed Falouf Mitglied der Streitkräfte Saudi Arabiens.
Saudischer Soldat.
Das stimmte aber ganz so nicht.
Kein Einheimischer in Uniform hätte sich dazu herabgelassen, den Chauffeur zu spielen. Also wurden für diese Aufgaben, ebenso wie für Ordonnanzen, Diener, Reinigungskräfte oder Gärtner Ausländer aus den ärmeren arabischsprachigen muslimischen Ländern rekrutiert. Die bekamen eine Uniform, die sie in ihrer Dienstzeit trugen, egal ob sie hinter dem Steuer des Dienstwagens ihres Vorsetzten hockten oder in dessen Haus Essen servierten oder sauber machten. Hierbei handelte es sich vornehmlich um Palästinenser, Libanesen, Pakistani oder Bangladeshi, aber auch Ägypter und Jemeniten.
Als Angestellte der Streitkräfte erhielten diese Männer keineswegs den großzügigen Sold der saudischen Soldaten, sondern das für ihre Tätigkeiten landesübliche Gehalt.
Ahmed Falouf war nicht in einer Kaserne oder einem militärischen Komplex untergebracht. Er wohnte in einem kleinen Zimmerchen in einem Komplex für militärische Hilfskräfte, nur wenige Kilometer entfernt von dem geschlossenen Wohnviertel, in dem sich die Häuser der vier Familien des Generals befanden. Hier lebten etliche Chauffeure und Bedienstete der Streitkräfte. Es gab sogar eine bewachte Garage, für die Dienstwagen der Offiziere.
Allah sei Dank war Ahmed jedoch seit einiger Zeit nicht mehr allein auf das Gehalt angewiesen, das der General für seine Tätigkeit als Fahrer zahlte. Ahmed hatte noch einen Nebenverdienst.
Dieser Nebenverdienst bestand darin, dass Ahmed einen Freund, den er aus Ramallah her kannte, regelmäßig unterrichtete, wohin er den General hatte fahren müssen. Sein Freund Majed war an allem interessiert, was den General anging. An dem, was er im Auto sagte, was er bei seinen Gesprächen über das Autotelefon sagte, mit wem der General sich traf.
Majed und Ahmed hatten als Kinder in den staubigen Straßen Ramallahs mit leeren Konservendosen Fußball gespielt. Gemeinsam waren sie zur Schule gegangen, gemeinsam hatten sie später Steine gegen israelische Jeeps geworfen, die in den Straßen ihrer Heimatstadt am Westufer des Jordan patrouillierten.
Während Ahmed nach einer kurzen Studienzeit an der Universität von Gazah nach Saudi Arabien zog, um sein Glück zu versuchen, war Majed in die heilige Stadt Jerusalem gegangen. Dort hatte er sich offenbar mit den jüdischen Besetzern arrangiert. Genaues wusste Ahmed nicht, aber aus den Gesprächen seines Vaters mit Nachbarn und aus späteren Briefen aus der Heimat hatte er erfahren, dass Majed an einer jüdischen Universität ein Studium aufgenommen hatte. Das war schlimmer als hätte Majed den christlichen Glauben angenommen und sich taufen lassen! Alle Nachbarn und früheren Freunde hatten den Kopf geschüttelt und den Kontakt zu Majeds Familie auf das Minimum reduziert, das bei dem Zusammenleben in den engen Gassen Ramallahs unvermeidlich war, ohne grob unhöflich zu sein.
Ahmed trug mit seinem Chauffeurgehalt erheblich zum Unterhalt der Familie seines Vaters bei. Seine Schwestern waren mittlerweile verheiratet, aber sein älterer Bruder Zahran war Lehrer geworden und verdiente in Ramallah nur einen Bruchteil dessen, was Ahmed in Saudi Arabien bekam. Der Vater war alt, schon weit über achtzig, die Mutter, trotz ihrer über fünfzig Jahre noch rüstig, kümmerte sich um die Ziegen und Schafe, von deren Milch und Wolle die Familie ihr Dasein fristete. Nachdem jedoch die Juden einen Großteil des Landes, das seinem Vater gehörte, besetzt und eine Siedlung darauf errichtet hatten, hatte Ahmeds Vater einen Teil der Herden schlachten und einen weiteren Teil ausgerechnet an die Juden verkaufen müssen, weil die Tiere sonst verhungert wären. Eine Entschädigung für das besetzte Land hatte die Familie trotz ihrer Proteste nicht erhalten.
Ahmed hoffte, eines Tages mit seinen Ersparnissen nach Palästina zurückzukehren. Dann würde er sich nach einer Ehefrau umsehen, deren Vater eine ordentliche Summe zahlen, und dann würde er sofort wieder nach Saudi Arabien gehen. Seine Frau könnte dann eine Stelle als Hausmädchen, oder, wenn sie etwas Bildung besaß, als Krankenschwester oder als Lehrerin annehmen! Seit Ahmed Palästina verlassen hatte, träumte er davon, Zaida zu besitzen, die Enkelin eines Freundes seines Vaters.
Unvermittelt war vor wenigen Monaten Majed in Riad aufgetaucht. Majed arbeitete für ein Handelsbüro, das Waren aus Palästina nach Saudi Arabien verkaufte. Es war Majed gewesen, der Ahmed auf einem der Treffen, das die in Riad lebenden Männer aus Ramallah regelmäßig abhielten, erkannt hatte.
Wie sehr hatte Ahmed sich gefreut!
Stundenlang hatten sie bei Tee und Zigaretten Erinnerungen ausgetauscht. Majed war trotz der in Israel verbrachten Zeit, Allah sei gepriesen, kein Freund der Juden geworden. Im Gegenteil, er hasste die Juden wie Ahmed und wie alle anderen Palästinenser. Wie hatten sie gelacht über die Dummheit der Juden, Majed eine teure Ausbildung zu geben, damit dieser, kaum hatte er sein Diplom in der Tasche, Israel den Rücken kehren und mit Hilfe Allahs bekämpfen konnte! Tränen hatten sie gelacht!
Danach hatten Ahmed und Majed sich regelmäßig getroffen. Eines Tages hatte Majed ihm gesagt, dass er in Kontakt stand zu einem großen Unternehmen aus Frankreich, einem mit den Arabern befreundeten Land, und dass die Franzosen bereit waren, große Summen zu bezahlen, zu wissen, was Ahmeds Arbeitgeber, General Faisal bin Salman sagte und tat. Diese Summen, so hatte Majed gesagt, würde er mit Ahmed teilen. Da auf Ahmed die Hauptlast der Tätigkeit lag, gab Majed sich mit einem Drittel der Beträge zufrieden. Schließlich besaß er den Kontakt. Das war, so fand auch Ahmed, nur fair.
Wieder hatten sie sich halbtot gelacht, diesmal über die Christen, die bereit waren, soviel Geld auszugeben für unnütze Informationen, die ein hinter dem General hergeschickter Taxifahrer für einen Bruchteil des Geldes hätte liefern können.
Trotzdem hatte Ahmed, Allah war sein Zeuge, seine Aufgabe stets gewissenhaft erfüllt.
Und dafür kassiert.
Während Ahmed den schweren Mercedes zu dem Haus steuerte, in dem die jüngste Ehefrau des Generals wohnte, dachte er darüber nach, ob die Franzosen bereit sein mochten, mehr als üblich für die Information zu bezahlen, dass der General sich heute Abend stundenlang mit zwei Marineoffizieren unterhalten hatte. Das wusste Ahmed aus den Gesprächen mit dem Fahrer von Admiral Zaif, einem Pakistani namens Siddiqui.
Das war ein Abweichen von der Routine des Generals, und Ahmed wusste, diese Information konnte wertvoll sein.
Nizza / Cannes, 3. Oktober
Es war elf Uhr dreißig, als Rupert Graf aus der kleinen Düsenmaschine stieg, die vor dem Terminal von Cannes-Mandelieu ausgerollt war.
Die Maschine hatte am Morgen am General Aviation Terminal in Düsseldorf auf ihn gewartet. Die Piloten waren Engländer, die Maschine hatte keine Kennung, lediglich auf dem Leitwerk war winzig klein die saudische Flagge aufgemalt.
Graf war der einzige Passagier an Bord. Der Copilot hatte ihm während des Fluges ein Frühstück vorgesetzt, ansonsten blieb Graf unbehelligt bis zur Landung.
In Mandelieu kletterte Rupert Graf in einen weißen Rolls Royce, der ihn in zwanzig Minuten direkt vor das Portal des Ritz Carlton Hotels brachte.
Graf wurde von einem Hotelangestellten in einer der oberen Etagen zur Tür einer Suite geführt.
Ein arabisch aussehender Mann in gut geschnittenem dunkelblauen Anzug nahm Graf in Empfang und bat ihn, zu warten. Scheich Mahmut würde jeden Moment kommen.
Graf wartete eine geschlagene halbe Stunde.
Scheich Mahmut wirkte unausgeschlafen, als er in Jeans und knallrotem Poloshirt auf nackten Füßen in den Wohnraum der Suite geschlurft kam.
Mahmut war jünger als Graf, hatte den für Araber seiner Klasse dünnen Oberlippenbart und einen schmalen Bartstreifen, der sich von der Unterlippe zum Kinn zog. Sein Haar war dicht und tiefschwarz. Er hatte strahlend weiße, schöne Zähne. Graf vermutete, dass Mahmut statt sich die Zähne mit einer Bürste zu putzen, Süßholzstäbchen kaute. Mahmut war kleiner als Graf, aber Graf schätzte, dass er sicherlich hundertzwanzig Kilo wog.
Ohne Handschlag und ohne jede Begrüßung ließ Mahmut sich auf eines der Sofas gegenüber Graf plumpsen, zog die Füße auf die Sitzfläche, und sagte:
„Ohne Ihren Freund Mr. Schmehling, der Sie sehr empfohlen hat, säße hier jetzt einer Ihrer Wettbewerber. Bedanken Sie sich bei unserem Freund.“
Graf blieb stumm.
Der Sekretär erschien und fragte nach ihren Getränkewünschen.
Graf bat um Mineralwasser, der Scheich verlangte eine Bloody Mary.
„Woher kennen Sie Schmehling, Exzellenz?“ fragte Graf, um das Gespräch zu eröffnen. In Deutschland war Sonntag und außerdem Nationalfeiertag, und Graf hätte diesen Tag lieber genutzt, um auszuschlafen als hier mit diesem arroganten Typen zu sitzen.
„Wir hatten einige Male miteinander zu tun. Ein zuverlässiger Mann. Er war meiner Regierung von Mr. P. empfohlen worden. Sie wissen, dass unsere Regierung gerne mit Personen arbeitet, die uns von Freunden empfohlen werden.“
Mit P. konnte nur der Ministerfreund Schmehlings gemeint sein. Graf fragte sich, was die beiden in Saudi Arabien gemacht haben konnten, ohne dass dies in der deutschen Öffentlichkeit bekannt geworden war.
„Erzählen Sie mir etwas über Deutschland, Mr. Graf. Ich weiß nicht viel über Ihr Land, außer dass wir vor Jahren einmal große Schwierigkeiten mit Ihren Regierungen hatten, als uns ein von zweien Ihrer Kanzler versprochenes Fahrzeug verweigert wurde. Das hat zu tiefer Verstimmung geführt, die bei einzelnen Persönlichkeiten meines Landes immer noch anhält.“
Rupert Graf konnte sich nur zu gut an den von Mahmut angesprochenen Sachverhalt erinnern. Saudi Arabien hatte Anfang der achtziger Jahre Kampfpanzer des Typs Leopard kaufen wollen, diese Lieferung war jedoch aufgrund des von Israel auf die deutsche Regierung ausgeübten Drucks nicht zustande gekommen.
Während Graf die damaligen Geschehnisse aus seiner Sicht schilderte, pulte sich Mahmut versonnen mit dem rechten Zeigefinger zwischen den nackten Zehen. Jetzt war Graf froh, Mahmut zur Begrüßung nicht die Hand geschüttelt zu haben.
Graf wurde unterbrochen, als mehrere Kellner Servierwagen herein fuhren und vor Graf und Mahmut Kanapees und Häppchen ausbreiteten, die der Menge nach für zehn Personen gereicht hätten.
„Greifen Sie zu, Mr. Graf, Sie müssen nach Ihrer Anreise hierher Hunger haben!“ forderte Mahmut ihn auf.
Graf bemühte sich, als er sich bediente, nicht in die Nähe der Speisen zu geraten, von denen Mahmut sich mit den Fingern bedient hatte. Auf den Salat verzichtete er, nachdem Mahmut sich mit der Hand, die er zuvor zur Reinigung der Räume zwischen seinen Zehen benutzt hatte, einige Krabben aus der Schüssel fischte. Als Graf jedoch seinen Teller leergegessen hatte, pulte Mahmut einige weitere Krabben aus dem Salat und legte sie auf Grafs Teller.
Bisher hatten sie kein Wort über das Vorhaben verloren, dessentwegen Mahmut Graf hierher geholt hatte.
Rupert Graf war hierüber nicht unfroh. Er ging davon aus, dass Mahmuts Suite abgehört wurde. Deshalb erging Graf sich in Allgemeinheiten über Deutschland und über die politische Situation im Mittleren Osten.
Mahmut schien dies keinesfalls zu stören.
Im Orient hatte man Geduld.
Erst nachdem sie ausgiebig von den Süßspeisen genommen und einen kleinen schwarzen Mokka getrunken hatten, sagte Mahmut:
„Ich darf annehmen, dass unser gemeinsamer Freund Sie darüber ins Bild gesetzt hat, was ich mit Ihnen besprechen will.“
„Nur sehr oberflächlich,“ antwortete Graf. „Ich wäre Ihnen jedoch sehr dankbar, wenn wir dieses Gespräch am Strand fortsetzen könnten. Hier ist so wunderbares Wetter, und ich komme aus dem herbstlichen Deutschland, so dass Sie mir eine große Freude machen würden, Exzellenz, wenn wir etwas an die frische Luft gehen könnten.“
Mahmut guckte überrascht. Dann rief er seinen Sekretär, dem er auf Arabisch einige Anweisungen erteilte.
Wenige Minuten später konnten die auf der Corniche flanierenden Spaziergänger beobachten, wie eine Prozession von Hotelbediensteten Kissen und Decken die Stufen von der Promenade hinab zum hoteleigenen Strand trug, wie zwei einsame Liegestühle aus einem Verschlag geholt und diese in der Nähe der Brandung aufgebaut wurden. Kurz darauf folgten zwei Herren mittleren Alters, der eine im dunklen Anzug, der andere in einen warmen roten Pullover gehüllt, die sich in den beiden Liegestühlen niederließen.
Die Besprechung konnte beginnen.
Ahmed Falouf hatte sich heute mit Majed getroffen.
Sie saßen in einem von Geschäftsleuten bevorzugten japanischen Restaurant in der Innenstadt Riads. Hier war es betriebsam und laut. Das Restaurant hatte spanische Wände aufgebaut, hinter denen die Ehefrauen der Gäste ihren Schleier abnehmen konnten, um mit ihren Familien zu speisen.
Ahmed hatte Zeit.
Er hatte General Faisal am Morgen zum Militärflughafen im Zentrum Riads gefahren, von wo aus der General eine zweitägige Reise nach Jeddah angetreten hatte.
Majed schrieb sich auch diesen Sachverhalt auf.
„Was würden deine französischen Freunde für Informationen zahlen, dass der General vergangene Tage ein besonderes Treffen wahrgenommen hat?“ fragte Ahmed.
„Was für ein Treffen?“ fragte Majed überrascht.
„Mit ranghohen Offizieren einer anderen Teilstreitkraft. Nachts. In einem Privathaus.“
„Du kennst die Namen?“ fragte Majed.
Ahmed nickte.
„Ich weiß, was sie besprochen haben. Der General hat am nächsten Tag vom Auto aus telefoniert. Es ist so wichtig, dass er um einen Termin mit Nummer Zwei nachgesucht hat.“ Ahmed grinste versonnen.
„Die Franzosen bezahlen uns dafür, dass wir solche Informationen bringen,“ sagte Majed ernst. „Das, was wir bisher gebracht haben, war nicht sehr aufschlussreich. Ich nehme nicht an, dass meine Freunde jetzt noch etwas drauflegen für Informationen, die sie ohnehin von uns erwarten.“
Ahmed grinste.
„Dies ist eine besondere Information. Oder glaubst du, sie sind nicht interessiert an einem neuen Beschaffungsprogramm, von dem noch niemand weiß? Ich habe gehört, wie der Gastgeber beim Abschied gesagt hat, die besten Produkte lieferte Deutschland.“
Befriedigt konnte Ahmed sehen, wie es in Majed arbeitete.
„Ich muss nachfragen,“ sagte Majed schließlich.
„Tu das!“ antwortete Ahmed zufrieden. „Meine Informationen könnten Gold wert sein! Vorausgesetzt, man hat sie rechtzeitig!“
Auf einmal schien Majed es sehr eilig zu haben.
Er bat Ahmed, noch am selben Abend für ein weiteres Treffen zur Verfügung zu stehen. Ahmed nickte. Er konnte sein Grinsen nicht unterdrücken.
In der sicheren Erwartung auf eine fürstliche Entlohnung übernahm Ahmed die Rechnung und legte noch ein großzügiges Trinkgeld dazu.
Er wusste, seine Informationen waren Gold wert!
Rupert Graf sah missmutig zu, wie sich der Strand langsam füllte.
Auch andere Hotelgäste ließen sich für die Wintermonate bereits weggeräumte Liegestühle aufstellen und Decken bringen. Plötzlich waren Mahmut und er nicht mehr allein.
Trotzdem würde hier ihr Gespräch nicht belauscht werden können.
„Meine Regierung erwägt den Kauf von U-Booten,“ sagte Mahmut, nachdem ein Hoteldiener ihnen Kissen zurechtgerückt, Decken ausgebreitet, Getränke serviert und sie endlich allein gelassen hatte. „Nach dem Theater mit den Panzern ist, wie Sie sich vorstellen können, niemand bei uns sonderlich begeistert, sich hierfür ausgerechnet an Deutschland zu wenden. Andererseits haben Ihre Werften U-Boote an Israel geliefert. Das heißt, dass Ihre Qualität die beste sein muss. Israel würde niemals ein zweitrangiges Rüstungsprodukt beschaffen!“
Mahmut machte eine Pause und sah den sich brechenden Brandungswellen zu.
„Wenn wir Deutschland offiziell fragen, muss vorher sichergestellt sein, dass dieses Mal eine Exportgenehmigungszusage auf dem Tisch liegt. Und selbst dann wird mein Land wahrscheinlich einen internationalen Wettbewerb ausrufen und weitere Angebote aus anderen Ländern einholen. Allerdings könnte ich sicherstellen, dass Deutschland gewinnt.“
Auch Rupert Graf beguckte sich die Brandung.
„Das wird schwierig,“ sagte Graf nachdenklich.
„Wieso? Mr. P. und Schmehling haben uns versichert, die Genehmigungsfrage würde geregelt! Schließlich hat mein Land die Alliierten im Golfkrieg unterstützt.“
„Ich denke nicht an die Frage der Exportgenehmigung, Exzellenz,“ antwortet Graf. „Die ist kein Problem. Es hat schon mal eine Exportgenehmigungszusage für U-Boote für Ihr Land gegeben. Nein, die Frage ist, wer diese U-Boote fahren soll. Ihre Marine hat Probleme genug mit ihren Überwasserschiffen. Sie haben die Experten nicht. Ein U-Boot durch den Arabischen Golf zu führen ist so wie mit verbundenen Augen ein Auto durch die Innenstadt von Riad zu steuern.“ Er sah Mahmut an. „Im Übrigen werden die USA nicht einverstanden sein.“
„Was geht das die USA an?“ fragte Mahmut ärgerlich. „Das Königreich ist ein souveräner Staat!“
„Die US-Navy hat zu viele Schiffe im Golf, um zu riskieren, dass eines davon versehentlich von einem Ihrer U-Boote gerammt oder bei einer Übung aus dem Wasser geblasen wird. Richten Sie sich auf Proteste aus Washington ein.“
„Überlassen Sie diesen Punkt mal ruhig meiner Regierung,“ sagte Mahmut mit arrogantem Unterton.
„Wie groß sollen die Boote sein?“ fragte Graf.
„Klein. Sehr klein. Gerade groß genug, um im Golf zu operieren.“
„Das wäre auch meine Empfehlung, Exzellenz. Größere U-Boote sind für den Arabischen Golf mit seinen stellenweise flachen Gewässern ungeeignet. Man könnte sie vom Flugzeug aus mit bloßem Auge gegen den hellen Grund erkennen. Kleine Boote mit grünem Außenanstrich hätten eine Chance, unentdeckt zu bleiben. Trotzdem bleibt das Problem der Mannschaften.“
„Was heißt das?“
„Wenn wir von kleinen Booten sprechen, benötigen Sie pro Boot acht bis zehn Mann. Da Sie für jedes Boot mehrere Mannschaften und außerdem auch Personal für die Wartung benötigen, kommen schnell dreißig bis vierzig Leute zusammen. Für jedes Boot. Ein einziges Boot wird nicht reichen. Üblicherweise hat eine Marine für jedes Einsatzgebiet mindestens drei Boote zur Verfügung, eines, das sich auf See befindet, eines, das unterwegs ist vom oder zum Einsatzgebiet, und eines, das zu Ausbildungszwecken und zur Wartung an der Pier liegt. Ihr Land hat eine enorm lange Küste. Allein im Roten Meer dreitausend Kilometer, noch einmal tausend Kilometer im Golf. Die Anzahl der zu beschaffenden Boote wird davon abhängen, wie viele Experten Ihrer Marine zur Verfügung stehen.“
„Aber Sie werden die Männer doch ausbilden!“ sagte Mahmut nach einer Pause.
„Sicher. In Deutschland haben wir Simulatoren, in denen das Training durchgeführt wird. Aber dort hinein kommen nur Leute, die bereits eine Ahnung haben, was sie tun müssen. Mannschaftsgrade, die nach oben gewachsen sind. In Ihrem Land fangen wir bei Null an. Sie selbst würden sich ungern in ein Flugzeug setzen, dessen Pilot früher mal Taxifahrer war und deshalb vom Transport von Personen etwas versteht, der sich aber sein Fachwissen über Fliegerei ausschließlich im Simulator angeeignet hat. So etwa müssen Sie die Situation sehen. Insofern bin ich beruhigt, dass man mit kleinen Booten anfangen will.“
Mahmut grinste verlegen.
„Wieso macht Ihnen das überhaupt Kopfzerbrechen, Mr. Graf?“
„Es wäre unserer Reputation nicht zuträglich, wenn ein von uns geliefertes Boot verloren ginge. Aus den Trümmerklumpen am Meeresboden lässt sich nämlich nicht ohne weiteres ein Operationsfehler nachweisen.“
„Mir ist kalt,“ sagte Mahmut und schüttelte sich fröstelnd unter seiner Decke. „Ich bin andere Temperaturen gewohnt.“
„Einen Moment noch bitte, Exzellenz. Wann kommt die Anfrage heraus?“
„Das liegt an mir und meinen Freunden. Mein Vorschlag ist, dass Sie mir vorab die Spezifikation eines Bootes geben, das nur Ihr Unternehmen liefern kann. Diese Spezifikation wird als Basis für die Ausschreibung benutzt. Jeder, der etwas anderes anbietet, fliegt aus dem Wettbewerb. Also alle außer Ihnen.“
Mahmut machte ein zufriedenes Gesicht.
„Warum tun Sie das?“ wollte Graf wissen.
„Aus Liebe zu meinem Land!“ antwortete Mahmut mit Bestimmtheit.
„Sie werden Ihren Aufwand ersetzt haben wollen,“ sagte Graf.
„Ja sicher!“
„An was denken Sie?“
„Fünfundzwanzig Prozent,“ antwortete Mahmut. „Und nicht eines weniger!“
Rupert Graf seufzte.
„Sie wissen, dass sich die Welt verändert hat, Exzellenz,“ sagte er.
„Meine nicht!“
„Wir werden besondere Lösungen finden müssen,“ sagte Graf.
„Sie werden Sie schon finden,“ bemerkte Mahmut leichthin und wickelte sich aus seiner Decke. „Es gibt sie.“
Auch Graf stand auf.
„Wie geht es jetzt weiter?“ fragte er.
„Einer meiner Anwälte wird sich in den kommenden Tagen bei Ihnen melden. Sie werden gemeinsam einen hübschen kleinen Vertrag aufsetzen. Sobald dieser unterschrieben ist, geben Sie mir Ihre Spezifikationen. Ein paar Wochen später erhalten Sie die Ausschreibungsunterlagen und werden problemlos Ihre Spezifikation wiedererkennen. Sie werden anbieten und die Exportgenehmigungszusage Ihrer Regierung beifügen. Alles Weitere regele ich.“
Sie stapften gemeinsam durch den Sand zurück zur Promenade und überquerten die Straße vor dem Hoteleingang. Dort wartete bereits der Wagen auf Graf. Zwei Stunden später landete er in Düsseldorf.
Er war froh, Mahmut zum Abschied nicht die Hand gegeben zu haben. Auch am Strand hatte Mahmut unter der Decke mit den Fingern zwischen den Zehen gepult.
Nach dem zweiten Treffen mit Ahmed Falouf war Majed Akhad zu seiner Wohnung gefahren, um die von Ahmed erhaltenen Informationen zu chiffrieren. Für das Chiffrieren benutzte Majed Akhad die französische Ausgabe von Marcel Aimées `Die Grüne Stute`. Der Code war einfach und wäre leicht zu knacken. Andererseits konnte davon ausgegangen werden, dass es keine weiteren Exemplare dieses frivolen Buches hier im Lande gab.
Wie üblich fuhr Majed hinaus zum Flughafen Riads, der nach König Fahed benannt war. Seine chiffrierte Nachricht befand sich auf die Sportseite im Inneren einer zusammengefalteten Tageszeitung gekritzelt.
Er parkte seinen Wagen in der Tiefgarage und ging in die Abfertigungshalle für internationale Flüge. Hier herrschte das übliche Gedränge, weil fast alle Flüge nach Europa und nach Fernost Riad um diese späte Abendstunde verließen und weil fast jeder einheimische Reisende von vier oder fünf Personen verabschiedet wurde. Majed stellte sich an die Theke der kleinen Bar, an der Softdrinks und warme Getränke ausgeschenkt wurden. Die Zeitung legte er neben sein Limonadenglas.
Sein Kontakt kam wenige Minuten später, bestellte einen Tee, leerte seine Tasse, nahm Majeds Zeitung und verschwand in der Menschenmenge.
Majed wusste, dass sein Kontakt die Nachricht nicht selbst außer Landes brachte. Majed vermutete, dass seine Zeitung noch durch die Hände von mehreren Personen ging, bevor sie den eigentlichen Boten erreichte. Er war dankbar für diese Vorsichtsmaßnahmen, weil sie ihn schützten.
Er hatte mit Ahmed gefeilscht wie ein tunesischer Teppichhändler, bis sie sich auf einen Preis geeinigt hatten, den Majed glaubte, gegenüber seinen Auftraggebern vertreten zu können. Erst danach war Ahmed mit seinem Wissen herausgerückt. Die Information, die Ahmed ihm gegeben hatte, war, da hatte Ahmed recht, Gold wert.
Tel Aviv, 4. Oktober
Oberst Moishe Shaked saß ratlos hinter seinem Schreibtisch im für den Abwehrdienst reservierten Teil des Ministeriums für Verteidigung. Draußen hatte bereits die Abenddämmerung eingesetzt.
Oberst Moishe Shaked hatte Vertrauen in seinen Informanten in Riad.
Wem er nicht traute, war Majed Akhad.
Akhad war Palästinenser, und wem von denen konnte man schon trauen?!
Lustlos nahm Oberst Shaked noch einmal die Akte über Akhad in die Hand.
Aufgewachsen in Ramallah auf der Westbank, Schulabschluss im dortigen Gymnasium, Bewerbung um einen Studienplatz an der Ben-Gurion-Universität in Jerusalem, Staatsexamen in Jurisprudenz, Gesamtnote ausreichend. Für einen Palästinenser war das schon gut!
Während des Studiums bereits Kontaktaufnahme durch den staatlichen Geheimdienst Mossad. Bereitschaft zur Zusammenarbeit, nachdem Majed Akhad mit einer Reihe kleiner Vergehen konfrontiert worden war, die ihn den Studienplatz hätten kosten können. Bespitzelung anderer palästinensischer Studenten durch Akhad, was zur Vereitelung von zwei Sprengstoffanschlägen geführt hatte. Danach direkter Druck auf Akhad mit der Drohung, ihn als Spitzel auffliegen zu lassen, wenn er nicht zu tiefer gehender Kooperation bereit wäre. Eine Weigerung hätte seinen sicheren Tod bedeutet. Entsendung nach Saudi Arabien, wo einer seiner Kindheitsfreunde eine Vertrauensstellung beim Chef des Generalstabs innehatte.
U-Boote!
Oberst Moishe Shaked hätte diese teuer bezahlte Information, immerhin hatte dieser Lümmel von Fahrer des Generals Faisal fünftausend Dollar dafür erhalten, als orientalische Phantasterei abgetan. Die Saudis hatten schon vor zwanzig Jahren Angebote für U-Boote eingeholt und die einschlägige Industrie mehrere Jahre in Atem gehalten, um dann das Vorhaben sang- und klanglos einschlafen lassen. Jetzt allerdings war noch eine weitere Nachricht bei ihm gelandet.
Scheich Mahmut al Ibrahim war ihm durchaus ein Begriff als enger Vertrauter der saudischen Führung, als Geschäftsmann im Bereich von Rüstungsvorhaben, und als Lebemann. Mahmut al Ibrahim besaß Wohnungen und Büros in London, Paris und in Marbella in Spanien. Er besaß eine fünfzig Meter lange Yacht und mehrere Flugzeuge. Vier Ehefrauen, die jüngste gerade neunzehn Jahre alt! Elf legitime Söhne, vier davon mit mittlerweile verstoßenen Frauen, acht Töchter. Der jüngste Sohn war ein halbes Jahr alt, der älteste zweiunddreißig.
Mahmut al Ibrahim hatte die ausschlaggebende Rolle bei einer Reihe von Rüstungskäufen der Saudis gespielt, egal ob die Lieferungen aus Frankreich, England oder den USA kamen. Und hatte dabei eine Menge Geld verdient!
Was Oberst Moishe Shaked elektrisiert hatte, war die Nachricht, dass Scheich Mahmut sich gestern in Cannes mit einem Deutschen namens Rupert Graf getroffen hatte. Rupert Graf wiederum war Mitglied im Vorstand der in der Hafenstadt Bremen angesiedelten Werften der Deutschen Rhein Ruhr Stahl AG und verantwortlich für Vertriebsaufgaben.
Die Werften waren Lieferanten von Spitzentechnologie im Bereich Marinetechnik. Das hieß, sie bauten Schnellboote, Korvetten und Fregatten.
Und U-Boote!
Schöne Scheiße!
Sein eigenes Land hatte vor wenigen Jahren U-Boote in Deutschland gekauft.
Oberst Moishe Shaked hielt nicht viel von den Arabern. Bis ein Land wie Saudi Arabien in der Lage sein würde, Israel mit U-Booten zu bedrohen, würde das Tote Meer ausgetrocknet sein. Aber der arabische Admiral sollte, so die Information aus Riad, gesagt haben, Deutschland lieferte die besten Produkte.
Wenn Saudi Arabien U-Boote in Deutschland beschaffte, war anzunehmen, dass diese ähnlich ausgestattet sein würden wie die für Israel gebauten, und die Saudis würden mit einer Reihe technologischer und taktischer Errungenschaften vertraut, die Israels U-Boote besaßen.
Die Marine Saudi Arabiens würde ihre Kenntnisse mit der Marine Ägyptens teilen, mit der Marine Pakistans, mit der Algeriens. Diese Länder besaßen eine U-Bootswaffe! Der Iran besaß U-Boote. Länder, die zu den Feinden des Staates Israel zählten.
Hier lag die Gefahr!
Die Beschaffung von U-Booten durch Saudi Arabien konnte verzögert aber auf Dauer nicht verhindert werden.
Was aber Israel würde verhindern können, war, dass Deutschland die Boote lieferte.
Oberst Moishe Shaked hob den Hörer des auf seinem Schreibtisch stehenden Telefons ab und wählte die Nummer der Deutschlandabteilung seines Ministeriums.
Als am anderen Ende abgehoben wurde, sagte er:
„Moishe hier, Schalom! Ezrah, wir müssen miteinander sprechen!“
Düsseldorf, 8. Oktober
Rupert Graf war nach tagesfüllenden Sitzungen in der Hauptverwaltung seines Unternehmens in Oberhausen in seine Wohnung im Düsseldorfer Zoo-Viertel zurückgekehrt.
Auch wenn er als Vorstandsmitglied der zu dem Konzern gehörenden Werften viel Zeit in Bremen verbringen musste, wollte er den Luxus seiner Wohnung in Düsseldorf nicht aufgeben.
Da er ständig in der Welt unterwegs war, hatte er sich in Bremen lediglich eine kleine Wohnung angemietet.
Wann immer er konnte, büxte er aus nach Düsseldorf.
Heute Abend war er mit Norbert Schmehling verabredet.
Schmehling kam direkt aus Berlin. Sie hatten für ihr Treffen das Restaurant `La Terrazza` an der Königsallee ausgewählt. Graf, der hier bekannt war, hatte einen Tisch abseits vom üblichen Getümmel erbeten.
Als Graf etwas vor der vereinbarten Zeit dort eintraf, saß Schmehling bereits am Tisch und grinste ihn an.
„Ich hatte Hunger, da hab´ ich mir schon mal die Vorspeise kommen lassen. Die Flusskrebse auf Spargelsalat sind sehr zu empfehlen. Ich nehme noch eine zweite Portion.“
Nachdem sie ihr Essen bestellt hatten und nachdem Norbert Schmehling genüsslich sein Brot in das mit süßem Balsamico verfeinerte Olivenöl getunkt hatte, fragte er Graf mit vollem Mund:
„Wie hat Ihnen mein Freund Mahmut gefallen?“
„Ein arrogantes Arschloch!“ sagte Graf, ebenfalls kauend.
„Naja, Sie sollen ihn ja nicht heiraten! Aber wenn Ihnen einer dieses Geschäft bringen kann, dann Mahmut!“
„Von einem Geschäft sind wir weit entfernt, Herr Schmehling.“
„Ach was! Die wollen Ihre Boote. Ich habe Mahmut, den ich seit vielen Jahren kenne, bearbeitet. Wenn Sie das richtig spielen, geht das Ratzfatz! Sogar mein Freund hat sich eingesetzt!“
„Die haben gar keine Leute, um die Dinger zu betreiben!“
„Das soll doch nicht Ihre Sorge sein.“ Schmehling kaute mit sichtlichem Genuss auf seinem Brot.
„Doch! Wenn die nach der ersten Tauchfahrt nicht mehr hoch kommen, heißt es, wir hätten Schund geliefert.“
„Die haben haufenweise Marineoffiziere aus anderen Ländern unter Vertrag. Außerdem können wir ein paar deutsche U-Bootfahrer als Ausbilder dorthin schicken. Ich habe das mit meinem Freund besprochen. Die werden von der Bundesmarine beurlaubt und gehen für ein, zwei Jahre dorthin. Doppeltes Gehalt, steuerfrei, Auslandszulage. Sie werden sich vor Angeboten kaum retten können. Sie müssen das lediglich bei Ihrer Preiskalkulation berücksichtigen!“ Schmehling grinste ihn an.
Graf wartete mit seiner Antwort, weil ein Kellner die Vorspeisen brachte.
„Es dürfte Heidentheater geben, wenn eines Tages herauskommt, dass bei einem Konflikt, in dem diese Boote eingesetzt waren, diese von deutschen Offizieren geführt worden sind,“ bemerkte er trocken. „Stellen Sie sich vor, die versenken ein israelisches Schiff! Selbst wenn es sich nur um einen Fischkutter oder ein Paddelboot handelt, wird Wehgeschrei losgehen, wieder würden Juden von Deutschen umgebracht! Nein, das geht nur, wenn wir ein umfassendes Ausbildungsprogramm durch die Deutsche Marine anbieten können. Grundausbildung, Training im Simulator, anschließend an Bord deutscher U-Boote. Erst danach ist zu verantworten, die Saudis mit eigenen Booten allein auf die Menschheit loszulassen.“
„Die Franzosen haben denen doch Fregatten geliefert! Also müssen die in der Saudischen Marine von Seefahrt was verstehen!“
„Es ist etwas anderes, ob Sie auf der Meeresoberfläche herum karriolen oder unter Wasser. Über Wasser ist es leicht, festzustellen, wo Sie sind. Unter Wasser nicht. Ich denke auch an die Amerikaner.“
„Was haben die denn damit zu tun?“
„Die haben eine ganze Flotte von Kriegsschiffen im Arabischen Golf. Ich werde prüfen, ob die bereit sind, Sonarsysteme zu liefern. Da drin haben die die Geräusche aller ihrer eigenen Schiffe gespeichert. Das vermindert das Risiko, das die Saudis aus Versehen eines der US-Schiffe aus dem Wasser pusten! Trotzdem bleibt das Problem der Ausbildung.“
Oberst Moishe Shaked war zufrieden.
Während er in seiner kleinen Wohnung in Tel Aviv saß, vor ihm ein flimmerndes Fernsehgerät, in dem seine Frau Sarah eine amerikanische Soap-Opera verfolgte, freute er sich auf den morgigen Sabbat. Nicht, dass er beabsichtigt hätte, in die Synagoge zu gehen. Moishe Shaked war kein frommer Mann. Er hatte selbstverständlich seine Bar Mizwa über sich ergehen lassen, aber danach hatte er seinen Fuß nur noch zu Hochzeiten oder zu Trauerfeiern in eine Synagoge gesetzt.
Morgen wollte er nach Jaffa, ein wenig mit Sarah am Strand entlang laufen, der um diese Jahreszeit nicht voll sein würde. Dann würden sie in der Altstadt zu Mittag essen, und am Sonntag fing die Arbeit wieder an.
Dass der Fernseher lief, störte Oberst Moishe Shaked nicht. Er war gewohnt, auch bei Lärm nachzudenken. Sein kleines Büro im Verteidigungsministerium hatte so dünne Wände, dass er Gespräche seiner unmittelbaren Büronachbarn ohne besondere Konzentration hätte mithören können.
Moishe Shaked dachte an das Gespräch mit Ezrah Goldstein aus der Deutschlandabteilung. Gemeinsam hatten sie die eingegangenen Nachrichten aus Riad und aus Cannes analysiert, die sie beunruhigend fanden. Ezrah hatte einen Kameraden aus der Marine hinzugerufen, Itzak Salomonowitz, der seinerzeit mit dem Beschaffungsprogramm der israelischen U-Boote beschäftigt gewesen war.
Auch Itzak fand den Gedanken an U-Boote in der Hand der Saudis nicht sonderlich sympathisch.
„Eigentlich halte ich die Araber für zu faul, um sich eingehend genug mit den Möglichkeiten zu befassen, die diese Waffengattung bietet. Denkt daran, was die sich in den vergangenen Jahren alles angeschafft haben! Fregatten, von denen unsere Marine nur träumen kann. Flugzeuge, die besser sind als unsere, Panzer, die besser sind als unsere. Mit nichts davon können sie richtig umgehen. In den Operationszentralen sitzen französische, englische oder amerikanische Offiziere. Die Saudis sitzen lediglich am Steuer. Die lenken und landen ihre AWACS-Flugzeuge, aber in die OPZ kommen sie nicht mal rein. Mit ihren Panzern fahren sie mit Höchstgeschwindigkeit durch die Wüste, aber taktische Übungen machen sie nicht. Mit ihren Schiffen fahren sie raus in den Golf oder ins Rote Meer, sind aber nach wenigen Tagen wieder zuhause. Trotzdem, diese U-Boote sind alles andere als gut!“
„Warum?“ hatte Goldstein gefragt.
„Über die Systeme, die sie aus Deutschland bekommen, können sie Einzelheiten über die Fähigkeiten unserer U-Boote ableiten. Im Roten Meer können sie uns nicht wirklich gefährlich werden, wenn sie sich wegen der zahlreichen Untiefen überhaupt dort hintrauen. Um ins Mittelmeer zu gelangen, müssten sie um ganz Afrika herum und wären monatelang unterwegs. Aber sie werden im Arabischen Golf und der Arabischen See unterwegs sein. Und genau dort stellen sie eine Bedrohung für Israel dar.“
„Im Golf? Was meinst du damit?“ fragte Goldstein.
„Nun, du weißt, dass ständig mindestens eines unserer Dolphin-U-Boote im Arabischen Golf vor der Küste des Iran kreuzt. Damit wir jederzeit einen Atomschlag gegen den Iran ausüben können. Auch wenn die Gefahr begrenzt sein dürfte: Die Saudis könnten herausfinden, wo sich unser Boot befindet. Sie könnten es schlimmstenfalls ausschalten.“
„Die Saudis haben selbst Angst vor dem Iran!“ warf Shaked ein.
„Trotzdem darf die Sicherheit Israels nicht davon abhängen, dass ein saudisches U-Boot unseren Dolphin erkennt!“
„Warum glaubst du, dass sie unser Boot mit ihren U-Booten eher erkennen als mit ihren Überwasserschiffen?“ fragte Shaked. „Die sind doch auch mit Unterwasserlauschgeräten ausgestattet.“
„Weil du von einer Plattform unter Wasser viel weiter hören kannst als von der Oberfläche aus!“
Moishe Shaked war auf seine Sorge zurückgekommen, die Saudis könnten eigene Erkenntnisse, gewonnen mit Booten, die denen der Israelischen Marine ähnlich wären, an andere arabische Marinen weitergeben.
Das hatte Itzak das nicht so tragisch genommen.
„Wem? Den Ägyptern? Deren alte Romeos hören wir schon, wenn sie noch im Hafen von Alexandria sind. Unsere Marine weiß jederzeit, wo sich jede dieser alten Schluffen befindet. Algerien? Marokko? Alle diese Boote sind so alt und so laut, dass wir sie jederzeit finden. Nein, neue leise saudische Boote sind eine Gefahr für unsere Dolphins im Golf! Und ausgerechnet aus Deutschland!“
Ezrah und er hatten stumm genickt.
Keiner von ihnen würde jemals vergessen, was die Deutschen ihrem Volk angetan hatten! Jeder von ihnen hatte Verwandte, Onkels, Tanten, Großeltern in deutschen Konzentrationslagern verloren. Oder sie hatten in Familien eingeheiratet, hatten Freunde, deren Verwandte dort umgekommen waren.
Wenn Deutschland diese Boote lieferte, so wussten alle drei, ohne dass es ausgesprochen werden musste, würden deutsche Unternehmen über diese Waffenlieferung hinaus zusätzliche Geschäfte im zivilen Bereich mit Saudi Arabien abschließen. Das war üblich. Keinem von ihnen war der Gedanke sympathisch, dass Deutschland seine Wirtschaftskraft über einen israelische Interessen tangierenden Auftrag noch vergrößern würde.
„Wir müssen es genau beobachten! Und wenn wir etwas finden, womit wir es verhindern können, tun wir das. Vor allem müssen wir alles herausfinden, um was es geht: Bootsgröße, Ausstattung, Geräuschsilhouetten, Liefertermine,“ hatte Itzak gesagt.
Ezrah hatte geantwortet:
„Ich werde morgen mit dem Ministerpräsidenten sprechen.“
Ezrah hatte keine Zeit verloren.
Wie er Moishe mitgeteilt hatte, hatte der Ministerpräsident ihm volle Rückendeckung zugesagt. Der Regierungschef war ohnehin verärgert, weil die Deutschen als Anführer einer europäischen Initiative sich in die Siedlungspolitik Israels in der Westbank und im Gazahstreifen einmischten und offene Sympathieerklärungen zugunsten der enteigneten Palästinenser abgegeben hatten.
Ezrah hatte sofort die Botschaft in Berlin eingeschaltet.
Lieutenant Commander Carl Almaddi war alles andere als glücklich, als er den Mittschnitt des Telefonates auf seinen PC bekam. Der Anruf war von einem der Randbezirke von Rawalpindi aus geführt worden, von einem Mobiltelefon, das ein pakistanischer Geschäftsmann vor Monaten schon als verloren oder gestohlen hatte registrieren lassen. Die angerufene Nummer hatte sofort die US-Computer in Wachsamkeit versetzt: Das in den Niederlanden zugelassenene Telefon, von dem aus Riad heraus die Koranschule in Peshawar angerufen worden war. Das Gespräch aus Rawalpindi war in Riad entgegen genommen worden, in einem Bezirk in der Nähe der Großen Moschee.
Die Nachricht war wiederum sehr kurz:
Anrufer: Hat dir der grüne Tee gemundet?
Angerufener: Sehr! Es war ein Vergnügen, dich zu treffen. Allah sei gepriesen!
Anrufer: Wir haben gefunden, was du suchst. Ideal für euren Plan! Und voller Hass.
Angerufener, lachend: Allah sei gepriesen!
Anrufer: Du wirst alle Einzelheiten, so Allah will, auf dem üblichen Weg erhalten.
Angerufener: Shukrah!Allah sei Dank!
Lieutenant Commander hörte sich das Gespräch mehrmals an. Es waren die gleichen Stimmen wie bei dem ersten Telefonat. Eine Stimmenanalyse würde dies, so war er überzeugt, bestätigen.
Aber der Inhalt klang nicht gut. Gar nicht gut!