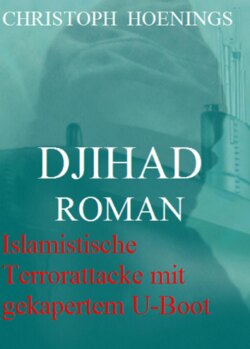Читать книгу Djihad - Christoph Hoenings - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Strukturen
ОглавлениеRupert Graf saß gemeinsam mit Norbert Schmehling und Scheich Mahmut al Ibrahim im Restaurants des Yachtclubs von Monaco.
Sie hatten im Obergeschoss einen Tisch mit Blick auf das Hafenbecken und die darin dümpelnden Boote und Schiffe. Einige der Mega-Yachten waren hell erleuchtet wie Passagierschiffe kurz vor dem Auslaufen. Rupert Graf wusste, jedes dieser Schiffe kostete pro laufendem Meter Schiffslänge gut 2 Millionen EURO. Und hier lagen etliche Schiffe mit Längen von mehr als fünfzig, und vier, die mehr als hundert Meter lang waren. Manche dieser Yachten lagen hier das gesamte Jahr über festgetäut und wurden von ihren Eignern nur zu Anlässen wie dem Grand Prix der Formel Eins aufgesucht, oder zur Gala des Roten Kreuzes.
Es war Norbert Schmehling, der zum Abendessen eingeladen hatte. Aus Schmehlings Sicht gab es etwas zu feiern: Den Abschluss des Konsortial-Vertrages zwischen den Werften der Deutschen Rhein Ruhr Stahl AG und der Al Salam Incorporated.
Beide Unternehmen hatten ihre Kräfte und Interessen gebündelt, um den Streitkräften des Königreiches Saudi Arabien zu U-Booten zu verhelfen.
Zufrieden sah Schmehling zu, wie der Kellner eine Flasche Louis Roederer Cristal Rosé öffnete und ihre Gläser füllte.
Die gute Laune Schmehlings rührte daher, dass es bereits einen Vorvertrag des Saudischen Verteidigungsministeriums gab, von diesem Konsortium, das unter dem Namen Salam-DRRS firmierte, ein gebrauchtes U-Boot der Klasse RR 102M sowie vier neue Boote dieser Klasse zu erwerben, wobei die Zwei für die zweihundert Tonnen Verdrängung des Bootes und das M für modified, verändert, stand.
Zudem sollte die DRRS ein U-Bootsbegleitschiff bauen, das die Probefahrten der bei Al Salam fertiggestellten U-Boote überwachen und vermessen und das während der Seeerprobungen den stetigen Kontakt zum Boot halten würde.
Der Vorvertrag sollte unmittelbar nach Inkrafttreten des Konsortialvertrages Rechtsgültigkeit erlangen und in einen Liefervertrag umgewandelt werden.
Der Vertragswert lag bei zwei Milliarden EURO, von denen allein hundert Millionen für den Aufbau einer kleinen Werftanlage in Dhahran am Arabischen Golf reserviert waren.
Graf wusste, das war eine Menge Geld für den Bau einer Montagehalle mit Kränen, einem Shiplift und einer Pier von gerade mal 100 m Länge.
Mit Ausnahme des ersten Bootes, das die Pakistanische Marine an die DRRS zurückgegeben hatte, um im Gegenzug ein völlig neues Boot zu erhalten, allerdings erst in vier Jahren, würden die Boote 2 bis 5 in Segmenten nach Dhahran verschifft und dort in der Montagehalle zu fertigen Bootskörpern zusammengebaut. Das erste Boot würde, um Zeit zu sparen, in Deutschland so weit fertiggestellt und ausgerüstet, dass lediglich noch zwei Sektionen in Dharan miteinander verschweißt werden mussten. Die vordere Sektion würde die Mannschaftsräume und das gesamte Waffen- und Führungssystem enthalten, die hintere das gesamte Antriebssystem einschließlich Brennstoffzelle.
Für den Zusammenbau der Segmente erhielt die Al Salam einen Betrag pro Boot von 100 Millionen EURO. Der tatsächliche Wertbeitrag der Al Salam Inc. belief sich bestenfalls auf 20 Millionen pro Boot.
Der Bau der Segmente in Deutschland war mit 200 Millionen pro Boot sehr großzügig bemessen! Hinzu kamen 200 Millionen für das Ersatzboot für Pakistan sowie die Modernisierung der Sektionen des alten Bootes, für die 100 Millionen vorgesehen waren. Da die Arbeiten der Al Salam an diesem Boot geringer sein würden als für die Folgeboote, erhielt sie hierfür lediglich 70 Millionen.
Ein erheblicher Betrag war für Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen reserviert. Neben einem Simulator für den Schiffsbetrieb sollte ein Taktischer Trainer geliefert werden, eine Computerinstallation, in der die Saudis jede denkbare Art von U-Bootskriegsführung würden simulieren und durchspielen können. Zudem würde es Trainingseinrichtungen geben, an denen Reparaturen von Motoren und Geräten eingeübt werden konnten. Letztlich würde noch mal die Ausrüstung für ein sechstes U-Boot in Einzelteilen geliefert, nur dass diese Teile nicht miteinander verbunden und in einen Druckkörper installiert sein würden, sondern aufgebaut in verschiedenen Räumlichkeiten der Al Salam in Dhahran. Dort konnten junge Ingenieure und Offiziere üben, die Geräte auseinander zu nehmen, zu reparieren, und sie wieder zusammenzubauen.
Zusätzlich gäbe es Wassertanks, in denen der Wassereinbruch in einen Schiffskörper simuliert werden konnte, oder Schiffskammern, in denen das Löschen von Bränden trainiert würde. Ein weiterer namhafter Betrag war vorgesehen für die Entsendung von Ausbildern. Ingenieure der DRRS-Werften und Offiziere der Deutschen Marine, zum Teil Männer im Ruhestand, andere eigens für diese Aufgabe aus dem aktiven Dienst beurlaubt, würden nach Dhahran übersiedeln und hier beim Zusammenbau der Segmente und beim Training der Mannschaften behilflich sein.
Sorge machten Graf allein die recht hohen Strafzahlungen, welche die Saudis für verschiedene Sachverhalte gefordert hatten. Dabei ging es weniger um die Leistungsdaten der Boote. Diese waren durch die Erfahrungen bei vorausgegangenen Aufträgen für andere Kunden schon oft nachgewiesen worden.
Ganz erheblich jedoch waren die Strafen, die von saudischer Seite für verspätete Lieferung gefordert wurden!
Das Risiko einer Spätlieferung des ersten Bootes lag allein bei den deutschen Werften. Die Lieferzeit war mit zwei Jahren äußerst knapp bemessen, und Graf hatte Zweifel, dass dieser Termin tatsächlich eingehalten werden könnte. Aber die Ingenieure der Werften hatten Graf beruhigt und statt dessen auf das Risiko hingewiesen, das durch die Einschaltung der Al Salam entstanden war: Selbst wenn die DRRS die Segmente für die Boote 2 bis 5 plangemäß in Dhahran ablieferte, konnte niemand sicherstellen, dass die Al Salam die ihr übertragenen Aufgaben zeitgerecht erfüllen konnte und würde.
Also wurden für alle diese Strafzahlungen Rückstellungen gebildet, das Geld dafür auf die hohe Kante gelegt.
Trotzdem blieb eine Menge Geld übrig!
Ein stattlicher Betrag!
Gut, es fielen Finanzierungsnebenkosten an, Bankgebühren, Garantiekosten.
Ein namhafter Betrag war reserviert für den Inflationsausgleich während der Bauzeit. Die Saudis hatten auf einem Festpreis bestanden und lehnten jede Form von Preisgleitklausel ab.
Scheich Mahmut al Ibrahim und Rupert Graf hatten mehrere Tage darüber gefeilscht wie die Kesselflicker und sich fast zerstritten, um festzulegen, welcher Betrag unter dem Titel „Unvorhergesehenes“ in der Konsortialkasse angehäuft werden sollte. Der Streit, der in überwiegend nächtlichen Sitzungen in den Büros von Mahmut in London und Paris ausgefochten worden war, drehte sich neben der Höhe vor allem darum, wo dieses Geld deponiert werden sollte, in Saudi Arabien oder in Europa. Graf, der wusste, dass man gegen den Willen eines Saudis keinen Cent aus dem Lande bringen konnte, bestand auf Europa, Mahmut hatte zahlreiche Begründungen, warum nur Saudi Arabien in Frage kam.
Vereinbart wurde schließlich ein Depot in einer Bank in Genf mit der Maßgabe, den nicht benötigten Wert zum Schluss hälftig zwischen DRRS und Al Salam zu teilen.
Schmehling tangierte dies alles nicht.
Deshalb war er auch so gut gelaunt.
Seine fünf Prozent würden je zur Hälfte von Mahmut und der DRRS übernommen, eine Lösung, mit der Rupert Graf gut leben konnte.
Als sie sich mit dem Champagner zuprosteten, sagte Mahmut:
„Mr. Graf, schade, dass Sie so ein schwieriger Mann sind. Wir werden wahrscheinlich niemals richtige Freunde sein. Trotzdem sollten Sie wissen, dass unsere Zusammenarbeit die Welt verändern wird.“
Sabine Sadler saß derweil allein in der Bar des Hotels de Paris.
Sie war gerne nach Monaco mitgekommen, auch wenn sie wusste, Rupert Graf würde sie wegen seiner geschäftlichen Termine allein lassen müssen.
Sie hatte sich gleich links hinter dem Eingang der Bar einen Tisch geben lassen, an dem sie ungestört war und ihren Gedanken nachhängen konnte.
Allein zu sein, war für Sabine Sadler kein Problem. Sie erkundete gerne auf eigene Faust Ortschaften, die sie noch nicht kannte, und Monaco, obwohl klein und übersichtlich, war mit seinem Reichtum und seinem Luxus in so geballter Form für sie etwas völlig Neues.
Als Rupert Graf ihr empfohlen hatte, mal durch die engen Gassen auf dem Berg Karl zu schlendern und sich dort auch mal das Häuschen der Familie Grimaldi anzusehen, hatte sie ihn zunächst völlig verständnislos angeguckt. Sie hatte lachen müssen, als ihr bewusst wurde, dass er vom Monte Carlo und vom Schloss der monegassischen Fürstenfamilie sprach.
Sabine Sadler freute sich darauf, dass Rupert irgendwann in der Nacht zu ihr ins Bett kriechen würde. Sie wusste, er war mit arabischen Geschäftspartnern unterwegs, und sie wusste, für die begann der Abend erst gegen 23 Uhr.
Inzwischen hatte sie oft genug miterlebt, dass Rupert gegen vier Uhr morgens zurück ins Hotel kam, manchmal müde, meistens jedoch überdreht und hellwach.
Sabine Sadler genoss es in solchen Fällen, ihn zu massieren, ihm Entspannung zu verschaffen und sich irgendwann in den frühen Morgenstunden an ihn zu kuscheln.
Die Welt, in die Rupert Graf sie geführt hatte, war ihr neu und unheimlich. Sie hatte sich schnell daran gewöhnt, bei längeren Flügen in der ersten Klasse zu reisen und in Hotels erster Kategorie abzusteigen.
Seit sie mit Rupert zusammen war, hatte sie in Hotels gewohnt, die sie bis dahin nur aus Illustrierten gekannt hatte.
Woran sie sich nicht hatte gewöhnen können, war Ruperts Rastlosigkeit. Inzwischen begleitete sie ihn nur noch, wenn das Reiseziel neu war oder ihre Arbeit an der Uni es erlaubte, mal ein zwei Tage zu schwänzen.
Aber Rupert schien ständig unterwegs zu sein.
Vierzehn Stunden Flug nach Peking. Ankunft am Morgen. Während sie die Verbotene Stadt erkundete und auf dem Platz des Himmlischen Friedens spazieren ging, hatte Rupert irgendwelche Termine. Abends ein Essen mit mindestens zwanzig Gästen. Außer einem Dolmetscher sprach niemand Englisch. Sie verstand nicht einmal, worum es überhaupt ging.
Am nächsten Morgen Rückflug nach Frankfurt.
Sie flog weiter nach Düsseldorf, Rupert verabschiedete sich von ihr noch in Frankfurt, weil er nach Abuja weiter musste.
„Wo zum Teufel ist Abuja?“ hatte sie gefragt.
„Nigeria.“
„Und wo genau ist Nigeria?“
„Zentralafrika. Übermorgen bin ich wieder zuhause.“
Aber kaum war er zuhause, hieß es, ich muss nach Washington, nach London, nach Paris, nach Rio.
Sabine Sadler reiste nur mit, wenn die Reisen kurz waren. Zwei, drei Tage höchstens.
Weder ihre Eltern noch ihr Verlobter hatten die blasseste Ahnung, dass sie nicht im Hörsaal in Düsseldorf saß, sondern einen Mann um die halbe Welt begleitete, der ihr Vater hätte sein können!
Jedes zweite Wochenende verbrachte sie in Ihrem Heimatort an der Mosel, ein Wochenende im Monat kam ihr Verlobter und besuchte sie in Düsseldorf. Bemerkungen über ihre Sonnenbräune tat sie ab mit: „Sonnenstudio!“, um sich anschließenden lebhaften Diskussionen über die Gefahren des Hautkrebses ausgesetzt zu sehen.
Hätte jemand sie gefragt, ob sie Rupert Graf liebte, sie hätte diese Frage verneinen müssen. Sie war sich sicher, sie liebte Graf nicht. Sie war allerdings bereit, zuzugeben, fasziniert zu sein von seiner Welt und von seiner Umtriebigkeit. Zu Grafs Unrast und seinem ständigen Aktivitätsdrang gehörte ein aktives Liebesleben, das sie sehr genoss, ihr aber zuweilen auch zuviel wurde. Andererseits führte er sie zu zuvor nie erlebten Höhepunkten. Nie zuvor war sie in der Lage gewesen, so wie bei Rupert Graf alle Hemmungen fallen zu lassen und in ihrer Lust Dinge zu tun, die ihr allein im Traum nicht eingefallen wären!
Niemals wäre sie bereit gewesen, das Bett mit Ihrem Verlobten und einer Dritten zu teilen. Zuzusehen, wie diese völlig Fremde sich hingab, oder zu erleben, wie diese Frau sich an ihr selbst zu schaffen machte. Und wie sie dies genossen hatte.
Sabine Sadler hatte lange überlegt, ob sie Rupert Graf nicht doch berichten sollte, dass sie erpresst wurde.
Der kleine unscheinbare Mann, von dem sie nur den Namen Ariel wusste, hatte sie in dem Gespräch in Düsseldorf in der Studentenkneipe „Ergo Bibamus“ überzeugt, dass es besser für sie war, auf seine Forderungen einzugehen.
Es war ja nicht viel, was sie tun sollte. Aufzeichnungen machen darüber, wohin Graf reiste, mit wem er sich traf. Sie musste nicht heimlich Unterlagen fotografieren, die Graf mit in seine Wohnung brachte, oder Gespräche belauschen.
Nur sagen, wann eine Reise anstand und das Ziel nennen. Und wenn möglich, Namen oder Position seiner Gesprächspartner.
Und dann hatte sie diese Daten per SMS an das Telefon von Ariel zu schicken. Das war alles.
Zu diesem Zweck hatte Ariel ihr sogar ein eigenes Mobiltelefon gegeben. Er hatte ihr eingeschärft, ausschließlich dieses Telefon für die Mitteilungen an ihn zu benützen, und niemals ihr eigenes. Und sie sollte dieses Telefon niemals für ihre Privatgespräche nutzen!
In dem Telefon war nur ein einziger Name eingespeichert: Ariel. Keine Nummer. Es wurde auch keine Nummer sichtbar.
Sabine Sadler war nicht dumm. Entgegen der Anweisung Ariels hatte sie über die Tastatur ihr eigenes Handy angewählt und dieses dreimal klingeln lassen, ohne den Anruf entgegenzunehmen. Dann hatte sie auf ihrem Handy nachgeguckt, ob der verpasste Anruf mit einer Nummer unterlegt war. Da stand aber nur: Unbekannt.
Wenige Minuten darauf hatte sie allerdings eine SMS von Ariel erhalten, der schrieb:
„Tun Sie das nie wieder!“
Etwas lästig war, dass sie dieses Gerät, so winzig es auch war, immer bei sich tragen musste, damit sie jederzeit Ariel benachrichtigen konnte. Außerdem sollte sie mindestens zweimal täglich nachsehen, ob eine Nachricht von Ariel eingegangen war.
Ob die Informationen, die Sabine Sadler in den vergangenen Wochen an Ariel geliefert hatte, irgendeinen Wert besaßen, konnte sie nicht einschätzen. Ihrer Meinung nach konnte es nicht sonderlich wichtig für jemanden Dritten sein, zu wissen, wohin Graf reiste oder wen, wenn sie das überhaupt herausbekam, er dort traf.
Und solange sie selbst in Frieden gelassen wurde, und ihre Familie und ihr zukünftiger Ehemann nichts mitbekamen, war ihr alles recht!
Sabine Sadler war nicht unglücklich, hier allein zu sitzen. Sie hatte auf Empfehlung Grafs in einem Restaurant in Fußweite, Rampoldi, vorzüglich zu Abend gegessen. Das Hotel hatte dort bei der Reservierung von Sabines Tisch hinterlassen, die Rechnung ginge an das Hotel de Paris. Sie hatte ein paar Lehrhefte zu ihrem Studium dabei, die sie unbedingt hatte durcharbeiten müssen und in denen sie sich während des Essens, aber auch jetzt in der Hotelbar noch einige Notizen machte. Sie mochte es, nachts zu arbeiten. Das Stimmengemurmel störte sie nicht, ebenso wenig wie die dezente Musik. In der Bar hatte in der letzten Stunde eine gediegene ruhige Atmosphäre geherrscht, die Sabine Sadler durchaus Gelegenheit gab, ihre Unterlagen zu studieren.
Diese Ruhe wurde jedoch gegen kurz nach eins sehr plötzlich unterbrochen durch mehrere Pressefotografen, die in die Bar gestürmt kamen und mit Blitzlicht eine Gruppe von zwei Paaren ablichteten, die ihnen in die Bar folgte. Drei Kellner trieben allerdings innerhalb weniger Sekunden die Fotografen hinaus und es wurde wieder ruhig.
Sabine Sadler versuchte, herauszufinden, wem diese Aufmerksamkeit galt. Die beiden Paare konnte sie nur von hinten sehen. Allerdings erschien wenige Minuten, nachdem wieder Ruhe eingekehrt war, ein Kellner mit einem Glas Champagner an ihrem Tisch und sagte:
„Madame Graf, wir bitten Sie höflich, diese Belästigung zu entschuldigen. Paparazzi!“ Das letzte Wort klang, als müsse er sich übergeben.
In diesem Augenblick drehten sich die beiden Paare vor ihr um und prosteten ihr lächelnd zu: Eine der Damen ein Mitglied des monegassischen Fürstenhauses mit ihrem Gemahl, die andere eine prominente amerikanische Filmschauspielerin mit, Sabine musste zweimal hingucken, um sicher zu sein, einem Gitarristen einer der bekanntesten und ältesten britischen Rockbands, gezwängt in einen mitternachtsblauen Abendanzug!
Und genau in diesem Moment blinkte noch ein Blitzlicht auf.
Auch dieser Fotograf wurde sofort unter Schimpfworten der Kellner vertrieben.
Sabine Sadler fand das Ganze ziemlich grotesk.
Sie hatte sich nie sonderlich für Berichte in Illustrierten über sogenannte Prominente interessiert, und auch jetzt war sie eher amüsiert über das Theater, das sie gerade miterlebt hatte. Sie war ziemlich sicher, dass einer der Kellner die Presse über das Erscheinen dieser Gäste unterrichtet und dafür bestimmt mehrere großzügige Trinkgelder kassiert hatte.
Sabine Sadler beobachtete mit einem gewissen Interesse, wie sich um den Tisch der beiden prominenten Paare einige andere Gäste scharten. Alle schienen einander zu kennen. Die Kellner schafften Champagner heran und gossen Gläser voll.
Sabine Sadler schaute von ihrem Platz aus zu und trank in Ruhe ihr Glas aus. Gerade, als sie sich in ihr, beziehungsweise Rupert Grafs Zimmer zurückziehen wollte, kam wiederum ein Kellner und bat sie, am Tisch Ihrer Fürstlichen Hoheiten doch noch einen Drink zu nehmen. Als sie versuchte, dankend abzulehnen, kam der Rockstar dazu und packte sie stumm am Arm, um sie mit sich zu ziehen. Sie war zu fasziniert von den Falten in seinem Gesicht, die tiefer zu sein schienen als die Gräben des Grand Canyon, und von den Brillanten, die auf der Fliege unter seinem Kinn glitzerten, um ernsthaft protestieren zu können!
„Was macht diese dämliche Schickse da nur?!“ fluchte Ariel Roth zwei Etagen höher in dem Zimmer, das er sich mit Ezrah Goldstein teilte. Ariel, genannt Ari, war Führungsoffizier dieses Frauenzimmers. „Wann geht denn diese Kuh endlich ins Bett?“
„Geduld, Ari, Geduld!“ antwortete Ezrah Goldstein.
Hätte Sabine Sadler mit Rupert Graf je über Ariel gesprochen, hätte er wahrscheinlich darum gebeten, das ihr von Ariel ausgehändigte Telefon dem Sicherheitsdienst seines Unternehmens zur Prüfung aushändigen zu können. Dieser Dienst hätte bemerkt, dass das Telefon aus der Ferne durch ein elektronisches Signal angeschaltet werden konnte, ohne dass dies für den Besitzer überhaupt erkennbar wurde. Und mit dem Moment des Einschaltens fungierte das Telefon wie ein Mikrofon, das alle Geräusche an ein extern eingerichtetes Aufnahmegerät übertrug.
Wo immer Sabine Sadler gerade war, konnte Ariel jedes Geräusch und jedes gesprochene Wort mithören!
Und Ari war alles andere als froh, hier noch sitzen und das Geplauder angeheiterter Nachtschwärmer anhören zu müssen. Sein einziger Trost war, dass auch Ezrah Goldstein diesem Gequatsche zuhören musste.
Sie teilten sich das Zimmer. Ihr Dienst wäre nicht bereit gewesen, für jeden von ihnen den Preis eines Einzelzimmers zu bezahlen. Schon gar nicht in diesem sündhaft teuren Hotel! Zudem konnten sie sich so an dem Gerät ablösen, das die von Sabine Sadlers Telefon aufgenommenen Geräusche wiedergab. Im Moment hatten sie den Kopfhörer, der die Lautsprecher des Gerätes automatisch auf stumm schaltete, herausgezogen, so dass sie beide das Stimmengewirr und Gelächter aus der Hotelbar hören konnten.
Ari Roth maulte. Er wollte schlafen. Es war tiefe Nacht. Normale Menschen schliefen um diese Zeit. Morgen würden sie abwechselnd Sabine Sadler folgen müssen, und, wenn sie mit Graf zusammen traf, über das Handy die Gespräche zwischen Graf und der jungen Frau mithören, aber auch den Teil der Gespräche, den Graf über sein eigenes Mobiltelefon bestritt.
„Schschschscht!“ machte Ezrah Goldstein und winkte Ari, er solle still sein. Norbert Schmehling und Rupert Graf waren zu der Gruppe gestoßen.
Sie hörten zu, wie Schmehling die Mitglieder der fürstlichen Familie begrüßte, mit denen er offensichtlich gut bekannt war, und Rupert Graf vorstellte. Als Graf sich als Begleiter der jungen Dame herausstellte, die Ihre Durchlauchten so freundlich an ihren Tisch eingeladen hatten, gab es großes Hallo und die Aufforderung, sich dazu zu gesellen. Es war Schmehling, der ablehnte mit der Begründung, Graf und er hätten Geschäftliches zu besprechen und wollten sich in einen ruhigen Winkel zurückziehen. Beide redeten jedoch Sabine Sadler zu, bei der Gesellschaft zu bleiben.
„Scheiße!“ sagte Ari Roth. „Das wäre eine schöne Gelegenheit gewesen, Graf und Schmehling zuzuhören!“
Aber genau in diesem Augenblick fragte Sabine Sadler:
„Rupert, bist du so nett, die Mappe mit meinen Unterlagen an dich zu nehmen? Dann muss ich die nicht ständig im Auge behalten!“
An den Geräuschen aus dem Lautsprecher hörten Ezrah Goldstein und Ari Roth, dass sich das Handy in dieser Mappe befinden musste.
Goldstein grinste Roth breit an und sagte nur:
„Massel tow!“
Hakeem bin Zaif saß wenige Tage später mit einer Reihe von Freunden zusammen im Nebengebäude der Moschee, in der sie sich zum Gebet zu versammeln pflegten. Im Anschluss an das Nachmittagsgebet trafen sie sich hier zu Diskussionen und zu Interpretationen des Heiligen Buches. Als Sohn eines der ranghöchsten Militärs im Lande hatte Hakeem die Ehre, in unmittelbarer Nähe des Imam sitzen zu dürfen.
Der Imam war ein Mann in den Vierzigern, dessen Vater und dessen Vorväter bereits Gelehrte gewesen waren, die in sämtlichen muslimischen Staaten bis hin nach Indonesien gepredigt und den Koran ausgelegt hatten. Auch Imam Hadschi Omar hatte zu den Gläubigen gesprochen, in Marokko im Westen, in ganz Nordafrika, im Sudan, in Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, in Indonesien, sogar auf den Philippinen.
Hadschi Omar war nach Gaza und in die Westbank gereist, selbst im Iran und im Irak war er gewesen, zu Zeiten, als dort bereits der Krieg tobte.
Hadschi Omar war ein Held! Ihr Held!
Was die kleine Gruppe von Schülern und angehenden Studenten vereinte, war ihre Wut.
Ihre Wut auf Israel, das seit mehr als sechs Jahrzehnten ihre Glaubensbrüder in Palästina unterdrückte, und ihre Wut auf die Amerikaner, die Israel völlig unkritisch unterstützten.
Sie wussten nicht, auf wen dieser beiden Staaten sie wütender sein sollten. Aber die Amerikaner waren hier! Hier, in ihrem eigenen Land, mit Panzern, Flugzeugen, sogar mit Schiffen, die, wie Hakeem von seinem Vater wusste, in den Marinebasen von Jeddah und Dhahran gewartet und versorgt wurden. Und die im benachbarten Bahrain eine eigene amerikanische Marinebasis besaßen. Ein kleines Stück USA!
Die Amerikaner, die die gesamte arabische Nation beleidigt hatten, als sie während des Golfkrieges in Scharen in Saudi Arabien eingerückt waren, laut, arrogant, unverhohlen auf die einheimische Bevölkerung herabblickend.
Nicht nur, dass sie ungefragt und ungebeten den Schutz der arabischen Halbinsel übernommen hatten und im Gegenzug enorme Geldbeträge dafür verlangten. Sie hatten so getan, als seien die Araber zu faul oder zu feige, sich selbst zu verteidigen! Welche Beleidigung für ein Volk, das sich am Anfang des vergangenen Jahrhunderts unter großen Opfern, aber todesmutig den türkischen Besatzern trotz deren überlegenen Waffen entgegengestellt und diese aus dem Lande getrieben hatte! Als wäre die reine Anwesenheit der Amerikaner nicht genug gewesen, hatten diese auch noch Frauen geschickt, Soldatinnen, Wesen ohne Seelen, vorgeblich, um Arabien und die heiligen Stätten des Islam zu schützen! Frauen, die in offenen Jeeps mit wehendem Haar durch die Straßen Riads und der weniger kultivierten Orte gefahren waren, ein Hohn und eine Herausforderung für jeden Gläubigen, der von seiner eigenen Frau verlangte, den Schleier zu tragen und ihr Haar zu verstecken, selbst wenn engste Familienangehörige zu Besuch kamen!
Sie hassten die Amerikaner!
Fast alle aus ihrer Gruppe waren einmal in den USA gewesen.
Hakeem erinnerte sich an den Besuch gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern in New York und in Florida.
Welch ein Sündenpfuhl!
So voller Sünde, dass er selbst – Allah möge ihm vergeben - außerstande gewesen war, der Versuchung zu widerstehen. Noch immer dachte er voller Scham an seine Erfahrungen mit Freudenmädchen in New York und in Miami! Herausgeputzte schamlose Weiber, die sich ihm an den Hals geworfen und anschließend für ein kurzes und äußerst geschäftsmäßig abgewickeltes Vergnügen eine Menge Geld verlangt hatten.
Und wie hatten die Amerikaner ihre arabischen Freunde behandelt?
Den Schah von Persien, einen Vetter der eigenen königlichen Familie, fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, als sie ihn nicht mehr brauchten.
Saddam Hussein, einen weiteren arabischen Vetter, erst als guten Freund mit den modernsten Waffen versorgt, damit er seinen Krieg gegen den Ajatollah führen konnte, dann zum Feind erklärt, als es den amerikanischen Interessen diente! Osama bin Laden, einen der Ihren, benutzt wie eine Hure, um den Widerstand in Afghanistan gegen die Russen anzuführen, aber nach erfolgreich geführter Schlacht fallen gelassen!
Was würden die Amerikaner mit der Führung Saudi Arabiens machen, wenn sie diese nicht mehr bräuchten? Mit dem alten und von Krankheit schwer gezeichneten König, dem ältesten noch lebenden Sohn des von allen verehrten Staatsgründers Abdul Aziz.
Was die Amerikaner wollten, war ihr Öl! Das einzige Wertvolle, das ihr Land zu bieten hatte. Die Amerikaner hatten eigene Ölquellen, ergiebig genug, um ihr gesamtes Volk zu versorgen. Aber sie importierten lieber Öl und hoben ihr eigenes auf!
Mehrere aus ihrer Gruppe hatten Ferienzeiten dazu benutzt, sich in Lagern in Afghanistan ausbilden zu lassen. Sie hatten begeistert davon erzählt. Hakeem träumte davon, auch in ein solches Lager zu gehen, eine Ausbildung an Waffen und in der Herstellung von Bomben zu erhalten, mit den anderen zu beten und die Predigten der kämpferischen Geistlichen zu hören. Und sich vorzubereiten auf den Kampf gegen die Ungläubigen, die der arabischen Welt eine Beleidigung nach der anderen zufügten!
Die Freunde Hakeems stammten ebenso wie er selbst aus angesehenen Familien. Die Väter waren Geschäftsleute, Ärzte, oder Militärs wie sein eigener Vater.
Unter der Anleitung von Hadschi Omar stellten sie Überlegungen an, wie die amerikanischen Feinde am besten zu treffen wären. Sie alle waren voller Bewunderung für die Handvoll Männer, die zu Beginn der Neunzigerjahre unter Gefahr für ihr eigenes Leben den mutigen Sprengstoffanschlag auf einen Wohnblock der amerikanischen Soldaten in Riad ausgeübt hatten. Aber jetzt kam man als Araber gar nicht mehr nah genug an derartige Einrichtungen heran, obwohl sie sich mitten in ihrer eigenen Hauptstadt befanden!
Und trotzdem musste es Wege geben, den Amerikanern zu zeigen, dass sie hier nicht erwünscht waren!
Sie wollten ein Zeichen setzen, das in Amerika nicht übersehen werden konnte, ein Fanal, das in der gesamten arabischen Nation grenzenlosen Jubel auslösen und den palästinensischen Brüdern nachhaltig beweisen würde, dass sie nicht vergessen worden waren.
Etwas, so einzigartig wie die Anschläge des 11. September 2001, als die Araber dem Rest der Welt gezeigt hatten, zu welch exakt berechneten Planungen sie fähig waren!
Hakeem betete inbrünstig zu Allah um eine Eingebung, wie ein solches Zeichen aussehen könnte.
An die Passdaten des Predigers Omar bin Othman zu kommen, war für Lieutenant Commander Carl Almaddi kein ernstes Problem. Das Königreich benutzt Rechner und Software aus den USA auch für die Verwaltung von Personendaten. Almaddi hatte eine Kopie der Passseiten mit den wesentlichen Angaben über Omar, sogar mit Bild.
Almaddi hatte ferner Zugriff auf die Rechner der saudischen Einwanderungsbehörde. Anders als westliche Länder registriert Saudi Arabien auch die Aus- und Wiedereinreisen seiner eigenen Bürger.
Wie Almaddi sehen konnte, war der Imam drei Tage nach seinem Anruf mit einem Rückflugticket der Saudi Airlines von Riad nach Dubai geflogen. Erst dort hatte er einen Flug der Pakistan International Airways nach Islamabad gekauft.
Für die rund zweihundert Kilometer von der pakistanischen Hauptstadt zur Grenzstadt Peshawar benötigt man mit dem Auto gute vier Stunden. Pro Fahrt. Da der Imam jedoch nur 6 Stunden in Islamabad geblieben war und es in dieser Zeit keine brauchbare Flugverbindung zwischen beiden Städten gegeben hatte, ging Almaddi davon aus, der Gesprächspartner Omars war nach Islamabad gekommen.
„Am üblichen Ort“.
In Islamabad befindet sich die größte Moschee der Welt, ein Geschenk des früheren saudischen Königs Fahd an die damals noch junge pakistanische Hauptstadt.
Wie Almaddi weiter hatte herausfinden können, war der Prediger in den vergangenen Jahren viermal nach Islamabad gereist. Jedesmal über Umwege, selbst wenn ihm Direktflüge zur Verfügung gestanden hatten. Alle vier Male war er zunächst von Saudi Arabien ausgereist und hatte den Weiterflug erst auf den Umsteigeflughäfen gekauft. Und jedes Mal bar bezahlt.
Offenbar bestand ein regelmäßiger Kontakt zu den in Peshawar vermuteten Taliban.
Welche Hilfe mochte der Imam dieses Mal in Pakistan gesucht und gefunden haben für U-Boote, die es noch gar nicht gab?
„Herr Graf,“ sagte Brigitte Orlowski, als sie Rupert Graf seine Tasse Kaffee brachte, die er während der Lektüre seiner Post leeren würde. „Wir haben mal wieder eine Computerüberprüfung. Ich hatte zwar darum gebeten, dass man das macht, wenn Sie unterwegs sind, aber es ließ sich nicht ändern. Bei einem externen Check sind Unregelmäßigkeiten entdeckt worden, und die Sicherheitsexperten wollten unbedingt mit Ihnen persönlich sprechen. Die kommen so gegen zehn.“
„Guckt jemand von meinem PC aus Pornofilme, wenn ich verreist bin?“ fragte Graf .
„Nein, aber es ist festgestellt worden, dass mehr Datenabflüsse berechnet werden, als das System offiziell abgibt.“
„Was heißt das?“
„Dass jemand das System angezapft hat und Daten abruft. Und dieser Abruf wird vom Unternehmen bezahlt!“
„Verstehe ich immer noch nicht.“
„Wir kriegen doch jeder hier im Gebäude eine Einzelrechnung für seinen Telefonapparat. Die Summe aller Einzelrechnungen müsste also das sein, was im gesamten Unternehmen vertelefoniert wurde. Wenn aber der insgesamt zu zahlende Betrag höher ist als die Summe aller Einzelrechnungen, muss jemand telefonieren, ohne dass es registriert werden kann! Nur sprechen wir nicht vom Telefon, sondern vom IT-System.“
„Und dazu müssen die mir die Zeit stehlen?“
Brigitte Orlowski zuckte nur mit den Schultern.
Als anderthalb Stunden später drei Herren mit ernsten Gesichtern in Grafs Büro geführt wurden, erkannte Graf nur einen, den Chef des Sicherheitsdienstes des Unternehmens, Peter Vogel.
Vogel stellte die beiden anderen als Experten aus dem IT-Bereich vor.
„Wir haben irgendwo ein Leck, Herr Graf,“ erklärte Vogel und beschrieb, wie sie darauf gekommen waren. Die Erklärung war in etwa die, die bereits Frau Orlowski gegeben hatte.
„Und warum kommen Sie geradewegs zu mir?“ fragte Graf.
„Weil Sie mit militärischen Gütern zu tun haben,“ antwortete Vogel. „Da liegt es am nächsten, dass abgehört wird. Aber Ihre Kollegen aus dem Panzerverkauf und aus dem Vertrieb von Geschützen sind genauso betroffen.“
„Technische Daten gehen nicht über meinen Tisch. Alles, was aus der Technik dem Geheimschutz unterliegt, ist in den Produktionsbetrieben und nicht hier in der Hauptverwaltung. Müssten Sie nicht eher bei den Werften in Bremen oder in den Kanonenschmieden in München und Bochum ansetzen?“
„Deren Leitungen sind absolut sicher! Da kümmern sich neben ganzen Expertenteams des Unternehmens auch noch verschiedene Bundesorgane drum. Alles, was da an technischen Daten rausgeht, wird vorher digitalisiert und codiert. Nein, nein, das Leck muss hier in der Hauptverwaltung sein. Ob Sie tatsächlich betroffen sind, kann ich noch nicht sagen. Es kann genauso gut eine Abhöraktion im Gange sein, die sich gegen andere Vertriebsbereiche richtet. Wir werden auch den Verkauf Alternativer Energien durchforsten. Was Windräder und Solarzellen angeht, betreiben die Amerikaner lebhafte Industriespionage.“
Rupert Graf wusste, dass nach dem Ende des Kalten Krieges weltweit zahllose Geheimdienste, die sich zuvor der militärischen Spionage gewidmet hatten, verkleinert oder gar aufgelöst worden waren. Da deren Experten jedoch nichts anderes gelernt hatten als zu spionieren, verlegten die sich nun auf Industriespionage. Die US-Regierung hatte dies sogar völlig ungeniert zugegeben und dazu ausgeführt, das diene schließlich den Interessen der USA.
„Was genau machen Sie?“ fragte Graf.
„Wir bauen Ihre Festplatte aus und prüfen die. Für die Zwischenzeit erhalten Sie einen neuen PC. Auf den spielen wir alle Dateien auf, die älter sind als zwei Jahre. Alles was danach kommt, wird erst einmal separiert und kommt auf separate Datenträger, so dass Sie mit diesen Dateien weiter arbeiten können. Allerdings müssen Sie penibel darauf achten, nichts davon auf Ihrer Festplatte zu speichern. Dies gilt genauso für Ihr Sekretariat und für Ihre Mitarbeiter hier in Oberhausen.“ Vogel zuckte mit den Achseln.
„Und dann werden wir uns auf den alten Festplatten auf die Suche machen! Das wird ´ne Scheißarbeit, sage ich Ihnen!“
Mit Allahs Hilfe hatte Ahmed Falouf es geschafft, Kontakt zu Siddiqui knüpfen. Es war eigentlich mehr ein Zufall. Kismet. Ahmed hatte General Faisal zur Residenz des indonesischen Botschafters gefahren, wo ein Empfang wegen eines nationalen Feiertags stattfand. Der General hatte auf der Fahrt dorthin missmutig vor sich hin gegrummelt, dass er eigentlich besseres zu tun hatte. Ahmed hatte den Wagen des Generals vor dem Eingangsportal der Residenz angehalten, wo Bedienstete der Botschaft dem General aus dem Wagen geholfen hatten, und war er zu dem nahegelegenen reservierten Platz gefahren, wo auch die anderen Chauffeure warten mussten. Zunächst waren alle in ihren Autos sitzen geblieben, um im Fernsehen das Ende der Übertragung des Fußballspiels zwischen der Nationalmannschaft Saudi Arabiens gegen die des Irans zu verfolgen. Dazu mussten sie sich auf einen der Sitze im Fond begeben. Die Bildschirme waren in die Kopfstützen der Vordersitze eingebaut. Dass währenddessen sämtliche Motoren liefen, um die Klimaanlagen in Gang zu halten, hatte niemanden gestört.
Nach dem Ende des Spiels waren die meisten der Fahrer ausgestiegen, um zu rauchen und um das Spiel zu kommentieren.
Es war Siddiqui, der ihn angesprochen hatte! Siddiqui in seiner weißen Marineuniform. Siddiqui hatte ihn wiedererkannt und ihn freundschaftlich begrüßt! Ein Zeichen Allahs!
Mit Namen ist das so eine Sache: In der europäisch-amerikanischen Welt erhalten Kinder einen Vornamen und tragen in der Regel den Nachnamen des Vaters. Sofern die Eltern verheiratet sind. Sonst ist der Nachname der Familienname der Mutter. In den Ländern Spanien und Portugal trägt ein Nachfahre als Familiennamen den des Vaters, hängt aber den Familiennamen der Mutter noch hinten dran, oft nur abgekürzt mit dem Anfangsbuchstaben. Bei adligen Familien werden die so entstandenen Doppelnamen oft über mehrere Generationen zurück aufgeführt, was, solange das Papier reicht, zu bombastischen Namen führen kann.
Ein Skandinavier namens Sven, dessen Vater Johann heißt, wird Sven Johannson heißen. Hat Sven eine Schwester namens Anna, heißt die: Anna Johannsdotter, sprich: Tochter von Johann.
In der arabischen Welt ist es ganz ähnlich, der Knabe Mohammed wird, wenn sein Vater Abdul heißt, Mohammed bin Abdul oder Mohammed ibn Abdul heißen.
Die Pakistani sind nicht so kompliziert. Zumindest nicht bei einfachen Leuten. Siddiqui, Sohn eines Memet, hieß einfach Siddiqui M.. Hieß Memets Vater, also Siddiquis Großvater, Khalid, so kann der Name Siddiqui noch um das K. erweitert werden, also auf Siddiqui M.K..
Zunächst hatte Ahmed spontan Siddiqui in das Auto des Generals einladen wollen, aber dann fiel ihm ein, dass die Israelis das Gespräch würden abhören können. Das hätte ihn nicht wirklich gestört, im Gegenteil, es hätte ihnen gezeigt, wie engagiert er arbeitete. Aber es hätte ihnen ein weiteres Tondokument in die Hände gespielt und damit einen Beweis, den sie gegen ihn würden verwenden können.
Ahmed schlug vor, im Auto des Admirals noch ein wenig zu schwatzen.
Hätte Ahmed geahnt, dass sich heute eine solche Gelegenheit bieten würde, er hätte den kleinen Sender eingesteckt, den seine Auftraggeber ihm gegeben hatten, um ihn im Auto des Admirals anzubringen. Aber der Sender lag gut versteckt in Ahmeds Behausung.
Immerhin konnte er jedoch weitere Treffen mit Siddiqui verabreden. Das ging leicht. Ahmed brauchte nur zu fragen, zu welchen Veranstaltungen Siddiqui würde Admiral Zaif fahren müssen, um festzustellen, dass an diesen der General Faisal ebenfalls teilnehmen würde. Dies waren, Allah sei Dank, zwei innerhalb der nächsten vierzehn Tage.
Nachdem sie eine Weile geplaudert hatten, war Ahmed Falouf zum Wagen des Generals zurück geschlendert und hatte gewartet, aufgerufen zu werden, um den General am Portal der Residenz einzusammeln. Ahmed Faloufs Laune hatte sich gebessert. Immerhin hatte er jetzt einen Grund, von seinen Auftraggebern einen Geldbetrag verlangen zu können. Und sei es nur, um Mittel zu haben, Siddiqui in eine Teestube oder zu einem Imbiss einzuladen. Noch besser wäre es, wenn er sagen könnte, Siddiqui gegen Geld zur Zusammenarbeit verpflichtet zu haben.
Auf alle Fälle hatte Ahmed Falouf wieder eine Perspektive, seine Einkünfte aufzubessern.
Ezrah Goldstein, Moishe Shaked und Itzak Salomonowitz saßen um das Tonbandgerät, das auf dem Arbeitstisch in Goldsteins Büro aufgebaut war. Alle drei hatten eine Abschrift der Unterhaltung zwischen Rupert Graf und Norbert Schmehling vor sich, ebenso eine wortgetreue Übersetzung ins Hebräische. Die Deutschkenntnisse von Shaked und Salomonowitz waren nicht so perfekt wie die von Goldstein, aber über ihre Kenntnis des Jiddischen waren sie in der Lage, der Unterhaltung zu folgen.
Dass Schmehling angesichts seiner zahlreichen Geschäftskontakte in den arabischen Raum nicht unbedingt ein Freund und Unterstützer Israels sein würde, war ihnen bewusst. Wie wenig er Israel mochte, war ihnen spätestens bei der Lektüre des Gesprächsprotokolls klar!
Über die Korrespondenz aus Grafs Büro wussten sie zudem, dass Schmehling eine wichtige Rolle bei der Erlangung der Exportgenehmigungen spielte. Ein Grund mehr, den Kerl nicht zu mögen!
In der Unterhaltung zwischen Schmehling und Graf, mitgeschnitten zu nächtlicher Stunde in Monaco, gab es zwei Punkte von besonderem Interesse:
Die Überlegungen, wozu Saudi Arabien die U-Boote brauchte, und warum unbedingt ein Boot so zeitig verfügbar sein sollte.
„Spiel noch mal zu der Stelle, wo Graf nach dem Zweck fragt!“ bat Salomonowitz. Nach wenigen Augenblicken hatte Goldstein das Band auf die Zahl zurück laufen lassen, die auf dem Protokoll neben diesem Teil der Unterhaltung stand.
In dem Teil zuvor hatten sich Graf und Schmehling darüber ausgelassen, dass der Kauf der Boote wirtschaftlich interessant war, mit finanziellen Vorteilen für die deutsche Industrie.
Grafs Stimme kam überraschend klar aus dem Lautsprecher. Die Techniker des Dienstes hatten sämtliche Nebengeräusche aus der Bar des Hotel de Paris weg gefiltert.
„Militärisch ist das ganze ziemlicher Unfug. Was wollen die mit diesen Dingern?“
Schmehling: „Ihre Küsten schützen.“
Graf: „Quatsch! Die Boote haben eine so geringe Reichweite, die sind für Patrouillenfahrten völlig ungeeignet. So was schafft man an, um von einem Mutterschiff aus heimlich in einen Hafen einzudringen, oder sich vor eine Hafeneinfahrt zu legen, um Schaden anzurichten. Das sind reine Angriffswaffen!“ Hier hörte es sich so an, als würde er grinsen: „Auch wenn wir in unseren Exportanträgen selbstverständlich den defensiven Charakter der Boote besonders herausgestrichen haben.“
„Iran?“ hörten sie Schmehling fragen. „Da kommen die doch hin und wieder zurück.“
Graf: „Was meinen Sie?“
Schmehling: „Na. Iranische Ölverladeanlagen. Bohrtürme offshore. Diese verdammten Inseln, um die sich der halbe Golf seit Jahrzehnten kabbelt. Da könnten die Saudis die Produktion auf Jahre hinaus lahm legen. Keine Öleinnahmen mehr für den Iran. Kein Geld für Rüstung. Kein Geld mehr für die iranische Atomforschung. Und keiner weiß, wer´s war. Ich schließe nicht mal aus, dass die Amerikaner die Saudis dazu ermutigen. Oder die Israelis, über den Umweg USA. Das wäre typisch für die!“
Graf: „Trauen Sie den Saudis das zu?“
Schmehling: „Offen gestanden nicht! Ich denke eher, die wollen so was haben, weil andere in ihrer Nachbarschaft auch so was haben oder anschaffen wollen.“
Graf: „Da hat keiner U-Boote. Nur der Iran. Boote aus der damaligen UdSSR. Kilo Klasse. Mehr als dreißig Jahre alte Technologie!“
Schmehling: „Es wird gemunkelt, die Iraner hätten auch Mini-U-Boote.“
Graf: „Ja, aber das sind Boote für zwei Mann Besatzung. Wie die Malialis der Italiener im zweiten Weltkrieg. Bemannte Torpedos.“
Schmehling: „Israel? Können die was in Israel planen?“
Graf: „Klar. Sie können in den Golf von Akaba eindringen und Eilath angreifen. Da kämen sie von Jeddah aus hin und zurück. Aber Eilath sollte so gesichert sein, dass keiner rein und raus kommt, der da nicht hingehört. Ich nehme an, da gibt es mehr Sonare als Korallen. Die Saudis könnten auch ein Boot auf ein Mutterschiff laden und bringen, wohin sie wollen. Auch, unmittelbar vor Haifa.“
Schmehling: „Das hätten die Kerle verdient!“
Graf: „Das passt aber nicht zu den Saudis. Die haben noch nie irgendwo den Angreifer gespielt! Waffen hätten die doch genug! Außerdem hätten wir mitgekriegt, wenn die sich ein Mutterschiff beschafften. Selbst wenn sie einen alten Tanker umbauten, so dass das U-Boot unter Wasser wie aus einem Dock herausfahren könnte, hätte sich das in der Branche herumgesprochen. Nein, das Einzige, was Sinn macht ist, wenn die Saudis die Boote haben wollen, um eine U-Bootswaffe aufzubauen. Zu Trainingszwecken.“
Schmehling: „Aber daran glauben Sie nicht?“
Graf: „Nein, nicht so richtig. Dann würden sie nicht dermaßen viel Theater gemacht haben, das erste Boot in zwei Jahren zu haben. Die anderen kommen schließlich erst zweieinhalb Jahre später, und dann in Abständen von neun Monaten.“
Schmehling: „Also glauben Sie, etwas steckt dahinter?“
Graf: „Ja klar!“
Hier endete dieser Teil der Unterhaltung. Es folgte das Füllen der Gläser durch einen Kellner sowie zehnminütiges Geplauder über die anderen Gäste und darüber, wie sehr sich Grafs Gefährtin zu amüsieren schien.
Sie spulten das Band weiter bis zu der Stelle, an der Schmehling fragte:
„Warum kann überhaupt jemand ein Kriegsschiff zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wollen? Bei Bauzeiten von mehreren Jahren? So lange plant doch keiner einen Angriff im Voraus!“
Graf: „Ich habe das bisher nur erlebt, wenn lang absehbare Festivitäten anstehen. Was weiß ich, der Jahrestag von irgendwas. Einer längst vergessenen Seeschlacht. Staatsjubiläum. Gründung der Marine. Zumeist verbunden mit einer Parade auf See. Alle Honoratioren am Ufer, mit Ferngläsern. Die Dampfer fahren vorbei und tuten, und alle winken wie verrückt!“
Sie übersprangen die folgende Anekdote Grafs über eine südamerikanische Marine, die zu solcher Gelegenheit halbfertige Schiffe mittels unter der Wasseroberfläche gespannter Trossen von vorausfahrenden Schiffen an den Zuschauern vorbei schleppen ließ und mit in den Kaminen entzündeten Holzfeuern den Eindruck erweckte, die Schiffe führen aus eigener Kraft.
Schmehling: „Aber etwas stört Sie?“
Graf: „Ja. Bei so einer Parade würde man nicht ein U-Boot mitfahren lassen, das kaum aus dem Wasser guckt. Und schon gar nicht einen Winzling wie die Saudis ihn bekommen. Der ist vom Ufer aus nicht zu sehen!“
Schmehling: „Also schließen Sie das aus?“
Graf: „Nein. Man kann nichts ausschließen. Vielleicht feiert der Marinechef einen runden Geburtstag, und der Minister will ihm eine Freude machen. Oder umgekehrt. Aber genauso gut kann es sein, dass ein Experte daran bastelt, zu einem bestimmten Datum einen Schlag auszuführen. Denken Sie bloß an die Idioten der Baader-Meinhof-Bande damals bei uns in Deutschland. Die suchten sich immer Jahrestage, die ausschließlich für sie selbst Symbolcharakter hatten! Aber letztlich ist das nicht mein Problem. Das Problem, das ich habe ist, die Lieferzeit einzuhalten. Insofern wäre ich nachgerade froh, wenn die Saudis es nicht schafften, alle Vorbedingungen zum Inkrafttreten des Vertrages zu erfüllen. Dann wäre ich aus dem Schneider!“
Hier knipsten sie das Band aus. Sie wussten, jetzt folgte der maulige Protest Schmehlings, der seine ersten Provisionszahlungen erst nach Inkrafttreten der Verträge erhalten würde.
„Was haltet ihr davon?“ fragte Ezrah Goldstein.
„Graf hat recht. Da ist was faul,“ antwortete Salomonowitz. „Interessant, dass er sich Gedanken macht.“
„Der Arsch hat nur Angst um seine Reputation. Wir wissen aus einem anderen Gesprächsmitschnitt, er befürchtet, die Saudis würden mit unzureichend ausgebildeten Mannschaften in See stechen und das Boot verlieren. Dann gibt alle Welt ihm die Schuld!“
„Können wir ausschließen, dass eine unserer Organisationen dahintersteckt, oder die CIA?“ fragte Salomonowitz.
„Dann hätte ich wohl davon gehört,“ antwortete Goldstein ohne Überzeugung.
Sie alle wussten, dass es in jedem Geheimdienst der Welt immer wieder Aktionen gab, die so geheim waren, dass Mitarbeiter der verschiedenen Ebenen aneinander vorbei arbeiteten.
„Also, wenn da was liefe Richtung Iran, das wüssten wir doch wohl!“
„Naja….,“ sagte Goldstein. „Ich höre mich mal um. Trotzdem, ich glaube eher, das ist eine saudische Sache. Moishe, kriegen wir aus deinen saudischen Quellen was raus? Da haben wir doch Leute? Können wir die gezielt darauf ansetzen?“
Moishe Shaked wiegte den Kopf.
„Wenn die Saudis wirklich einen Schlag planen sollten, kann das nur im allerengsten Kreis sein. Unterhalb der Führungsebene, sprich, unterhalb des Königshauses. Ich lasse mal die Datenbanken durchforsten, was es an Jubiläen und Gedenktagen geben könnte. Müsste ja etwas sein, das ab heute gerechnet in frühestens zwei bis drei Jahren eintritt. Das wird ´ne Scheißarbeit! Kann schließlich auch was sein, was der Koran hergibt. Unsere Experten werden sich freuen!“
Hakeem bin Zaif hatte als Familienangehöriger eines hohen Militärs Zugang zum Offiziersklub in Riad. In dieser Anlage in der Nähe des Zentrums der Hauptstadt, durch hohe Mauern vor Blicken Neugieriger geschützt, gibt es rund um einen Fußballplatz angeordnete Gebäude, in denen Sporteinrichtungen und Restaurants untergebracht sind. Die Angebote reichen von Billard über Kegelbahnen bis hin zu Fitnesszentren und leichtathletischen Einrichtungen. Es gibt ein eigenes Gebäude, fensterlos, in dem sich die Ehefrauen und Töchter aufhalten und von den Männern unbeobachtet sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten nachgehen können.
In den Restaurants des Klubs treffen sich die Angehörigen der Streitkräfte, wo sie nach der Einnahme der Mahlzeiten zusammen sitzen, Wasserpfeife rauchen und Tee oder Softdrinks trinken.
Hakeem kannte viele der Besucher, insbesondere die Angehörigen der Marine.
Gerade zu den jüngeren Offizieren hatte er ein freundschaftliches Verhältnis, weil sein Vater es liebte, seine Zöglinge auch nach Hause einzuladen, um dort mit ihnen zu diskutieren. Manche der jungen Männer waren nur wenig älter als Hakeem selbst.
Als Hakeem nach einem Tennismatch die Bar betrat, an der ausschließlich alkoholfreie Erfrischungsgetränke ausgeschenkt wurden, erkannte er in einer Gruppe von jungen Männern einen der direkten Mitarbeiter seines Vaters, Khalid.
Khalid bin Abdul stammte aus einer Ortschaft im Norden des Landes, einem Dorf, das auf keiner Landkarte verzeichnet war. Khalids Vater, Abdul bin Abdul, war der Stammesführer dort, und da die einzelnen Stämme sehr stolz auf ihre Tradition und die Unterwerfung anderer Stämme waren, gab es Bemühungen innerhalb der Marine, zumindest Teile der Schiffsmannschaften aus demselben Stamm zu rekrutieren, um Fälle von Insubordination soweit wie möglich zu unterbinden. Befehlen von Khalid würden alle Mannschaftsmitglieder aus Khalids Stamm sofort und ohne zu überlegen folgen. Würde jedoch ein Befehl von einem ranghöheren Offizier als Khalid erteilt, dessen Stamm die Soldaten jedoch als niedriger ansahen als den eigenen, so konnte es durchaus zu Befehlsverweigerungen kommen. Insofern, so wusste Hakeem, war Leutnant Khalid trotz seines bescheidenen militärischen Ranges als Sohn eines Stammesführers einer der wichtigeren Männer in der Marine, dem eine steile Karriere bevorstand.
Als Hakeem sich der Gruppe näherte, verstummte das Gespräch. Hakeem als Sohn eines Admirals war diese Reaktion gewohnt. Auch wenn er der Jüngste in der Runde war, wurde er als Sohn des höchsten Vorgesetzten mit größtmöglichem Respekt behandelt.
„Was feiert ihr?“ fragte er so unbefangen wie möglich.
„Khalid ist dank Allah eine große Ehre zuteil geworden,“ rief einer aus der Gruppe. „Er ist ausgewählt worden, der Chef der neuen U-Bootswaffe zu werden!“
„Die Marine hat doch gar keine U-Boote,“ sagte Hakeem.
„Sie wird welche bekommen!“ antwortete der Sprecher. „Khalid wird nach Europa gehen, um den Bau der Boote zu überwachen. Er wird dort ausgebildet werden. Und er wird, so Allah will, der erste Kommandant eines U-Bootes der Saudischen Marine. Welche Ehre!“
Khalid saß mitten in der Runde. Sein Gesicht glänzte vor Stolz.
„Ist denn der Kauf schon beschlossen?“ fragte Hakeem. Sein Vater hätte bestimmt zuhause etwas darüber erzählt.
„Es gibt sehr wichtige Befürworter,“ sagte ein anderer aus der Gruppe. „Direkt aus der Königsfamilie.“
„Und wer soll die Boote liefern?“ fragte Hakeem. „Soweit ich von meinem Vater weiß, ist noch nicht einmal eine Anfrage herausgegangen.“
„Es kommen vier Länder in Frage. Italien, Frankreich, die Niederlande und Deutschland. In eines dieser Länder wird Khalid gehen. Hat er nicht, Allah sei gepriesen, unglaubliches Glück?!“
Hakeem bin Zaif klopfte Khalid lachend auf die Schulter. Tatsächlich jedoch wollte er so schnell wie möglich fort von hier. Sobald es die Höflichkeit zuließ, verabschiedete er sich aus der Gruppe und eilte unter die Dusche.
Nicht einmal eine Stunde später saß er zusammen mit Imam Hadschi Omar und berichtete ihm, was er erfahren hatte.
Der Imam hörte ihm zu, ohne ihn zu unterbrechen.
Trotzdem schien Hadschi Omar es plötzlich eilig zu haben, Hakeem loszuwerden.
„Herr Graf, kann ich Sie bitte kurz sprechen?“ fragte der Sicherheitsexperte der DRRS, Peter Vogel, der vorsichtig an Grafs Bürotür geklopft hatte. Die Sekretärin, Frau Orlowski, war im Haus unterwegs und Grafs Vorzimmer nicht besetzt.
„Kommen Sie rein! Was gibt´s?“
„Ein Problem, Herr Graf. Wir wissen jetzt, Ihr PC und der Ihrer Sekretärin sind angezapft. Nur diese beiden. Keiner der PCs Ihrer Mitarbeiter.“
„Und was heißt das genau, Herr Vogel?“
„Dass jemand Ihre Korrespondenz mitlesen konnte. Alles, was Frau Orlowski an Briefen und Mitteilungen geschrieben hat. Alles, was Sie in Ihren PC eingegeben haben. Und natürlich Ihre gesamte elektronische Eingangspost!“
„Können Sie feststellen, seit wann?“ fragte Graf.
„Seit rund einem Vierteljahr.“
„Nicht länger?“
„Nein. Wir vermuten, dass es zu dem Zeitpunkt angefangen hat, als wir im ganzen Haus Computerproblem hatten und Softwareveränderungen haben aufspielen lassen müssen. Da hat Ihnen jemand einen Virus eingepflanzt!“
„Dann müsste man doch herausfinden könne, wer sich an unseren PCs zu schaffen gemacht hat. Das ist doch sicherlich protokolliert worden!“
„Ja ja, Herr Graf. Da sind wir auch bei. Nur, diese Checks werden durch Fremdfirmen durchgeführt. Die haben eine hohe Mitarbeiterfluktuation. Diese Computerfreaks halten es nirgends lange aus. Die sind in der Branche unterwegs wie die Zigeuner.“
„Werden Sie den Virus wieder los?“
„Er ist bereits neutralisiert, Herr Graf. Es besteht ab sofort kein Grund mehr zur Sorge. Sie und Frau Orlowski erhalten völlig neue PCs.“
„Das sagen Sie, Herr Vogel! Ich fürchte, ich muss jetzt erst mal den gesamten Schriftverkehr des letzten halben Jahres durchsehen, um zu gucken, was da an Sensitivem dabei war! Schöne Scheiße! Was ist mit meinem Büro in Bremen?“
„Kein Problem. Nur hier!“
„Bitte untersuchen Sie die Büros hier und in Bremen auf Wanzen! Und meine Wohnungen! Und, Herr Vogel, so schnell wie möglich!“
Rupert Graf lehnte sich in seinem Sessel zurück, um nachzudenken. Nachzudenken darüber, was er in den vergangenen Monaten geschrieben, diktiert oder gesagt haben könnte, was eines der zur Zeit von ihm verfolgten Projekte gefährden konnte. Und was ihm geschrieben worden war.
Eine Menge! Jede Menge!
Rupert Graf geriet ins grübeln. Er arbeitete zur Zeit an Projekten in Argentinien, Nigeria, Brunei. Das waren die heißesten! Natürlich gab es noch eine Reihe anderer Vorhaben, aber die waren noch weit weg.
Und Saudi Arabien!
Graf beauftragte zwei seiner Mitarbeiter damit, alles an Korrespondenz auszudrucken und zu sortieren, was in den vergangenen 6 Monaten zu den einzelnen Projekten erhalten oder verschickt worden war.
Dass seine Wettbewerber mit Hilfe ihrer staatlichen Stellen hinter ihm sein würden wie der Teufel hinter der armen Seele, war ihm in einem immer kleiner werdenden Markt absolut bewusst! Was Rupert Graf als so ungerecht empfand war, dass die einschlägigen deutschen Dienste ihre Industrie bei weitem nicht so unterstützten wie es die Dienste der Wettbewerbsländer taten! Die deutschen Stellen interessierte es nicht, wenn Industriespionage betrieben wurde. Die kamen auch im Traum nicht auf die Idee, Sachverhalte, von denen sie Kenntnis erhielten, an die deutsche Wirtschaft weiterzugeben. Die würden eher die gewonnenen Erkenntnisse dazu benutzen, der Industrie des eigenen Landes noch Steine in den Weg zu räumen!
Rupert Graf hatte es längst aufgegeben, darüber zu sinnieren, weshalb Mitarbeiter deutscher Behörden die Industrie, die mit ihrem Steueraufkommen und dem ihrer Mitarbeiter immerhin einen Großteil der Beamtengehälter finanzierte, diese Industrie lieber behinderte als sie zu unterstützen.
Kopfschüttelnd machte er sich an die Sichtung der ihm vorgelegten Unterlagen.
Als Sabine Sadler den Hörsaal verließ und ihr Mobilphon anknipste, wurde sie von ihrer Mailbox auf eingegangene Nachrichten hingewiesen:
Einer der Anrufe war von Simone Martins:
„Glückwunsch! Du bist in der Bunten!“
Sie rief Simone an.
„Du bist in der Bunten!“ krähte Simone fröhlich. „In der Bunten Illustrierten!“
Simone klang ganz hingerissen davon, jemanden zu kennen, der dort Erwähnung fand.
Sabine Sadler zählte nicht zu den regelmäßigen Leserinnen dieses Blattes, das sich auf flache Klatschberichte über die sogenannten Prominenz stützte. Sie fand das Blatt eher eklig! Trotzdem war sie neugierig.
„Ja wie? Werde ich irgendwie erwähnt?“
„Nein, so richtig mit Photo! Musst du dir unbedingt angucken!“
Der nächste Kiosk, von dem Sabine Sadler wusste, war im Erdgeschoss des Hauptgebäudes der Klinik. Sie angelte sich aus dem Zeitungsständer ein Exemplar der Illustrierten und blätterte es mit spitzen Fingern hastig durch.
Sie fand kein Bild von sich.
„Frolleinchen, entweder kaufen Sie die Zeitung oder Sie legen sie zurück! Wir sind hier kein Lesesaal!“ sagte die Dame hinter dem Verkaufsstand.
Mit Widerwillen zahlte Sabine Sadler für das Blatt und zog sich in eine Ecke der Cafeteria des Krankenhauses zurück.
Das Bild war auf einer der letzten Seiten.
Es war kein großes Bild, und es war nur eines von mehreren auf dieser Seite. Trotzdem, Sabine Sadler war nicht zu verkennen. Sie stand mitten im intimen Kreis monegassischer Prominenz: Der Prinzessin, deren Gemahls, einer höchst bekannten Schauspielerin und eines steinalten Rockstars, die alle ihr zuprosteten. Und sie selbst mittendrin! Lächelnd, mit einem Glas Champagner in der Hand.
Und darunter gedruckt ein schwülstiger Kommentar über die schöne Unbekannte, die entweder dem Mitglied des Fürstenhauses oder dem Musiker ihr huldvolles Lächeln schenkte. Man würde sehen, wem von den beiden diese Dame ihre Gunst gewähren würde.
In diesem Moment klingelte ihr Handy.
Als sie das Gespräch annahm, hörte sie die zornige Stimme ihres Vaters in ihrer Mailbox:
„Ich lese ja nicht die verdammten Zeitungen, die der Lesezirkel in mein Wartezimmer legt. Trotzdem bin ich gespannt auf deine Erklärung, wie ein Bild von dir, aufgenommen zu einer Zeit, zu der deine Mutter und ich überzeugt waren, du seist in Düsseldorf, in eines dieser Scheißblätter geraten ist!“
Hakeem bin Zaif hatte sich während des Morgengebetes nicht auf die Koranverse konzentrieren können, die der Muezzin vom Minarett der nahe gelegenen Moschee rief. Lautsprecher verzerrten die Töne und die Stimme des Mannes. Das wäre an und für sich kein Problem gewesen. Hakeem kannte die Verse des Morgengebetes ohnehin auswendig.
Was Hakeems Gedanken abschweifen ließ, war die im Club geführte Unterhaltung.
Die Marine würde U-Boote beschaffen.
Khalid würde nach Europa gehen.
Er selbst hatte zwar beschlossen, in Deutschland ein Studium zu beginnen, aber das konnte er genauso gut in einem der anderen Länder aufnehmen, die als Lieferanten in Frage kamen.
Hakeem wusste, dass sein Vater ihm keine Steine in den Weg legen würde, wenn er den Wunsch äußerte, in dem Land zu studieren, in dem die Boote gebaut würden. Im Gegenteil, sein Vater würde eher froh darüber sein, weil ihm dies Gelegenheit gab, auf Dienstreisen, die sicherlich regelmäßig stattfanden, seinen Sohn zu besuchen.
Trotz seines Wohlstandes war sein Vater nicht gerade großzügig im Umgang mit Geld.
Wie hatte Hadschi Omar gesagt?
„Sieh zu, dass du in der Nähe sein kannst! Damit kannst du Allah am besten dienen.“
Hakeem hatte die halbe Nacht darüber nachgegrübelt, was der Imam gemeint haben mochte.
Er wollte so gern einen Beitrag dazu leisten, die Ungläubigen von den Heiligen Stätten zu vertreiben. Einen Beitrag, dass alle gläubigen Muslims ungehinderten Zugang zum Felsendom in Jerusalem erhielten, die Steine anbeten konnten, auf denen einst Ibrahim seinen Sohn Isaac hatte opfern wollen und auf denen der Prophet Mohammed auf seinem nächtlichen Ritt gen Himmel Rast gemacht hatte!
Hakeem bin Zaif war zutiefst erfüllt von dem Wunsch, Allah zu dienen. Er war bereit, sich zu opfern. Zum Lobe Allahs! Hakeem dachte nicht so sehr an die Huris, die seinen Aufenthalt im Paradies verschönern würden. Das wäre selbstsüchtig gewesen, und der Koran verbot Selbstsucht! Aber Hakeem bin Zaif war sicher, Allah würde ihm seine Hingabe belohnen.
Hakeem bin Zaif interessierte sich plötzlich sehr für die Probleme, die der Beruf seines Vaters aufwarf.
Admiral Zaif, stolz und erfreut über dieses Interesse, wurde nicht müde, seinem Sohn die taktischen Möglichkeiten der verschiedenen Schiffstypen, über welche die Marine des Königreiches verfügte, zu beschreiben. Zaif beschrieb aber auch die Schwierigkeiten, die es bereitete, eine reibungslose Kommunikation der eigenen Schiffe mit den Einheiten der US-Navy sicherzustellen, die im Arabischen Golf operierten. Wie Zaif nachdenklich, aber auch begeistert berichtete, ging es hierbei nicht darum, dass die Kommandanten nicht in der Lage wären, miteinander über Funk zu sprechen. Es ging um das Empfangen und Verwerten von Signalen, die von den Schiffen und deren Hubschraubern aufgefangen wurden, um die Steuerung von Raketen, die von einem Schiff abgefeuert wurden und von einem anderen Schiff in ihr Ziel gesteuert werden sollten.
„Du musst dir vorstellen, Hakeem, die Radaranlagen eines einzigen Schiffes reichen aus, um den An- und Abflugverkehr eines großen Flughafens zu kontrollieren. Alles, was sich in einem Umkreis von einhundertfünfzig, zweihundert Kilometern in der Luft befindet, wird, so Allah will, erkannt und analysiert. Verkehrsflugzeuge haben eine Freund-Feind-Erkennung. Das Verkehrsflugzeug sendet unablässig Signale aus, die es als solches erkennen lassen. Gerade in Krisengebieten ist das von größter Wichtigkeit. Es gab den Vorfall mit der USS Vincennes.“
Hakeem zuckte mit den Schultern.
„Damals warst du noch nicht geboren! Im Juni 1988 startete ein Airbus der Iranian Airways in Bandar Abbas zum Überflug über den Golf. Die Freund-Feind-Erkennung war, wie man mit Allahs Hilfe später herausfand, nicht eingeschaltet. Die Systeme an Bord der amerikanischen Fregatte Vincennes erkannten lediglich, dass ein Flugzeug auf sie zukam. Da sich dieses Flugzeug nicht als Verkehrsmaschine identifizierte, war es für die Computer an Bord der Fregatte automatisch als Feind eingestuft. Innerhalb weniger Sekunden musste reagiert werden. Die Computer haben reagiert. Ohne dass irgendjemand an Bord des Schiffes hätte eingreifen können, setzten die Computer der Vincennes eine Rakete in Gang, die das Flugzeug vom Himmel holte. Zweihundertneunzig Menschen starben. Allah sei ihren Seelen gnädig!“
Admiral Zaif nahm einen Schluck aus seinem Teeglas.
„Wir haben damals, Allah sei Dank, viel Glück gehabt. Eine unserer Fregatten war näher unter der iranischen Küste positioniert. Hätten alle Systeme richtig kommuniziert, wäre die Rakete von unserem Schiff abgefeuert worden, obwohl die amerikanische Fregatte das Flugzeug eher erkannt hatte. Ohne dass jemand an Bord unseres Schiffes geahnt hätte, warum, wäre eine Rakete abgefeuert worden!“
„Und wieso hat das damals nicht funktioniert?“ wollte Hakeem wissen.
„Kompatibilitätsprobleme. Unsere Computer, zusammengestellt in Frankreich, haben nicht auf die Signale der amerikanischen Computer reagiert. Es war Allahs Wille, Allah sei Dank!“
„Wieso?“
„Kannst du dir vorstellen, wie der Iran reagiert hätte?! Beinahe dreihundert Menschen abgeschossen von einem Volk, dass sie als ihre Vettern betrachten? Eine Katastrophe wäre das gewesen!“
„Und heute funktioniert das?“
„Erheblich besser als damals, aber immer noch nicht völlig reibungslos. Es wurde eine Menge Arbeit und Geld investiert, um das zu erreichen. Aber es geht ja nicht nur um das, was am Himmel herumfliegt. Hunderte von Schiffen, die im Golf herumkreuzen, müssen identifiziert werden. Tanker, Frachter, aber auch Kriegsschiffe.“
„Und wie geht das?“
„Tanker und Frachter sind aufgrund ihrer großen Radarsilhouette relativ einfach zu erkennen. Schwieriger ist das mit den Kriegsschiffen. Bei deren Bau wird großen Wert darauf gelegt, die Radarsilhouette so klein wie möglich zu halten. Ein modernes Marineschiff hat eine Radarabstrahlung, die nicht größer ist als die eines Fischkutters.“
„Und wie erkennt man die trotzdem?“
„Hierzu ist eine Vielzahl von Daten notwendig. Infrarot. Die Infrarotabstrahlung ist anders als die eines Handelsschiffes. Von den Marineschiffen aus operierende Hubschrauber machen Überwachungsflüge und melden die gesammelten Daten an ihre Schiffe. Die Amerikaner überwachen außerdem den Golf mit Satelliten.“
Wieder nahm Zaif einen Schluck Tee.
„Das heißt, die Amerikaner wissen um jedes Flugzeug und jedes Schiff, das im Golf unterwegs ist?“ fragte Hakeem.
Zaif nickte bedächtig. „So ziemlich.“
„Und im Roten Meer?“
Zaif nickte wieder.
„Und wir, ich meine, unsere Streitkräfte, wissen die das auch?“
„Nicht immer,“ gab Zaif nach einer längeren Pause zu.
„Aber das sind doch unsere Gewässer!“ rief Hakeem aufgeregt. „Das ist doch praktisch vor unserer eigenen Haustür! Wieso wissen wir das nicht?“
„Die amerikanischen Systeme sind besser als unsere. Umfassender. Sie haben andere, bessere Möglichkeiten als wir.“
„Aber sie teilen ihre Erkenntnisse doch mit uns!“
„Leider nicht alle. Sie sagen uns nur das, von dem sie glauben, dass es ihnen nützt.“
„Wieso?“
„Sie trauen uns nicht. Sie wissen, dass sie nicht beliebt sind in unserem Land. Sie halten uns für unzuverlässig und für unfähig. Sie schauen auf uns herab.“
„Aber wenn die Computer untereinander kommunizieren können, dann müsstet ihr doch der Lage sein, an die den Amerikanern zugänglichen Informationen zu kommen.“ Hakeem war jetzt wirklich aufgeregt.
„Sie filtern bestimmte Informationen vorher heraus.“
„Was ist mit dem, was unter Wasser stattfindet?“
Admiral Zaif sah seinen Sohn fragend an.
„Ich habe bei dem Essen mit General Faisal und Admiral Abdallah zugehört. Du hast davon gesprochen, dass die Königliche Marine unbedingt eine Unterwasserkomponente benötigt.“
Zaif blickte voller Stolz auf seinen Sohn.
„Von dem, was sich unter Wasser abspielt, haben wir so gut wie keine Ahnung, mein Sohn. Klar, unsere Fregatten verfügen über Sonargeräte, wir können auch von Hubschraubern aus Sonarbojen abwerfen und die empfangenen Signale, so Allah es will, hören und analysieren. Aber, damit eine Fregatte Sonargeräusche empfangen kann, muss sie selbst ruhig im Wasser liegen oder doch zumindest ganz langsam fahren. Sonst sind die Eigengeräusche zu hoch, um etwas zu hören. Die Sonarbojen schwimmen an der Oberfläche. Auch hier sind die Geräusche sich brechender Wellen zu stark, als dass man auf größere Entfernung etwas hören könnte, es sei denn, ein U-Boot befindet sich in unmittelbarer Nähe.“
„Und wieso ist dann ein U-Boot besser?“ fragte Hakeem.
„Du musst dir das vorstellen, wie wenn du in einer Badewanne liegst und den Kopf über Wasser hältst. Wenn du dann den Verschluss deiner Badegelflasche ins Wasser fallen lässt, hörst du den Aufschlag auf das Wasser und auch, wenn der Deckel auf den Wannenboden fällt. Wenn du gleichzeitig mit einer Hand im Wasser rührst, hörst du so gut wie nichts. Machst du jedoch den gleichen Versuch mit den Ohren unter Wasser, hörst du sehr genau, wie der Deckel am Boden aufschlägt. Der Schall trägt unter Wasser viel besser.“
Hakeem beschloss, dieses Experiment noch am selben Abend zu machen.
„Und die Amerikaner? Haben die U-Boote im Golf?“
„Wahrscheinlich,“ gab Zaif lakonisch zur Antwort.
„Ihr wisst es nicht?“ fragte Hakeem ungläubig.
„Nicht genau. Manchmal, während gemeinsamer Übungen, erhalten wir Daten darüber. Manchmal.“
„Würdet ihr mit eigenen U-Booten die amerikanischen Boote entdecken können?“
„Auf alle Fälle!“ Zaif klang auf einmal sehr überzeugt. „Die amerikanischen U-Boote haben einen Atomreaktor an Bord, der ihnen die notwendige Energie liefert. Solch ein Reaktor ist laut. Nicht so laut wie ein Automotor, aber doch laut genug, um erkannt zu werden. Dieselelektrische Boote sind nahezu geräuschlos, wenn sie mit Batteriestrom fahren.“
„Das heißt, mit eigenen U-Booten könntet ihr genau hören, wer unter Wasser und an der Oberfläche herumfährt?“ fragte Hakeem.
Zaif nickte. „Auf große Entfernung!“
„Und dann?“
„Dann können wir, wenn wir wollen, ihn mit Allahs Hilfe versenken.“
„Wie?“
„Mit Torpedos. Dazu müssen wir nicht einmal mehr auftauchen. Wir lenken den Torpedo aus beliebiger Wassertiefe geradewegs zu seinem Ziel.“
„Wie tief kann so ein Boot tauchen?“
„Die Operationstauchtiefe liegt je nach Typ bei dreihundert, dreihundertfünfzig Metern. Die Kollapstiefe beträgt normalerweise das Doppelte.“
„Kollapstiefe?“ fragte Hakeem. „Was ist das denn?“
„Die Tiefe, bei der das Boot zerbirst. Mit jedem Meter Tiefe nimmt der Druck des Wassers auf die Bootshülle zu. Irgendwann kann es dem Druck nicht mehr standhalten.“
„Und die Besatzungen?“
„Gehen ein ins Paradies. Allah in Seiner Gnade schenkt ihnen einen schnellen Tod.“
Beide waren still. Eine ganze Weile lang. Hakeem versuchte, sich die Situation vorzustellen, in einem Boot, in das plötzlich Wasser einbrach und alles Leben an Bord zermalmte. Er selbst hatte nur mühsam schwimmen gelernt und bekam schon in einem Swimmingpool jedes Mal einen eisigen Schreck, wenn er den Boden nicht mehr mit den Zehenspitzen erreichen konnte.
„Sind denn dreihundert Meter Tauchtiefe ausreichend?“ fragte er schließlich.
Sein Vater lächelte.
„Allemal! Du musst dir vorstellen, dass der Feind ja nicht weiß, aus welcher Tiefe er beschossen worden ist. Er hat nur wenige Möglichkeiten. Er kann Wasserbomben werfen, die er auf eine bestimmte Tiefe einstellen muss. Aber auf welche? Das U-Boot kann dreißig, fünfzig, hundert, zweihundert Meter tief sein. Die Wasserbomben schaden nur, wenn sie dicht am Bootskörper explodieren. Hinzu kommt, dass der Kommandant des U-Bootes seine Position verändern kann. Er schleicht sich mit seinem Boot davon.“
„Und das kann man oben nicht hören?“
„Wenn er vorsichtig ist, nicht. Die Überwasserschiffe können lediglich versuchen, das Boot mit ihren Aktivsonaren zu orten.“
Hakeem sah seinen Vater fragend an.
„Sonargeräte, die Schallwellen aussenden. Wenn diese Wellen auf das U-Boot treffen, werden sie zurückgestrahlt und von dem Überwasserschiff aufgefangen. Dann wissen sie, wo sich das U-Boot befindet. Die Computer rechnen die Wassertiefe und die Position aus.“
„Also lässt sich das U-Boot doch finden!“ sagte Hakeem.
„In der Theorie schon. Tatsächlich ist es jedoch so, dass unterschiedliche Salzdichten und Wärmeschichten des Wassers den Sonarstrahl ablenken. Das U-Boot kann sich unter solchen besonders salzhaltigen Schichten geradewegs verstecken. Das ist, wie hinter einem Busch zu sitzen.“
„Und wie weiß man auf dem U-Boot, ob man eine solche Salzschicht in der Nähe hat?“
„Das wird automatisch gemessen.“
„Dann kann also ein U-Boot überhaupt nicht entdeckt werden?“
Zaif lachte laut auf.
„Das wäre schön, wenn es so einfach wäre! Doch, auch U-Boote können entdeckt werden! Von Flugzeugen aus, zum Beispiel. Zur U-Bootsortung werden Maschinen eingesetzt, die besonders langsam fliegen können. Sie messen magnetische Veränderungen, auch unter der Wasseroberfläche. Wenn sie etwas entdecken, was ihnen nicht normal erscheint, werfen sie eine Sonarboje ab, die nach unten lauscht.“
„Aber du hast doch gesagt, ein U-Boot ist nicht zu hören?“
„Wenn es sich langsam bewegt, nicht. Wenn es aber mit normaler Geschwindigkeit fährt, gibt der Propeller Geräusche ab, unglaublich leise zwar, aber doch hörbar. Dann gibt es die Satelliten. Die messen aus dem All die Oberfläche des Meeres. Wenn sich dort ein U-Boot befindet, ist der Meeresspiegel durch die Wasserverdrängung des Bootes geringfügig höher. So winzig diese Verdrängung auch ist, sie ist, so Allah will, messbar. Außerdem haben die Satelliten Infrarotsensoren. Ich hatte bereits den Reaktor an Bord von Atom-U-Booten erwähnt. Der Reaktor strahlt Hitze ab. Die ist messbar. Im Golf, der ja nicht besonders tief ist, kann man U-Boote bei Tageslicht vom Flugzeug aus oft schon mit bloßem Auge erkennen. Ein dunkler Schatten gegen den hellen Grund.“
„Dann wäre doch ein Boot im Golf hoffnungslos verloren?“ fragte Hakeem.
„Keineswegs. Nicht, wenn es sich um ein kleines Boot handelt. Es könnte sogar durch einen entsprechenden Anstrich weniger sichtbar gemacht werden. Ein kleines Boot sähe bestenfalls aus wie einer der vielen Felsbrocken am Meeresboden.“
Hakeem musste plötzlich grinsen.
„Deshalb hat du neulich General Faisal gesagt, dass du kleine U-Boote beschaffen willst!“
Auch Zaif lächelte breit.
„Ja sicher! Du weißt doch, wie man hier denkt. Von allem das Größte und das Beste. Aber das Größte ist eben nicht immer auch gleichzeitig das Beste. Als Infanterist würde Salman das nie verstehen. Der weiß nur, ein großer Panzer ist besser als ein kleiner, eine große Kanone kann weiter schießen als eine kleine! Ich musste ihn in eine andere Richtung locken.“
Hakeem grinste immer noch. Aber plötzlich wurde er wieder ernst.
„Und wenn so ein U-Boot doch entdeckt worden ist, dann ist es verloren?“ fragte er.
„Nein, mein Sohn. Nicht unbedingt. Man wird versuchen, es mit einem Torpedo abzuschießen. Der Torpedo, wenn er schnell läuft, kommt jedoch nicht lautlos. Der Kommandant an Bord des U-Bootes hört, wie der Torpedo sich nähert. Der Bordcomputer wird ausrechnen, aus welcher Entfernung der Torpedo abgefeuert wurde. Jetzt hat das U-Boot mehrere Möglichkeiten: Es versucht, so schnell wie möglich außerhalb der Reichweite des Torpedos zu gelangen. Das ist riskant, weil der Torpedo sich erheblich schneller bewegen kann als das U-Boot. Der Torpedo wird von dem abschießenden Boot aus über ein Glasfaserkabel gesteuert. Das verfolgte Boot muss als erstes versuchen, den Torpedo so weit vom abschießenden Boot wegzulocken, dass das Kabel reißt.“
„Warum?“
Dann muss der Torpedo sich sein Ziel selbst suchen. Nach verschiedenen Kriterien. Das erste ist das Propellergeräusch des U-Bootes. Je schneller das Boot fährt, desto lauter ist es. Sobald der Torpedo in der Nähe ist, beginnt er, selbst Schallwellen auszusenden, die, sobald sie das U-Boot treffen, zurückgestrahlt werden. Diese Schallwellen sind an Bord des U-Bootes hörbar. Es macht Ping Ping Ping. Je näher der Torpedo ist, desto schneller werden die Pings. Jetzt kann der Kommandant immer noch versuchen, durch schnelle Wendemanöver dem Torpedo auszuweichen, Manöver zur Seite, nach oben, nach unten. Gleichzeitig wird er jedoch eine Boje abstoßen, die ein lauteres Geräusch von sich gibt als der Propeller. Der Torpedo wird sich an diesem Geräusch orientieren und es verfolgen. Inzwischen macht sich das U-Boot davon.“
„Und der Torpedo schwimmt in die falsche Richtung!“ rief Hakeem begeistert.
„Leider ist es nicht ganz so einfach,“ antwortete Zaif. „Die Sensoren des Torpedos erkennen, dass sie getäuscht worden sind. Der Torpedo dreht einen Kreis und versucht, das Propellergeräusch des U-Bootes wiederzufinden. Außerdem ist der Torpedo so schlau, nicht ein zweites Mal auf die Geräuschboje hereinzufallen. Deren Geräuschsignatur kennt er jetzt.“
„Ein Torpedo kann doch nicht denken!“ sagte Hakeem im Brustton der Überzeugung.
„Da hast du recht. Aber sein Computer! Der hat den automatischen Befehl, das gleiche Geräusch nicht noch einmal zu verfolgen.“
„Dann beginnt die Jagd also aufs Neue?“ fragte Hakeem.
„Allerdings. Jetzt muss das U-Boot sich mucksmäuschenstill verhalten. Der Torpedo fährt im Kreis und sucht nach seinem Ziel. Er sucht ein Geräusch, und er sucht nach etwas, dass seine immer noch ausgesandten Pings zurückwirft. Findet er etwas, jagt er hinterher.“
„Und dann?“ Hakeems Spannung war nicht zu übersehen.
„Dann beginnt das Spiel von vorn. Wieder eine Geräuschboje, diesmal mit einer anderen Signatur. Wieder der Versuch, dem Torpedo zu entkommen!“
„Und wie lange geht das?“
„Der Torpedo hat nur eine bestimmte Reichweite. Ist seine Batterie leer, sinkt er auf den Meeresboden.“
Vater und Sohn sahen sich an. Hakeem war sichtbar beeindruckt. Zaif war stolz, sein Wissen weitergegeben zu haben.
„Ich habe gehört, die Marine wird U-Boote erhalten. Dann hast du dich also durchsetzen können?“
„Woher willst du das wissen?“ fragte sein Vater, plötzlich aufgeregt. „Diese Pläne sind äußerst geheim!“
„Leutnant Khalid soll der erste Kommandant werden. Es wurde im Offiziersclub darüber gesprochen.“
„Leider sind manche Leute schwatzhaft wie alte Weiber!“
„Ich würde gerne Kommandant eines U-Bootes werden,“ sagte Hakeem in die entstandene Stille.
„Nur über meine Leiche!“ antwortete Zaif. „Das ist viel zu gefährlich.“
Während Hakeem bin Zaif wenige Minuten später das Wasser in die Wanne in seinem an sein Schlafzimmer angrenzendes Bad einließ, machte er sich handschriftliche Notizen.
Er würde Hadschi Omar einiges zu erzählen haben!
Ariel Roth hatte gleich mehrere Probleme.
Sabine Sadler wollte nicht mehr für ihn tätig sein. Nachdem sie von ihrem Vater nach Hause beordert worden war und dort versucht hatte, ihren Eltern und ihrem Verlobten einigermaßen plausible Erklärungen dafür zu liefern, wie sie in Monaco hatte in prominenter Gesellschaft abgebildet werden können, während die ganze Familie sie in Düsseldorf bei ernsthaftem Studium wähnte, hatte sie versprochen, sich ab sofort von Graf fernzuhalten. Damit würde diese wertvolle Informationsquelle versiegen.
Ariel Roth war ärgerlich. Aber Sabine Sadler hatte erklärt, ihr Vater habe sie unmissverständlich vor die Alternative gestellt, entweder ab sofort wieder zu Hause zu wohnen und ihr Studium in Bonn zu beenden, oder den Kontakt zu dem „alten Lebemann“ unverzüglich abzubrechen. Auch die Auseinandersetzung mit ihrem Verlobten schien ihr zugesetzt zu haben. Zudem überraschte die Familie durch unangemeldete Besuche in Düsseldorf oder durch Anrufe zur Unzeit.
Da Roth über das Sabine überlassene Mobiltelefon deren letztes Treffen mit Rupert Graf hatte mithören können, wusste er, dass Graf emotionsfrei und nachgerade väterlich gelassen das Ende der Beziehung zur Kenntnis genommen hatte. Er wusste aber ebenso von den Gesprächen Sabines mit ihrer Freundin Simone, in denen Überlegungen angestellt wurden, wie Sabine das Verhältnis zu Graf wiederaufleben lassen und heimlich fortsetzen könne. Vielleicht war ja noch nicht alles verloren!
Weiterhin wurmte Ariel Roth, dass die Wanzen in Grafs Büro gefunden worden sein mussten. Sie gaben keine Signale mehr ab. Immerhin gab es noch die Informationen aus Grafs PC.
Was die Gründe der Saudis anging, das erste U-Boot so zeitig haben zu wollen, waren sie nicht weitergekommen. Das 1.371zigste Todesjahr des Propheten Mohammed konnte man wohl kaum als rundes Datum betrachten! Was die Vielzahl der im Islam zu überregionaler Berühmtheit erlangten Prediger, Schriftgelehrten und Imame anging, hatten sie kapituliert, insbesondere, weil viele Geburts- oder Todestage nur ungefähr genannt werden konnten.
Sie tappten weiter im Dunkeln.
Die Umwandlung der Vorverträge in den Liefervertrag fand durch formellen Austausch verschiedener Urkunden in einer kleinen Zeremonie im Konferenzsaal des Marinehauptquartiers an der Old Airport Road in Riad statt.
Auftragnehmer war das Konsortium bestehend aus der DRRS und der saudischen Gesellschaft Al Salam Inc., Auftraggeber das Königreich Saudi Arabien, vertreten durch die Königlich Saudische Marine.
Das Konsortium wies durch Vorlage entsprechender Dokumente nach, dass die Parteien miteinander einen Konsortialvertrag geschlossen hatten, der die Arbeitsteilung festschrieb.
Die DRRS war durch Rupert Graf und zwei Kollegen aus dem Werftvorstand, Kellermann von der Technik, und Hartung vom Controlling, vertreten. Begleitet wurden sie von dem örtlichen Repräsentanten der DRRS, einem Libanesen namens Dr. Karim Mehmet. Anwesend war weiterhin der Verteidigungsattaché der Deutschen Botschaft in Riad, Oberst der Luftwaffe Karl-Heinz Kunzelmann. Der Botschafter hielt sich vornehm zurück.
Oberst Kunzelmann überreichte den Saudis formell die Exportgenehmigungszusage sowie die beglaubigte Übersetzung und nahm im Gegenzug die Endverbleibsbestätigung entgegen, mit der sich das Königreich Saudi Arabien verpflichtete, die Boote nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis der Bundesrepublik Deutschland an ein drittes Land weiter zu geben. Über die Exportgenehmigungen war in den vergangenen Wochen heftig gestritten worden:
Die Saudis hatten eine Genehmigung erwartet, die ihnen die problemlose Übergabe sämtlicher Boote zusichern würde. Stattdessen erhielten sie Dokumente, die aussagten, dass die eigentlichen Übergabegenehmigungen erst kurz vor Fertigstellung der Boote oder Bootsteile erteilt würden. Die DRRS hatte bisher lediglich die Genehmigungen erhalten, die Boote für Saudi Arabien herzustellen, ein gebrauchtes Boot aus Pakistan einzuführen, zu modernisieren und nach Saudi Arabien auszuführen.
Rupert Graf hatte mehrere Verhandlungsrunden führen müssen, bis er die Saudis überzeugt hatte, dass dies das in Deutschland übliche Verfahren war. Die saudische Seite, der in den achtziger Jahren mehrmals die Lieferung deutscher Kampfpanzer erst zugesagt und anschließend verweigert wurde, wollte in dieser Frage absolute Rechtssicherheit. Was die Saudis tröstete war die Unterzeichnung eines Geheimschutzabkommens sowie von Abkommen über Qualitätssicherung und Ausbildungshilfe. Ersteres stellte sicher, dass die deutschen Behörden, was den Schutz sicherheitsrelevanter Daten anging, den Bau der saudischen Boote so behandeln würden, als wären diese für die Deutsche Marine bestimmt. Ebenso würde die Qualitätskontrolle der Arbeiten in Deutschland so durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung – BWB- erfolgen, als würden die Boote für die Deutsche Marine gebaut. Sogar die Arbeiten in Saudi Arabien selbst unterlagen der deutschen Qualitätskontrolle. Diese würde im Auftrag des BWB durch Mitarbeiter des Germanischen Lloyd durchgeführt.
Im letzten Abkommen verpflichtete sich Deutschland, saudische Offiziere in Einrichtungen der Bundeswehr zu U-Bootfahrern auszubilden.
Die Zeremonie selbst war schmucklos: In einem anderen Land hätte man zumindest ein paar Toasts ausgesprochen und sich zugeprostet, aber hier gab es lediglich Tee in kleinen Gläsern, oder Soft-Drinks.
Gerade, als Rupert Graf eine kurze Dankesansprache halten wollte, ertönte ein Signal, und alle saudischen Anwesenden rannten davon. Die vier Deutschen waren plötzlich allein.
„Gebetsstunde!“ sagte Oberst Kunzelmann. „Prayer time! Das dauert jetzt mindestens eine halbe Stunde, bis die wiederkommen.“
Die Al Salam war durch zwei Vorstandsmitglieder und mehrere Mitarbeiter vertreten, die aber jetzt ebenso zum Nachmittagsgebet geeilt waren.
Da eigentlich alle Formalitäten erledigt waren, hätte die kleine deutsche Delegation ebenso gut zurück zu ihrem Hotel fahren können, beschloss aber, bis zur Rückkehr der Saudis zu warten.
„Ich habe in der Botschaft Champagner kalt stellen lassen,“ sagte Oberst Kunzelmann, als sie eine Stunde später das Marinehauptquartier verließen. „Allerdings werden wir wohl unter uns bleiben müssen.“
Immerhin hatte Admiral Zaif al Sultan sämtliche Teilnehmer der nachmittäglichen Veranstaltung zu einem Abendessen in den Offiziersclub eingeladen. Allerdings erst für 22 Uhr. Viel Zeit, um sich durch einen Umtrunk in der Botschaft einzustimmen.
Rupert Graf mochte arabisches Essen. Insbesondere die Vielzahl von mit reichlich Kreuzkümmel und Knoblauch gewürzten Vorspeisen begeisterte ihn immer wieder.
Die Unterhaltung bei Tisch war mühsam. Da neben weiteren Admirälen auch ein Mitglied des Saudischen Generalstabs, General Faisal bin Salman erschienen war, blieben die übrigen saudischen Offiziere weitgehend stumm und sprachen nur, wenn sie selbst angesprochen worden waren. Es wurden mehrere Ansprachen gehalten, in denen beide Seiten versicherten, alles daran zu setzen, die Verträge zum Erfolg zu führen. Einer der Vertreter der Al Salam hielt seine Ansprache auf Arabisch und erhielt viel Beifall.
Als mehrere gebratene Zicklein am Spieß hereingebracht und aufgetischt wurden, ahnte Rupert Graf bereits, was auf ihn zukam.
Es war der Gastgeber selbst, Admiral Zaif, der behutsam mit einem Löffel die mitgegarten Augen aus den Schädeln der Tiere herauspulte und sorgsam auf mehrere bereits mit Reis und Gemüse belegte Teller setzte.
Genau diese Teller wurden sofort den deutschen Gästen gebracht.
Oberst Kunzelmann konnte sein Grinsen nicht verkneifen, als er die ratlosen Gesichter der deutschen Manager sah. Er hatte so was oft genug erlebt.
Auch Rupert Graf war diese Situation nicht neu.
Seine beiden Vorstandskollegen allerdings guckten hilflos auf das jeweils vor ihnen liegende Auge, das zwar Konsistenz und Größe eines hart gekochten Taubeneies hatte, sie aber trotzdem aus der etwas stumpfen Pupille anzuschauen schien.
Kunzelmann und Graf schluckten die Augen in einem Bissen runter und spülten mit Limonade nach.
Grafs Kollege Kellermann stammelte entsetzt auf Deutsch:
„Das kann ich nicht essen!“
„Musst du! Alles andere wäre eine ungeheure Beleidigung der Gastgeber!“ zischte Graf.
Kellermann und Hartung kauten sichtlich lustlos auf der weitgehend geschmacksneutralen elastischen Masse herum, bis Graf ihnen sagte:
„Mit einem Schluck Flüssigkeit geht´s leichter.“
Anschließend versicherten alle vier lauthals ihren Gastgebern, selten etwas Besseres gegessen zu haben, was prompt dazu führte, dass Admiral Zaif noch weitere Zicklein nachbestellen wollte, was aber unter lautstarkem Protest gerade noch abgewendet werden konnte.
Dafür war das Fleisch der Zicklein zart und gut gewürzt und entschädigte für die Augen.
Admiral Zaif, der als Gastgeber Graf gegenüber saß, hatte bisher weitgehend die Konversation bestritten. Nun jedoch, während des Essens, wurde auch die Unterhaltung am Tisch gelöster. Die Teilnehmer, begannen, sich miteinander zu unterhalten und nicht nur ihren Vorgesetzten zuzuhören.
Der Stellvertreter Zaifs, Konteradmiral Abdallah bin Athel, war der unmittelbare Tischnachbar Grafs. Bin Athel wandte sich an den neben ihm sitzenden Rupert Graf und sagte:
„Einem Mitglied unserer königlichen Familie ist es äußerst wichtig, dass das erste Boot innerhalb der kommenden zwei Jahre hier zur Verfügung steht. Diese Person hat das Geld für die Boote bereit gestellt, unter genau dieser Bedingung. Es ist eine sehr ehrgeizige Aufgabe für unsere Marine, bis dahin eine geeignete Mannschaft ausgebildet zu haben.“
Graf dachte daran, wie ehrgeizig es war, den Saudis das Boot zu diesem Zeitpunkt versprochen zu haben. Er fragte:
„Warum diese kurze Frist?“
Admiral Abdallah bin Athel schien plötzlich erschrocken über seine eigene Offenheit.
„Das darf ich nicht sagen. Das ist ein Geheimnis!“
Ahmed Falouf und Siddiqui saßen währenddessen gemeinsam im Warteraum für Chauffeure im Offiziersclub. Da der Club zahlreiche Sportmöglichkeiten bot und es tagsüber zu heiß war, um sich im Freien sportlich zu betätigen, waren selbst um diese Nachtzeit noch etliche Offiziere unterwegs auf den Joggingpfaden, auf den beleuchteten Tennisplätzen, sogar im ebenfalls beleuchteten Schwimmbecken.
Da der Club weiterhin über mehrere Restaurants verfügte, in denen rund um die Uhr Mahlzeiten serviert wurden, waren um diese Zeit sicherlich noch weit mehr als hundert Besucher hier. Wie die Anzahl der Autos auf dem Parkplatz zeigte, waren die meisten Besucher selbst hierher gefahren. Dennoch saßen rund vierzig Chauffeure in dem Warteraum.
Obwohl sich die meisten untereinander kannten, namentlich, oder zumindest vom Sehen, gab es kaum Unterhaltungen zwischen den Wartenden. Dies lag einmal an Sprachschwierigkeiten. Keiner von ihnen war ein Saudi. Auch wenn sie alle aus arabischsprachigen Ländern stammten, erschwerten doch die unterschiedlichen Dialekte oder die sprachlichen Eigenheiten ihrer Herkunftsländer die Verständigung. Siddiquis Hauptsprache war Urdu, eine der vielen Sprachen Pakistans, die jedoch mit zahlreichen arabischen und persischen Wörtern durchsetzt war.
Während die meisten der Fahrer trotz des aus dem Fernsehgerät quäkenden Lärms dösten oder gar fest schliefen, vertrieben sich Ahmed Falouf und Siddiqui die Zeit mit einem Würfelspiel. Sie spielten zwar nur um geringe Beträge, trotzdem hatte Siddiqui einen höheren Haufen Rialscheine vor sich liegen als Ahmed.
Ahmed Falouf ließ Siddiqui bewusst gewinnen. Nicht ständig, gelegentlich gewann er selbst mal ein paar Geldscheine zurück, aber er spielte so, dass der Gewinn Siddiquis sich stetig erhöhte.
Siddiquis dunkles Gesicht glänzte vor Stolz und Freude.
Er war bester Laune.
Ebenso wie Ahmed schickte Siddiqui den größten Teil seiner Einkünfte nach Hause, nach Pakistan, wo er seine Familie unterstützte. Diese bestand aus seiner unfruchtbaren Frau und aus seiner alten Mutter und mehreren unverheirateten Schwestern. Der Vater, der mehrere Ehefrauen hatte, hatte die Mutter vor einigen Jahren verstoßen und war mit seiner jüngsten Frau nach Karachi verschwunden. Siddiqui hatte noch Kontakt zu seinem älteren Halbbruder Shamin. Obwohl Shamin von einer anderen Ehefrau seines Vaters geboren worden war, hatten sie als Kinder miteinander gespielt und und waren gemeinsam aufgewachsen.
Zudem sparte Siddiqui heimlich Geld, um irgendwann eine zweite Ehefrau kaufen zu können.
„Ich wüsste, wie du sehr viel mehr Geld verdienen könntest“, sagte Ahmed Falouf. „Und dafür müsstest du nicht einmal arbeiten.“
Und dann setzte Ahmed dem immer mehr interessierten Siddiqui auseinander, wie er durch das heimliche Mitschneiden der Telefonate des Admirals zu einem schönen Zusatzverdienst gelangen würde.
Rupert Graf hatte noch in der selben Nacht ein Treffen mit Scheich Mahmut al Ibrahim in einem von dessen Anwesen in Riad. Neidvoll hatte Graf dem Auto von Oberst Kunzelmann nachgesehen, in dem seine beiden Kollegen zum Hotel gebracht wurden, während einer der Angestellten Mahmuts ihn durch die nächtlichen leeren vielspurigen Straßen Riads chauffierte. Es war mittlerweile halb drei Uhr morgens.
Graf erkannte, dass das Haus Mahmuts in einer Gegend lag, in der auch zahlreiche Prinzen der Königsfamilie ihre Paläste hatten. Mahmut würde hier mehrere Häuser besitzen, für jede seiner Ehefrauen eines, und vermutlich weitere für Frauen, von denen er sich geschieden hatte.
Fast alle Grundstücke nahmen jeweils einen ganzen Straßenblock ein. Zumeist waren die Grundstücke von hohen Zäunen umgeben, hinter denen sich großzügige Rasenflächen erstreckten, inmitten derer dann der von hohen Mauern geschützte und von zahlreichen Scheinwerfern angestrahlte eigentliche Gebäudekomplex lag.
Straßen, Rasenflächen, Mauern und Gebäude waren in helles gelbliches elektrisches Licht getaucht. Energie war nicht etwas, an dem man in diesem Land sparen musste.
Das Haus, zu dem Graf gefahren wurde, unterschied sich nicht von den anderen Gebäudekomplexen: Viel Marmor, viel Stuck, viele goldfarbenen Verzierungen, trotz moderner Bauweise den arabischen Charakter zum Ausdruck bringend.
Beinahe hätte Rupert Graf Scheich Mahmut nicht erkannt. Graf sah Mahmut zum ersten mal in arabische Kleidung gehüllt, weißer Burnus, darüber einen goldfarbenen Umhang, als Kopfbedeckung eine strahlend weiße Kufiya. Mahmut erwartete ihn in einem riesigen Wohnraum, an dessen Wänden Sofas und Diwane aufgereiht waren, so dass locker fünfzig Personen hier Platz finden würden.
Mahmut jedoch war allein.
Trotz der zahlreichen Bediensteten, die Graf auf dem Weg vom Auto bis in diesen Saal hatte sehen können, war von der draußen vor den Türen herrschenden Geschäftigkeit hier nichts zu hören.
Vor Mahmut stand ein Tisch, überladen mit Mezze, arabischen Vorspeisen.
Graf wusste, allein aus Höflichkeit würde er gleich noch davon kosten müssen, obwohl er gerade ein schweres Abendessen zu sich genommen hatte.
„Was wollen Sie trinken, Mr. Graf?“ fragte Mahmut gutgelaunt. „Whisky, Cognac, Champagner, Wein?“
Graf entschied sich für Weißwein. Mahmut bellte einige arabische Worte in ein kabelloses Telefon, woraufhin ein Diener erschien und eine Flasche Montrachet für Graf und eine Flasche Black Label für Mahmut brachte.
Nachdem die Gläser gefüllt und der Diener verschwunden war, prostete Mahmut Graf zu.
„Ich habe gehört, alles ist zur allgemeinen Zufriedenheit verlaufen, Mr. Graf. Ich habe sichergestellt, dass unser Konsortium heute Abend noch die Anzahlung erhalten hat. Spätestens morgen früh müsste Ihr Anteil auf den Konten Ihres Unternehmens eingetroffen sein. Damit sind die Verträge in Kraft. Jetzt müssen Sie nur noch liefern!“
Kein Wunder, dass Mahmut so aufgekratzt war angesichts der Beträge, die heute in seine eigenen Taschen geflossen waren. „Wie geht es nun weiter, Mr. Graf?“
Während Rupert Graf ihm auseinander setzte, welche Schritte nun unmittelbar erfolgen würden, wunderte er sich, dass Mahmut keinen der Geschäftsführer der Al Salam zu diesem Treffen hinzugezogen hatte. Die hätten ihm das Gleiche erzählen können.
Was Mahmut insbesondere interessierte waren die Maßnahmen, die Graf ergriffen hatte, um die Lieferzeiten so kurz zu halten wie möglich: Aufbau und Ausrüstung der Fabrikanlage in Dhahran, parallele Fertigung der Bootssektionen in Deutschland, Ausbildung von Schlüsselpersonal der Al Salam auf den Werften in Bremen und ebenso bei Herstellern der Werkzeugmaschinen und der Bootsausrüstungen. Gleichzeitig Beginn der Ausbildung der zukünftigen Besatzungen, hierzu die Hinzuziehung von Experten aus anderen muslimischen Ländern.
„Was ist mit dem allerersten Boot?“ fragte Mahmut. „Dem, das die pakistanische Marine abgegeben hat?“
„Dieses wird morgen aufgeschnitten und weitgehend leergeräumt. Ich habe erreicht, dass wir eine Sektion, die eigentlich für einen anderen Kunden bestimmt war, nutzen können, um dort den außenluftunabhängigen Antrieb einzubauen, den das pakistanische Boot bekanntlich noch nicht hatte.“
„Dann sparen Sie also Zeit?“
„Mehrere Wochen, die wir zur Herstellung der Sektion benötigt hätten.“
„Dann können Sie also früher liefern? Wir sind froh um jeden zusätzlichen Tag, an dem die Besatzung mit dem Boot üben kann.“
Mahmuts gute Laune verringerte sich sichtlich, als Graf darauf verwies, dass diese Maßnahme allein dazu diente, das Zeitpolster der DRRS zu verbessern.
„Wieviel Zeit sparen wir, wenn Sie in Deutschland die Sektion einpassen und den Druckkörper wieder zusammenschweißen?“ fragte Mahmut. „Wir kümmern uns dann hier um die Aufbauten und um die Zusammensetzung der Anschlüsse im Inneren des Bootes.“
„Eigentlich gar keine.“
„Ich möchte dennoch, dass das geschieht. Das gibt uns mehr Zeit, uns mit den Werkzeugmaschinen vertraut zu machen. Ich werde meinen Leuten sagen, sie sollen eine Vertragsanpassung vorbereiten.“
Während des Gespräches hatte Mahmut zweimal durch Drücken einer Taste auf seinem Telefon den Diener hereingerufen, um ihre Gläser nachzufüllen.
Jetzt jedoch wurde an die Tür geklopft, ohne dass Mahmut ein Signal gegeben hätte.
Von dem Diener hereingeführt wurde ein großer schlanker Mann, etwas jünger als Graf, ebenso malerisch gekleidet wie Mahmut, lediglich die Borden seines wehenden Umhangs und seiner Kufiya mit Gold bestickt.
Mit einer Behändigkeit, die Graf verblüffte, sprang Mahmut auf, um seinen Besucher zu begrüßen. Es folgte ein Schwall von Sätzen auf Arabisch, unterbrochen lediglich durch die respektvollen Küsse Mahmuts auf die Schultern des Mannes, bis Mahmut Graf, der sich ebenfalls erhoben hatte, auf Englisch vorstellte:
„Königliche Hoheit, Mr. Graf aus Deutschland, Mr. Graf, seine Königliche Hoheit, Prinz Mirin.“
Der Prinz sagte lediglich: „Freut mich,“ um dann auf Arabisch weiterzusprechen.
Während des Wortwechsels, der aufgrund der schnellen Sprechweise und der zahlreichen Zischlaute auf einen unbedarften Zuhörer gewirkt hätte, als sei ein heftiger Streit im Gang, hatte Graf eingehend Gelegenheit, Prinz Mirin zu betrachten. Markantes, braungebranntes Gesicht, strahlend weiße ebene Zähne, tiefschwarzer Schnurrbart und unter dem Mund der typische schmale sich zur Spitze des Kinns ziehende Bartstreifen. Ein blendend aussehender Mann!
Graf selbst fand keine Beachtung. Beide Herren unterhielten sich lebhaft. Auch der Prinz trank Whisky.
Soviel zu einem Land, in dem unter strengster Bestrafung absolutes Alkoholverbot herrschte!
Rupert Graf saß dabei, ohne die geringste Ahnung, über was die beiden palavern mochten, Pferderennen, Frauen, Yachten, Autos. Es kam ihm zwar so vor als wäre zweimal das englische Wort ´Submarine` gefallen, aber das mochte genauso gut eine Täuschung gewesen sein. Immerhin war es inzwischen weit nach vier Uhr morgens.
Erst nach einer guten halben Stunde richtete Mahmut das Wort an Graf:
„Seine Hoheit möchte wissen, seine Hoheit fragt, seine Hoheit…“
Stets ging es um Sachverhalte zur pünktlichen Auslieferung des ersten Bootes, Mahmut übersetzte die Antworten Grafs, wobei die Übersetzungen jeweils mehr als doppelt so lang schienen als Grafs Antworten selbst.
Danach folgte noch mal eine Viertelstunde Disput auf Arabisch.
Plötzlich erhoben sich der Prinz und Mahmut, der Prinz schüttelte dem überrascht ebenfalls aufgestandenen Rupert Graf die Hand, und Prinz Mirin, mit wehendem Umhang und begleitet von dem wieselflinken Mahmut, verschwand durch die Doppeltür zum Ausgang.
Es dauerte eine weitere Viertelstunde, bis Mahmut wieder erschien. So lange schien die Abschiedszeremonie gedauert zu haben. Graf war hundemüde. Er bat darum, in sein Hotel gebracht zu werden.
Bevor Graf in den wartenden Rolls Royce stieg, raunte Mahmut ihm zu:
„Prinz Mirin ist derjenige, der das ganze Geschäft bezahlt.“