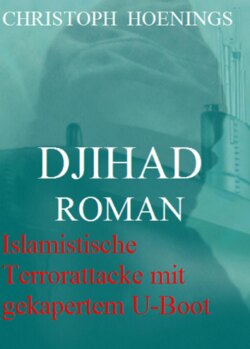Читать книгу Djihad - Christoph Hoenings - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Hakeem
ОглавлениеMoishe Shaked hatte Ezrah Goldstein und Itzak Salomonowitz in seine kleine Wohnung im fünften Stock eines Wohnblocks in der Nähe des Dizengoff-Einkaufszentrums eingeladen. Seine Frau Sarah war mit ein paar Freundinnen zu einem Abendessen in der Altstadt von Jaffa unterwegs, so dass sie ungestört waren.
Sie tranken Whisky, Eiswürfel klimperten in den Gläsern, und die Aschenbecher quollen über von den zahlreichen Zigarettenkippen.
Ihre gelöste Laune rührte daher, dass es Ahmed Falouf gelungen war, Siddiqui als zusätzliche Informationsquelle anzuzapfen.
Angeblich hatte zwar Siddiqui für seine Tätigkeit 5.000 US-Dollar verlangt, wobei Shaked überzeugt war, dass Falouf davon die Hälfte für sich behielt, aber die neue Quelle hatte sich als wertvoll erwiesen. Außerdem war Falouf auf viertausend heruntergehandelt worden.
Siddiqui lieferte nicht nur Tonaufnahmen der von Admiral Zaif aus dem Auto geführten Telefonate, sondern er berichtete Falouf auch, was er von anderen Chauffeuren erfuhr, was die U-Boote anging.
„Leider können wir den Kerl nicht so wie Falouf unter Druck setzen,“ sagte Moishe Shaked. „Falouf hat Angst um seine Familie in der West-Bank. Siddiquis Sippe in Pakistan können wir schließlich nicht gut als bedroht darstellen. Aber das, was er liefert, ist das Geld wert.“
„Fassen wir noch mal zusammen, was wir inzwischen wissen,“ antwortete Salomonowitz. „Die Deutschen haben das aus Pakistan erhaltene Boot aufgeschnitten und sind dabei, es in aller Eile zu modernisieren.Die Werkshallen in Dhahran sind dank modularer Bauweise so gut wie fertig. Gleich mehrere Rammbären schlagen Tag und Nacht Spundwandbohlen in den Boden, um die zukünftige Pier herzustellen. Eines muss man den Deutschen lassen: Die gehen mit Umsicht und gut geplant vor. Auf die Idee, die ersten Segmente der Boote auszuliefern und in den Hallen zusammenbauen zu lassen, während draußen noch an der Pier gebastelt und der Shiplift installiert wird, muss man erst mal kommen!“
„Wichtiger sind die Fortschritte an dem ersten Boot,“ warf Ezrah Goldstein ein. „Graf will in den nächsten Tagen nach Washington. Er will versuchen, dort fertige Sonarsysteme zu bekommen. Die deutschen Produkte haben zu lange Lieferfristen.“
„Woher weißt du das?“ fragte Shaked. „Ich denke, deine Quelle ist versiegt.“
„Naja, sie tröpfelt noch.“ Goldstein musste daran denken, dass Ari Roth immer noch aus Grafs Büro Informationen erhielt. „Die Geschichte mit dem Computer war eine Falle, in die die Deutschen prompt hineingetapert sind,“ erklärte er grinsend. „Wir hatten das Programm mit Absicht so geschrieben, dass irgendwann auffallen musste, dass Informationen abflossen. Sie haben ja auch nicht allzu lang gebraucht, das herauszufinden. In der Freude über ihren Erfolg sind sie nicht mal auf die Idee gekommen, dass es ein redundantes zweites Programm geben könnte, das uns Informationen liefert. Und zwar auf eine Art und Weise, hinter die sie niemals kommen können!“ Sein Grinsen wurde noch breiter. „Wenn wir wollen, können wir Graf jederzeit hochgehen lassen. Wir wissen inzwischen soviel über ihn und seine übrigen Geschäfte, dass der Auftrag aus Saudi Arabien nicht mal erwähnt werden müsste. Allein seine Bemühungen um einen Auftrag aus Nigeria würden ausreichen, dass ihm die deutsche Staatsanwaltschaft auf die Pelle rückt!“
„Und seine kleine Freundin?“ fragte Itzak.
„Ist auf dem Weg zurück zu ihm. Ihr Verlobter ist ihr abhanden gekommen. Über eine Freundin, die wiederum mit einem von Grafs Freunden liiert ist, erfährt sie, was Graf tut und wohin er reist, und da will sie wieder mit.“
„Woher wissen wir das alles?“ wollte Itzak wissen.
„Ari hat selbstverständlich ihre Wohnung verwanzt,“ antwortete Ezrah trocken.
„Zurück zum Geschäft, “ sagte Moishe Shaked. „Die Saudis haben eine Gruppe von zehn Offizieren der Pakistani Navy angeheuert, die bereits dabei sind, einer handverlesenen Truppe saudischer Marineleuten die Geheimnisse der U-Bootskriegsführung beizubringen. Gleichzeitig sind mehrere saudische Dienstgrade nach Karachi delegiert, um dort an Bord der pakistanischen Boote ausgebildet zu werden.“
„Was ist mit den Leuten, die zur Ausbildung nach Deutschland geschickt worden sind?“ fragte Itzak Salomonowitz.
„Die lernen noch Deutsch,“ antwortete Ezrah. Auf die fragenden Blicke seiner beiden Kameraden fügte er zufrieden grinsend hinzu:
„Die Ausbildung in der Marineschule Eckernförde, wo auch die U-Bootssimulatoren stehen, erfolgt in deutscher Sprache. Die Saudis sitzen alle noch in einer Sprachschule in Hamburg und lernen Deutsch.“
„Was ist mit der Technik?“ wollte Itzak Salomonowitz wissen. „Leistungsdaten der Boote, Signaturen, Schallabstrahlung?“
„Diese Daten gehen nicht über Grafs Tisch,“ antwortete Goldstein. „Er hat mit der Technik nichts zu tun. Das alles wird direkt auf der Werft in Bremen behandelt.“
„Und da haben wir keine Quellen?“ fragte Salomonowitz.
„Nein. Die haben, weil sie ja auch für das deutsche Verteidigungsministerium bauen, einen ganz engen Schutzschirm. Sehr professionell. Ständige Sicherheitsüberprüfungen. Dicht wie ein Mäusearsch!“ Nach einem Augenblick fügte er mit bitterem Unterton hinzu: „Die Sicherheitsexperten der Bundeswehr sind schließlich zum Teil hier in Israel ausgebildet worden!“
„Haben wir keine Chance, über die offizielle deutsche Seite an diese Informationen zu kommen? Du weißt schon, deutsch-israelische Freundschaft und dieser ganze Schmu. Oder, indem wir sie an den Holocaust erinnern. Das hilft doch eigentlich immer!“
Ezrah Goldstein sah Salomonowitz nachdenklich an.
„Ich will das mit Ari besprechen. Das wird nicht leicht. Du weißt ja, wie die Deutschen sind. Die haben ein Geheimschutzabkommen mit den Saudis geschlossen, und da halten die sich dran. Ihr kennt doch die Geschichte, wo ein Deutscher an einem Puff klingelt und, als die Puffmutter rausguckt, er die fragt: `Ich hab nur zwei EURO, was krieg ich dafür?` Sagt die: ´Hinterm Haus ist eine Kellertreppe, da kannst du dir einen runterholen!` Nach fünf Minuten klingelt der Typ erneut. `Was willst du jetzt schon wieder?´ fragt die Puffmutter. Sagt der: `Bezahlen`.“
Salomonowitz und Shaked lachten.
„Ja, so sind die wirklich!“ sagte Goldstein. „Immer penibel!“
„Interessant finde ich, was wir durch Siddiqui über den Geldgeber erfahren konnten,“ sagte Moishe Shaked. „Aus den Mitschnitten der Telefonate von Zaif wissen wir, dass er sich mehrfach darüber ausgelassen hat, eines der höchsten Mitglieder der Königsfamilie habe das Geld für das Projekt gegeben. Es gibt ja nirgendwo ein offizielles Budget.“
„Das ist dort doch nichts Unübliches!“ warf Itzak ein. „Aber wir wissen nicht, wer genau?“
„Nein.“
„Aber wir wissen,“ warf Ezrah Goldstein ein, „dass Graf, kaum war der Vertrag in Kraft und er wieder zuhause, sich sämtliche Informationen über das saudische Königshaus auf seinen Bürocomputer gerufen hat. Also, sämtliche Brüder des Königs, sämtliche von deren männlichen Nachfahren, sogar deren Enkel. Es sah aus, als suche er das Bild von jemandem, den er mal getroffen hat.“
„Hat er keinen Namen eingegeben?“
„Leider nicht. Sonst wüssten wir ja, nach wem er gesucht hat.“
„Kann man diesen Scheich Mahmut al Ibrahim nicht abschöpfen. Ihm ein Mädchen unterschieben, die ihn aushorcht? Einen seiner Mitarbeiter? Viele seiner Angestellten stammen doch aus Palästina!“
„Bekomme ich dafür ein Budget?“ fragte Shaked. Alle drei waren sich bewusst, dass solche Aktionen nicht kostenfrei sein konnten.
Salomonowitz antwortete:
„Ich werde mit dem Minister sprechen. Allerdings kann ich bisher keine direkte Bedrohung Israels begründen, und ihr wisst ja, wie knauserig der Bursche ist. Ständig hält er mir vor, was die bisherigen Aktionen schon gekostet haben.
„Im Übrigen hat mich Chaim Zimmerman aus Washington angerufen. Er ist befreundet mit jemandem aus der Heimatschutzbehörde. Die haben vor einiger Zeit einen seltsamen Anruf aus Riadh nach Peshawar in Pakistan abgefangen. Jemand aus Riadh bat jemanden in einer Koranschule in Peshawar um Hilfe bei den U-Booten. Die Schule gilt als Außenstelle der Taliban.“
„Kann man sich da einen Reim draus machen?“ fragte Shaked.
„In dem Telefonat war wohl etwas dergestalt gesagt worden, man wolle die Boote gegen den Großen Teufel einsetzen. Das ist eigentlich die Bezeichnung für die USA. Aber je nach Dialekt könnte auch Israel gemeint sein.“
„Was machen die Amerikaner jetzt?“ fragte Goldstein.
„Sie behalten die Schule im Auge!“
„Ach so, noch etwas,“ sagte Moishe Shaked. „Hakeem bin Zaif geht zum Studium nach Deutschland. Nach Hamburg.“
„Wer ist das jetzt wieder?“
„Der Sohn von Admiral Zaif al Sultan. Das bedeutet, der Alte wird den Knaben regelmäßig dort besuchen. Und damit er die Reisen nicht aus eigener Tasche zahlen muss, wird er dienstliche Gründe erfinden, um zu den Werften nach Bremen zu reisen. Das ist eine Autostunde von Hamburg entfernt.“
„Wir haben Fotos und wesentliche Einzelheiten in unserer Datenbank,“ antwortete Goldstein. „Lass mich wissen, wann der Bengel kommt. Dann soll Ari sich um ihn kümmern.“
Hakeem bin Zaif freute sich einerseits darauf, sein Studium in Deutschland aufzunehmen, andererseits war er betrübt, nicht mehr an den Gebetsstunden und den anschließenden Debatten mit Imam Hadschi Omar teilnehmen zu können.
Da Hakeem so gut wie keine Deutschkenntnisse hatte, wäre die Aufnahme seines Studiums in einem englischsprachigen Land sicherlich einfacher gewesen. Aber in die USA wollte er nicht, nach England auch nicht. Nach Australien wollte ihn sein Vater nicht lassen. Zudem hatte sein Vater ihm gesagt, die Ingenieurausbildung in Deutschland sei die beste, die man sich vorstellen könnte.
Hakeem würde bereits jetzt, drei Monate vor Semesterbeginn, nach Hamburg übersiedeln. Die Saudische Botschaft in Berlin hatte für ihn ein kleines Apartment in der Nähe der Universität ausfindig gemacht und ihm einen Lehrer besorgt, der ihm Deutsch beibringen würde.
Hakeems Mutter wollte ihn unbedingt begleiten, um zu sehen, dass er ordentlich untergebracht würde, aber das hatte der Vater untersagt. Stattdessen hatte Vater sichergestellt, dass ein Mitarbeiter des Stabes des Verteidigungsattachés aus der Botschaft Hakeem in Frankfurt abholen und ihn nach Hamburg begleiten würde. Der Mann, ein junger Leutnant des Heeres, würde Hakeem bei den ersten Kontakten mit deutschen Ämtern und Behörden behilflich sein, was Anmeldungen und Papierkram anging.
Was Hakeem nicht wissen konnte war, dass das deutsche Verteidigungsministerium den Innensenator der Stadt Hamburg aufgefordert hatte, dem Sohn eines der ranghöchsten Offiziere des Königreiches Saudi Arabien diskrete Hilfe und Unterstützung zu gewähren.
Morgen würde es also endlich losgehen.
Hakeem war auf dem Direktflug der Saudi Airlines von Riad nach Frankfurt gebucht.
Aber vor seiner Abreise hatte Hakeem noch etwas Wichtiges zu tun: Abschied zu nehmen von Imam Hadschi Omar.
Das Gespräch mit Omar dauerte mehr als zwei Stunden. Zwei Stunden, in denen Omar sich ihm, Hakeem, ganz alleine widmete. Omar gab Hakeem mehrere Anschriften in Hamburg, unter denen er Glaubensgenossen finden würde, genauso durchdrungen wie Hakeem von dem Wunsch, Allah fromm zu dienen.
Richtig berührt war Hakeem von den Fragen des Imam nach seiner Familie. Wie Hakeems Eltern damit zurecht kamen, den ältesten Sohn in die Ferne, in ein Land der Ungläubigen zu schicken? Welche Vorsorge die Eltern getroffen hätten, dass Hakeem nicht die Pfade der Tugend verlassen, und Allah möge es verhüten, im Sumpf der Sünde der westlichen Länder versinken würde.
Hakeem berichtete, dass seine Eltern, jetzt, nachdem die Marine U-Boote aus Deutschland bezog, ihn regelmäßig in Hamburg besuchen und nach ihm sehen würden.
Imam Omar pries Allah für diese glückliche Fügung. Hakeem empfand es als besondere Höflichkeit des Imam gegenüber seinem Vater, dass er nach dem Fortgang des U-Bootsgeschäftes fragte. Hakeem, um den Imam zu beeindrucken, berichtete alles, was er dazu wusste.
Vom Umbau eines der ursprünglich mal nach Pakistan gelieferten Boote. Von der Entsendung saudischer Marineangehöriger nach Pakistan. Von der Tatsache, dass pakistanische Offiziere nach Saudi Arabien kommen würden, um saudisches Marinepersonal auszubilden.
Imam Hadschi Omar hörte Hakeem aufmerksam zu und unterbrach ihn nur mit Bemerkungen wie: „Das ist höchst gottgefällig!“ Oder: „Allah sei gepriesen, dass diese Ausbildung durch ein gläubiges Brudervolk erfolgt!“ Oder: „Allah hat diesem Vorhaben seinen Segen gegeben!“
Zum Abschluss ihres Treffens beteten sie gemeinsam um den Schutz Hakeems durch Allah und um Allahs Segen für den erfolgreichen Beginn von Hakeems Studien.
Zum Schluss sagte der Imam:
„Wenn ich jemanden zu dir schicken sollte, um in meinem Namen zu dir zu sprechen, so achte darauf, dass gleich im ersten Satz das Wort „grün“ vorkommt. Grün, die Farbe, die dem Islam heilig ist.“
Als Hakeem sich von Imam Hadschi Omar verabschiedete, hatte der fromme Mann Tränen in den Augen. Als Hakeem dies sah, fing auch er selbst an, zu weinen. Er küsste dem Imam ein letztes Mal die Hände und stolperte, durch einen Tränenschleier in seiner Sicht behindert, aus dem Gebetsraum.
Sabine Sadler war ausgesprochen unglücklich.
Nicht, weil ihre Verlobung in die Brüche gegangen war. Das war eher peinlich als traurig! Ihr Vater war zutiefst verärgert, weil die Auflösung der Verlobung auch seine Freundschaft zum Vater des jungen Mannes beeinträchtigte.
Nein, Sabine Sadler sehnte sich zurück an die Seite Rupert Grafs.
Sie hätte weiterhin nicht guten Gewissens sagen können, sie liebe Graf. Aber ihr fehlte das erregende Leben mit ihm, die Reisen, die Wiedersehen, wenn er ohne sie unterwegs gewesen war.
Hinzu kam, dass der nette Kreis, sie, Simone, Holger Brockert, Graf, auseinandergefallen war. Sie waren zwar nicht sehr oft zusammengetroffen, aber doch gelegentlich zu viert zum Essen ausgegangen und einmal zu einem Rockkonzert.
Zu den letzten Essen, so hatte Simone berichtet, hatte Graf jedes Mal eine andere Bekannte mitgebracht!
Bisher hatte sie sich nicht getraut, Rupert Graf anzurufen. Schließlich war sie selbst es ja gewesen, die das Verhältnis beendet hatte. Jetzt fand sie ihren Entschluss übereilt, getroffen unter dem Eindruck der häuslichen Szenen und der tiefen Traurigkeit des Mannes, den sie seit Kindesbeinen gekannt hatte und der sie hatte heiraten wollen.
Jetzt, einige Wochen später, nicht mehr in der Enge der Kleinstadt im Tal der Mosel, nicht mehr gebunden an ein Versprechen und an den Mann, der seine Betroffenheit über ihren Vertrauensbruch nicht verwinden konnte, jetzt wollte sie zurück zu Rupert Graf.
Wenn nur ihr Vater nicht so engstirnig wäre!
Er hatte ihr klargemacht, er würde seine finanziellen Zuwendungen für ihr Studium in Düsseldorf sofort einstellen, wenn sie sich mit Graf noch einmal einließe.
Als ob ihr Studium unter der Beziehung zu Rupert gelitten hätte! Sie hatte alle Scheine gemacht, die sie machen musste, sämtliche Zwischenprüfungen erfolgreich abgelegt!
Sie hatte ihn nie gefragt, und Rupert Graf hatte ihr nie angeboten, bei ihm einzuziehen. Reichlich Platz war ja vorhanden in seiner Wohnung am Zoo, wo er sich ohnehin fast nur am Wochenende aufhielt. Wenn er nicht in Bremen war, war er auf Reisen, und seine Wohnung stand die meiste Zeit über leer.
Wenn sie also die eigene Miete sparen könnte… .
Sabine Sadler war eine kühl und praktisch denkende junge Frau.
Sie wusste, sie könnte es zur Not schaffen, ohne den monatlichen Scheck ihres alten Herrn über die Runden zu kommen.
Mit einem schweren Seufzer tippte Sabine Sadler die Nummer Grafs in ihr Handy und lauschte dem Rufzeichen.
Ahmed Falouf war richtig stolz auf sich.
Nachdem er wieder ein ordentliches Zubrot zu seinem Gehalt als Fahrer verdiente – von den viertausend Dollar, die er für die Informationen Siddiquis erhielt, gab er diesem nur 1.500 Dollar weiter - , hatte er seinen Vater gebeten, bei Zaidahs Vater zu sondieren, was eine Eheschließung kosten würde. Heute hatte er den Brief seines Vaters aus Ramallah erhalten, in dem dieser mit traurigen Worten mitteilte, er habe mit Zaidahs Vater verhandelt, dieser sei aber nur bereit, gegen Zahlung von 15.000 Dollar einer Eheschließung Ahmeds mit seiner Tochter zuzustimmen.
Und fast zwei Drittel dieser Summe hatte er schon zusammen!
Obwohl Ahmed von seinem Verdienst nach Abzug seiner bescheidenen Aufwendungen in Riad fast alles, was an Geld übrig blieb, seinem Vater schickte, hatte er das Geld der Israelis für sich behalten. Er hatte sich nicht getraut, dieses Geld auf eine Bank zu tragen. Er besaß zwar ein Konto bei der Saudi Commercial Bank, auf das sein Monatsgehalt überwiesen wurde und von wo aus er seine laufenden Kosten deckte, aber er hatte es nicht für klug gehalten, seine zusätzlichen Einnahmen dort einzuzahlen. Das Geld der Israelis erhielt er in bar. Er bezahlte Siddiqui in bar. Und er hatte schon zum dritten Mal 25 Einhundert-Dollar-Noten in die Plastiktüte gestopft, die er unter der kleinen Palme in dem Blumentopf in seinem Apartment versteckt hatte.
Ahmed wusste, das war kein sicheres Versteck!
Bei seiner Bank lief er Gefahr, gefragt zu werden, woher das Geld stammte, und das hätte er nicht erklären können. Hier ging es nicht um Fragen nach Steuern. Einkommen in Saudi Arabien wurden nicht besteuert. Aber die Frage nach der Herkunft des Geldes wäre gekommen. Die Saudis waren immer überzeugt, ihre ausländischen Dienstboten klauten wie die Raben, und Ahmed hätte riskiert, aufgrund eines Hinweises der Bank polizeilich vernommen zu werden.
Dass die Israelis in sein Zimmer mitten in einem Gebäude eingedrungen waren, das dem saudischen Verteidigungsministerium gehörte, um die hinter seinem Schrank versteckte Audiokassette zu stehlen, hatte ihm die Unsicherheit seiner Behausung drastisch vor Augen geführt. Gut, er wohnte nicht in einem militärischen Komplex, sondern in einem Wohnheim für niedere Angestellte. Aber trotzdem, hier gingen Leute in Uniformen aller drei Teilstreitkräfte und der Special Security Forces ein und aus. Und da besitzt jemand die Dreistigkeit, hinein zu marschieren, seine Zimmertür aufzubrechen, und seine Kammer in aller Seelenruhe, aber gründlich, zu durchsuchen!
Ahmed Falouf war sich darüber im Klaren, dass er dringend eine andere Lösung für den Verbleib seines Geldes benötigte. Für das Geld, mit dem sein Vater ihm die Braut kaufen sollte, die Ahmed schon seit Jahren begehrte!
Nun ging es ja nicht nur darum, das Geld sicher aufzubewahren, was ja schon schwierig genug war! Sein Hauptproblem würde werden, das Geld aus Saudi Arabien heraus und auf der Busreise erst durch Jordanien und von dort aus weiter durch die israelischen Grenzkontrollen nach Palästina zu bringen.
Die Einzahlung in eine Bank in Saudi Arabien verbot sich. Gut, er konnte nach Bahrain oder Dubai fahren, die Grenzkontrollen waren sehr lasch, und dort die Einzahlung vornehmen, aber auch die Überweisung auf ein Konto in Ramallah war nicht opportun. Selbst, wenn es ihm gelänge, ohne Aufsehen das Geld in einer arabischen Bank einzuzahlen, die Israelis würden möglicherweise bei Eintreffen des Geldes in Palästina Steuern hierauf erheben und ihm den halben Brautpreis kurzerhand abknöpfen!
Aber jetzt, wo für Ahmed Falouf zum ersten Mal eine reale Chance bestand, von Zaidahs Vater als Bräutigam für Zaidah anerkannt zu werden, wo Ahmed kurz davor stand, sich den langjährigen Traum einer Hochzeit mit Zaidah erfüllen zu können, musste er einfach einen Weg finden, das Geld bis nach Palästina zu transportieren!
Was Ahmed Falouf so stolz machte, war sein neuer, aus ganz feiner, mit Seidenfäden durchwirkter Wolle gewebter Gebetsteppich.
Wie lange hatte er nach diesem Teppich auf den Basaren und Souks von Riad gesucht?! Ihm war es insbesondere darum gegangen, einen Teppich zu finden, der exakt die Abmessungen seines alten, viel gebrauchten Gebetsteppichs besaß. Und jetzt hatte er endlich das passende Stück gefunden! Der Teppich, eben wegen der darin enthaltenen Seide, war sündhaft teuer gewesen. Ahmed hatte fast den Gegenwert von 300 Dollar dafür ausgeben müssen.
Trotzdem war Ahmed Falouf stolz und froh.
Er verteilte seine 100 Dollar-Noten gleichmäßig auf dem neuen Teppich, legte den alten Teppich obenauf, und begann, beide Teppiche an den Rändern und in Abständen von zehn Zentimetern quer über die Fläche zusammenzunähen.
Als er fertig war, sahen der dünne neue und der alte, dickere und bereits vom Gebrauch abgewetzte Wollteppich aus, als ob sie ein einziges Teil wären!
Wenn er den Teppich aufrollte, war von dessen wertvollem Inhalt ohnehin nichts zu sehen oder zu spüren, aber auch in auseinandergerollter Form war das darin versteckte Geld nicht zu erkennen.
Das ideale Versteck!
Obwohl es gar nicht die Stunde des Gebetes war, betete Ahmed Falouf, auf seinem geldgepolsterten Teppich kniend, und dankte Allah voller Inbrunst für diesen guten Einfall!
Fast hätte er in seinem Gebet das Klopfen an seiner Kammertür nicht gehört.
Als er öffnete, stand Siddiqui vor ihm, mit einem weiteren dunkelhäutigen Mann.
„Wir sollten sprechen!“ sagte Siddiqui bestimmt und schob Falouf vor sich her in dessen Zimmer. „Dies ist ein enger Freund meines älteren Bruders Shamin, somit ist er wie ein eigener Bruder. Naqui ist erst gestern Nacht aus Pakistan angekommen. Ich hatte ihm von dir erzählt. Er wollte dich gerne kennenlernen.“
Rupert Graf litt unter Jet-Lag.
Er war am vergangenen Wochenende nach Indonesien gereist, hatte anderthalb Tage in feuchtheißer Luft und tiefgekühlten Büros verbracht, war von dort Montagabend weiter nach Taipeh geflogen. Nach der Ankunft am folgenden Morgen hatte er selbigen Tags an einem Abendessen mit Delegierten des taiwanesischen Parlaments teilgenommen, einen kurzen Vortrag gehalten, und war am Mittwoch von Taipeh nach Los Angeles weitergereist, umgestiegen nach Washington, wo er Donnerstagabend eintraf.
Nach einer Nacht im Four Seasons Hotel hatte er am Freitag Gespräche mit US-Navy International Programs in Crystal City geführt und am selben Abend noch die Lufthansa nach Frankfurt bestiegen.
Zuhause in Düsseldorf hatte er geduscht, ein paar Einkäufe gemacht, seine Post, die der am Düsseldorfer Flughafen auf ihn wartende Chauffeur Schmitz mitgebracht hatte, durchgearbeitet und zahlreiche Anrufe beantwortet.
Und jetzt war Samstagnacht, und Graf war erschöpft, aber dennoch hellwach! Er hatte keine Lust gehabt, auszugehen, dazu fühlte er sich zu wackelig auf den Beinen. Aber er konnte nicht in den Schlaf finden.
Rupert Graf hatte sich lustlos durch die verschiedenen Fernsehkanäle gezappt, dann aber doch noch mal seinen PC angeknipst.
Trotz der Beteuerungen des Sicherheitsexperten Vogel, alles sei in Ordnung, traute er seinem Bürocomputer in Oberhausen nicht mehr. Der Sicherheitsdienst hatte zudem in seinem Büro und in seinem Vorzimmer Abhörgeräte gefunden, made in China.
Ob er seinem PC in seinem Zuhause trauen konnte, wusste Rupert Graf nicht. Aber er hatte, gerade wegen seiner häufigen Abwesenheiten, ein aufwändiges Sicherheits- und Alarmsystem in seiner Wohnung einbauen lassen, und er war überzeugt, niemand könne hier eingedrungen und sich an seinem PC zu schaffen gemacht haben.
Deshalb gab er hier, unter Google, ein: Prinz Mirin, Saudi Arabien.
Er wurde verwiesen auf eine Reihe von Programmen, die etwas zum Saudischen Königshaus zu sagen hatten.
Das Problem für Nichtaraber mit der arabischen Sprache ist ihr Mangel an geschriebenen Vokalen.
Deshalb unterliegt ein und derselbe Name in lateinischer Schrift unterschiedlicher Schreibweise: Abdallah, Abdullah, Abdul, Abdal, manchmal abgekürzt nur noch Abd; Abraham, Ibrahim; Mohammed, Mohammad, Mahmet, Mahmut, Mehmet, je nach örtlichem Dialekt. Prinzen Mirins gab es gleich mehrere.
Hätte Scheich Mahmut den Namen von Mirins Vater angehängt, also bin Abdul, bin Faisal, bin was immer, so hätte Graf den nächtlichen Gast in Mahmuts Haus einwandfrei identifizieren können.
Dem Alter nach hätte Graf den Prinzen Mirin für einen Urenkel des Staatsgründers Abdul Aziz gehalten. Abdul Aziz hatte mehrere Frauen, die ihm geschenkten Söhne waren, allein in der Reihenfolge ihrer Geburt und unabhängig von welcher Mutter sie stammten, die Thronfolger.
Also: Ältester Sohn, nach dessen Tod zweitältester – lebender - Sohn, und so weiter. Sämtliche direkten Söhne bekleideten ein Ministeramt.
Aber sämtliche acht Söhne, die Graf ausfindig machen konnte und welche die jetzige Machtriege stellten, hatten ihrerseits mit mehreren Frauen zahlreiche Kinder in die Welt gesetzt. Gleichzeitig haben durften sie vier Frauen. Da aber eine Scheidung leicht möglich war, war die Gesamtanzahl der aktuellen und geschiedenen legitimen Ehefrauen erheblich größer. Und da die Herren selbst im hohen Alter mit immer jüngeren Damen Nachwuchs produzierten, war manch eigener Sohn jünger als mancher Enkel! Die weiblichen Nachkommen, die es ja auch gegeben haben musste, wurden in den Graf zugänglichen Archiven nicht aufgeführt.
Da die Enkel wiederum die gleiche Produktivität an den Tag legten wie die vorige Generation, ebenfalls mit vier gleichzeitigen, aber wegen der unkomplizierten Möglichkeit der Scheidung ebenfalls wechselnden Ehefrauen, war eine riesige und ohne Organigramm nicht mehr überschaubare Dynastie entstanden.
Und irgendwo, inmitten dieser Dynastie, befand sich Prinz Mirin.
Der Zahlmeister der U-Boote. Der sich das Programm annähernd zwei Milliarden Dollar kosten ließ, aber darauf bestand, das erste Boot innerhalb von zwei Jahren einsatzbereit zu haben!
Rupert Graf war keineswegs ein Mann, der, von seinen Skrupeln geplagt, nicht in den Schlaf finden würde. Was ihn wurmte war, nicht zu wissen, was hier ablief. Er spürte, dass er und sein Unternehmen zu einem Zweck missbraucht werden sollten, ohne erkennen zu können, um was es ging.
Eine der besonderen Eigenschaften Rupert Grafs war seine Beharrlichkeit. Egal, ob er einem Auftrag hinterher jagte oder ein Schachrätsel zu lösen versuchte: Er gab nicht auf, selbst wenn Dritte seine Bemühungen für ziemlich hoffnungslos hielten.
Und auch, was die Rolle des Prinzen Mirin und dessen Beweggründe anging, so würde Graf weiterbohren, bis er die Lösung kannte.
Auch Sabine Sadler besaß einen Hang zur Hartnäckigkeit. Groß geworden neben einem älteren Bruder als einzige Tochter in einem von Wohlstand geprägten Haushalt, in die Welt gesetzt von Eltern, die beide bei Sabines Geburt schon die dreißig überschritten hatten, war Sabine gewohnt, das zu bekommen, was sie wollte. Es war nicht so, dass sie besonders verwöhnt worden wäre, und ihre Wünsche waren auch keineswegs unbescheiden, aber die Erfüllung dieser bescheidenen Wünsche hatte Sabine stets mittels beharrlichen Bittens, mittels die Nerven ihrer Eltern und ihres älteren Bruders aufreibenden Gequengels oder durch das Aushandeln von ihr entgegenkommenden Kompromissen durchgesetzt.
Insofern war sie nicht bereit, auf Rupert Graf zu verzichten.
Ariel hatte ihr gesagt, sie solle das ihr ausgehändigte Mobiltelefon noch behalten, man wüsste ja nie, zu was es noch dienlich sein könne.
Sie schleppte das Gerät nicht mehr wie früher ständig mit sich herum. Aber sie hatte es noch.
Und damit konnte sie jederzeit in Kontakt zu Ariel treten.
Rupert Graf, auf dessen Mailbox sie vor einigen Tagen gesprochen hatte, hatte sich noch nicht gemeldet.
Sabine hatte allerdings von Simone erfahren, Graf war unterwegs, und auch wenn sie etwas beleidigt war, dass er noch nicht zurückgerufen hatte, so musste sie sich eingestehen, dass sie ja auch nur gesagt hatte:
„Nichts Wichtiges. Ich wollte nur mal hören, wie es so geht.“
Wie ihr im Nachhinein eingefallen war, hatte sie nicht mal ihren Namen genannt. Womöglich hatte Rupert, mit seiner Mailbox aus irgendeinem fernen Land verbunden, ihre Stimme nicht mal erkannt!
Auch als sie jetzt den einzigen in das Verzeichnis des Telefons angegebenen Anschluss drückte, hörte sie lediglich Ariels Stimme sagen: „Hinterlassen Sie nach dem Signal eine Nachricht!“
Diesmal bat sie ausdrücklich um einen Rückruf.
Hakeem bin Zaif hatte Heimweh.
Die Stadt Hamburg war groß und unüberschaubar, das Wetter schlecht, wie man ihm sagte, zu kühl für die Jahreszeit, windig, regnerisch. Er war zwar schon häufig außerhalb Saudi Arabiens gewesen, und somit war Regen für ihn nichts Neues. Aber noch nie war er in einer Stadt gewesen, in der dermaßen viel eiskaltes Wasser vom Himmel fiel wie in Hamburg!
Seine Deutschkenntnisse machten keine erkennbaren Fortschritte. Wenn er geahnt hätte, wie schwierig diese Sprache war, er hätte sich kaum auf Deutschland eingelassen als Platz für sein Studium.
Die Mitarbeiter der Gesandtschaft in Berlin hatten eine ungemütlich möblierte Dreizimmerwohnung für ihn in einem modernen Wohnblock in der Nähe der Universität gefunden. Der junge Feldwebel aus dem Stab des Verteidigungsattachés, Abd el Abd, der in Frankfurt am Ankunftsgate auf ihn gewartet hatte, war einige Tage in Hamburg geblieben, um Hakeem behilflich zu sein. Abd el Abd hatte Hakeem nicht nur zu den verschiedenen Behörden begleitet, er hatte sich auch um den Abschluss diverser Versicherungen gekümmert – offenbar konnte man sich in diesem Land gegen alle erdenklichen Risiken versichern. Abd el Abd hatte Hakeem weiterhin in die Geheimnisse des Hamburger öffentlichen Nahverkehrs eingeweiht und ihn damit vertraut gemacht, wie er mittels Hochbahn, U-Bahn, S-Bahn, Bussen sich in der Stadt bewegen konnte.
Abd el Abd hatte Hakeem auf dessen Bitte in einem in der Nähe befindlichen Supermarkt die Lebensmittel gezeigt, die Hakeem würde essen können, ohne die Vorschriften des heiligen Korans zu verletzen. Hakeem hatte sich die Namen und Marken der Produkte notiert.
Gegessen hatten sie stets in Restaurants, sogar in einigen recht schönen oder zumindest schön gelegenen, aber Hakeem war angeekelt gewesen von den Mengen alkoholischer Getränke, die die Deutschen zu sich nahmen. Abd el Abd und er hatten nur Wasser oder Limonaden getrunken.
Dass Feldwebel Abd el Abd kein so gläubiger Muslim war wie er, hatte Hakeem daran erkannt, dass Abd el Abd sich um die täglichen Gebetszeiten nicht scherte. Er hatte Hakeem, der wegen der ständigen Regenwolken die Himmelsrichtungen nur ungefähr erkennen konnte, auf die Frage, in welcher Richtung Mekka läge, nur mit einer vagen Handbewegung, die viel Platz für Interpretationen ließ, gesagt:
„Da.“
Hakeem war deshalb nicht sicher, ob seine nach Mekka gerichteten Gebete an dieser heiligen Stätte tatsächlich Gehör finden würden.
Abd el Abd hatte, um Hakeem davor zu schützen, sich versehentlich dorthin zu verirren, auch gezeigt, wo sich die Stadtteile befanden, in denen Sünde und Unzucht herrschten.
Für Hakeem war es ein Beweis der Scheinheiligkeit der Ungläubigen, diese Viertel nach angeblich von ihnen so verehrten Heiligen zu benennen, und das Wort „heilig“ dabei auch noch im Namen zu führen! Er war zutiefst abgestoßen und doch aufs höchste fasziniert von einer verabscheuungswürdigen Gasse, in der üppige Frauen halbnackt in obszönen Posen ihre Körper hinter Schaufensterscheiben feilboten.
Sankt Pauli war eine Welt, die Hakeem al Zaif auf den Reisen mit seinen Eltern noch nirgendwo anders gesehen hatte. Er musste Abd el Abd bitten, ihm zu übersetzen, was sich hinter Begriffen wie Peep-Shows, Life Acts, Eros-Center, Bal Paradox und selbst den Namen von Bars wie „Ritze“ oder „Spalte“ verbarg. Abd el Abds Erklärungen ließen ihn schaudern. All dies war für Hakeem der Inbegriff von Verderbtheit, und gleichzeitig war er von einer seltsamen Erregung erfasst, und noch nächtelang träumte er von dem Gang mit Abd el Abd über die von Neonlichtern erhellte breite Straße.
Abd el Abd, der schon öfter in Hamburg gewesen war, zeigte Hakeem, um ihn zu warnen, noch einen weiteren Stadtteil, ebenfalls nach einem Heiligen der Ungläubigen benannt, diesmal auf der Ostseite des riesigen Bahnhofs. Hier ließen junge Frauen am Straßenrand sich von Männern ansprechen und in nahegelegene Pensionen und Absteigen führen.
Eine Weile, auf dem Rand eines steinernen Brunnens sitzend, sahen sie zu, wie die Frauen mit aufreizenden Posen die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zogen, wie diese mit den Frauen verhandelten, und wie sie dann Arm in Arm in Hauseingängen verschwanden, über denen schmuddelige Schilder mit dem Wort „Hotel“ prangten.
Wie Abd el Abd erklärte, hieß diese Gegend Sankt Georg.
Nach der Abreise Abd el Abds nach Berlin fühlte Hakeem sich einsam wie noch nie zuvor.
Hakeem bin Zaif hatte seine Empfindungen über die ersten Tage seines Aufenthaltes in seinen Laptop getippt, den mit den arabischen Schriftzeichen. Seinen Bericht hatte er an die E-Mail-Anschrift gesandt, die Imam Hadschi Omar ihm gegeben hatte, eine Anschrift mit dem Länderkürzel dk. Hakeem bin Zaif vermutete, dass dk für Dänemark stand, aber er hatte keine Ahnung, wie seine Nachricht den Imam von dort aus erreichen würde.
Heute, achtzehn Tage später, hatte ihn eine Antwort erreicht: Eine ausgedruckte E-Mail, in einem Briefumschlag unter seiner Tür hergeschoben, aber ursprünglich gesandt an die Adresse, die auch er angeschrieben hatte:
„Ein Besucher wird Dich in Kürze aufsuchen und von mir grüßen. Er wird das Wort nennen, über das wir beide gesprochen haben. Große Aufgaben warten auf Dich. Allah sei mit Dir und schütze Dich, HO.“
Diese Nachricht war von einer ganzen Reihe von Geheimdiensten mitgeschnitten worden:
Denen Saudi Arabiens. Die konnten hiermit nichts anfangen, weil sie weder den Absender identifizieren konnten, noch den Adressaten. Absender war eine unbekannte SIM aus den Niederlanden. Die SIM des Absenders hatte sich um 15.44 Uhr in das Netz der Saudi Telekom eingeklinkt. Adressat war eine ebenso anonyme SIM in Dubai. Damit war für die saudischen Dienste die Möglichkeit weiterer Überprüfung vorbei.
Die amerikanischen Dienste waren in der Lage, den weiteren Verlauf der Nachricht zu verfolgen: Von Dubai in die Schweiz, auf eine SIM, die dort von einem ägyptischen Geschäftsmann gekauft und mit einem Guthaben von 1.000 Franken gefüllt worden war. Der Geschäftsmann, der sich beim Kauf der SIM im Laden der Swiss-Telekom in der Passage unter dem Züricher Hauptbahnhof mit seinem auf den Namen Dr. Muhat Dosr lautenden Pass, mit Wohnsitz im vornehmen Kairoer Vorort Heliopolis, ausgewiesen hatte, war allerdings zum Zeitpunkt des Kaufes der SIM schon 6 Monate tot und unter dem Wehklagen seiner Frauen und Kinder längst beigesetzt worden.
Von einer anderen Schweizer SIM, ebenfalls registriert auf den verblichenen Dr. Muhat Dosr, ging die Nachricht einen Tag später nach Kroatien auf die SIM eines vor längerer Zeit als gestohlen gemeldeten Mobiltelefons.
Die schweizerischen Behörden benötigten zwei Tage, um die Nachricht zu übersetzen und abzulegen, nachdem die Bundespolizei in Bern befunden hatte, dass dieser Vorgang nicht die Eidgenössische Republik betraf.
Die kroatischen Behörden konnten mit der Nachricht nichts anfangen. Es gab im Lande haufenweise Muslime, und man nahm an, die Nachricht sei für einen von denen im Kosovo bestimmt.
Tatsächlich jedoch wurde von den amerikanischen Diensten der nächste Versand der Nachricht, diesmal als e-mail aus dem Business Center des Wien Hilton Hotels, rund 150 Kilometer von Zagreb entfernt, festgestellt.
Es war jedoch nicht feststellbar, wer die Computer des Hotels benutzt hatte. Der angegebene Name und die genannte Zimmernummer jedenfalls erwiesen sich als falsch!
Gesandt wurde die Nachricht an eine e-Mail-Adresse in Kopenhagen, die einem Mann zugeordnet war, der vor zwei Jahren als jemenitischer Staatsbürger in Dänemark unter dem Namen Jussuf el Sahdi um politisches Asyl nachgesucht hatte.
Bisher hatten die Dänische Einwanderungsbehörde das Asyl noch nicht bestätigt.
Die Dänen interessierte an el Sahdi lediglich, dass er während des laufenden Prozesses keine Arbeit annahm und das Land nicht verließ.
Da el Sahdi nicht zu dem Personenkreis zählte, den die dänischen Behörden besonderer Überwachung für wert hielt, wurde die Nachricht in den Büros an der Holbergsgade 6, dem Sitz des Innenministeriums, nicht weiter beachtet.
Wer jedoch den Weg der Nachricht von Riad bis Kopenhagen verfolgt hatte, waren die mit enormen Rechnerkapazitäten ausgestatteten Computer in Fort Meade in den USA.
Denen war als erstes aufgefallen, dass die SIM-Karte des Absenders der Nachricht anonym in den Niederlanden gekauft worden war. Als nächstes rechneten sie aus, bei welchen anderen Nachrichten aus Riad in der letzten Zeit eine unbekannte niederländische SIM benutzt worden war. Nur bei einer! Alle anderen niederländischen SIM, die in ganz Saudi Arabien entweder für Mobiltelefone oder PCs Einsatz gefunden hatten, waren bestimmten, mit Namen und Anschriften unterlegten Nutzern zuzuweisen.
Da der Inhalt der Nachricht bekannt war, mussten die Rechner nur noch nach dem identischen Wortlaut suchen. Das ging Ratz-Fatz!
NSA, CIA, selbst das FBI, das ja eigentlich nur innerhalb der USA zu operieren hatte, hatten die Nachricht bis Kopenhagen verfolgt.
Und alle hatten Lieutenant Commander Carl Almaddi aufgefordert, ihnen dringend eine Erklärung zu liefern, was es mit dieser Nachricht auf sich hätte.
Bei diesem umständlichen Weg musste ja wohl etwas faul sein!
„Diese unverfrorene Schickse hatte also wirklich die Chuzpe, Ari aufzufordern, ihre Studienkosten zu garantieren?!“ fragte Itzak Salomonowitz. „Das ist der Gipfel der Dreistigkeit!“
„Nun“, antwortete Ezrah Goldstein. „Sie hat Ari in aller Ruhe auseinandergesetzt, wenn sie zu Graf zurückkehre, würde ihr Vater ihre Kosten nicht mehr übernehmen. Wenn Ari das Interesse hätte, dicht an Graf zu bleiben, ginge das ja wohl am besten über sie.“
„Unverschämtheit!“ sagte Itzak.
„Aber sie hat Recht,“ warf Moishe Shaked ein.
„Trotzdem unverschämt! Weiber!“
„Die Frage, die sich stellt, ist: Was kann die Sadler uns tatsächlich nützen? Was ist sie wert? Graf weiß ja selber nicht, warum die Araber solche Eile an den Tag legen und wer hinter der Finanzierung steckt. Stellt euch vor, wir geben dem Frauenzimmer Geld, und es kommt nichts dabei heraus!“
„Können wir nicht besser Graf selbst unter Druck setzen?“ fragte Itzak. „Du hattest doch gesagt, Ezrah, ihr hättet genug über ihn und seine Geschäfte, um die deutschen Staatsanwälte für ihn zu interessieren. Du hattest Nigeria erwähnt. Ich nehme an, es geht um Schmiergelder? Und in Saudi wird er ja wohl auch ein paar Bakschischs bezahlen.“
„In Saudi lässt er alles durch Mahmut machen. Nachdem die Deutschen seit 1999 nicht mehr international schmieren dürfen, haben sie erstaunliche Energie darein gesetzt, Umwege zu finden. Deshalb ja das Konsortium mit Mahmut. Das Konsortium erhält das Geld für die fertigen Boote. Graf lässt sich von diesem Geld nur das geben, was sein Unternehmen an tatsächlichen Aufwendungen plus Gewinn hat. Der Rest des Geldes, unangemessen viel für das, was der saudische Partner tut, bleibt in Saudi Arabien und geht an Mahmut. Der füllt hieraus die Taschen derjenigen, die geholfen haben, das Geschäft so schnell über die Runden zu bringen. Graf tut also nichts, was in Deutschland nicht legal wäre.“
„Und Nigeria? Das ist doch wohl eins der korruptesten Länder überhaupt?“
„Tja,“ antwortete Goldstein. „Zunächst dachten wir, wir hätten ihn. Graf hat mehrere Berater, die bei Zustandekommen eines Vertrages Geld bekommen. Viel Geld. Sehr viel Geld. Wenn unsere Berechnungen stimmen, geht es in der Summe um runde zehn Prozent.“
„Also Schmiergeld?“ fragte Moishe Shaked.
„Vermutlich. Aber es gibt da eine ganze Anzahl von Verträgen, über kaufmännische Beratung, über technische Beratung, über Hilfe bei der Beschaffung von Ersatzteilen, über Serviceleistungen nach Lieferung der Schiffe. Ich glaube, sechs Verträge insgesamt. Alle mit unterschiedlichen Parteien. Wahrscheinlich sind die dahinter stehenden Figuren dann wieder dieselben. Ich weiß es nicht, es ist aber zu vermuten, auch, wenn alle unterschiedliche Anschriften haben.“
„Kann man rausfinden, ob die selben Typen dahinter stecken?“
„Klar, nur kostet das. Und wir können das ja nun nicht im Sinne der Sicherheit Israels finanzieren.“
„Aber wir könnten den deutschen Behörden einen Tipp geben!“
„Graf hat das ganz pfiffig gemacht. Schmiergeld wird immer da vermutet, wo die Zahlung vom Erfolg abhängt. Also, kein Erfolg, kein Geld, wenn Erfolg, dann viel Geld. Graf hat die Zahlung so vom Erfolg abgekoppelt, dass manche Verträge nur in Kraft treten, nachdem er das Geschäft an Land gezogen hat. Also, ohne den vorherigen Kauf der Schiffe wird zum Beispiel der Vertrag über Serviceleistungen nach Lieferung der Schiffe gar nicht erst rechtskräftig.“
„Haarspalterei! Pilpul!“ rief Shaked.
„Ja, aber Graf hat noch ein Übriges getan. Er ist mit seinen ganzen Verträgen zu seinem Finanzamt gestiefelt und hat sich dort bestätigen lassen, dass alle seine Beratungsverträge in Ordnung sind und er alle diese Aufwendungen als steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben anmelden kann. Jetzt müsste also erst mal nachgewiesen werden, dass seine Berater tatsächlich Amtsträger in Nigeria bestechen.“
„Aber da kann man doch mit dem Finger dran fühlen!“
„Ja. Aber wir können es nicht nachweisen. Nicht, ohne dass wir uns wirklich dahinter klemmen, und das kostet erst mal Geld. Wir werden weiter die Ohren offen halten und aufpassen, ob wir Graf erwischen.“
Alle drei sahen sich an.
„Noch was zu Graf?“ fragte Salomonowitz.
„Ja, er will in den USA um ein Sonar für das erste U-Boot nachfragen.“
„Die deutschen Geräte sind doch genauso gut, wenn nicht besser.“
„Richtig, aber er kriegt so schnell keines. In den USA liegen die im Lager. Er korrespondiert fleißig mit Washington.“
„Aus Riad irgendwas, Moishe?“
„Ahmed Falouf hat über Siddiqui Kontakt zu einem der Pakistani bekommen, die die Saudis ausbilden sollen. Ein Leutnant Naqui ul Haq. Wir haben nur ein dünnes Dossier über ul Haq. Achtundzwanzig Jahre alt, U-Bootfahrer, Navigationsexperte. Ich habe den Residenten in Islamabad aufgefordert, mehr herauszufinden. Laut Falouf ist Siddiqui in der Lage, ul Haq abzuschöpfen, will aber dafür zweitausend Dollar mehr im Monat.“
„Sagt Siddiqui oder Falouf?“
„Falouf sagt, dass Siddiqui das sagt.“
„Und kein Majed Akhad mehr in der Nähe, der das überprüfen könnte?“
Moishe Shaked wiegte den Kopf.
„Falouf wurde unberechenbar. Akhad war zu wertvoll, als dass ich ihn hätte opfern können. Er ist nicht mehr in Saudi Arabien.“
Keiner seiner beiden Kameraden stellte die Frage, wo Majed Akhad jetzt eingesetzt wurde.
Rupert Graf traf sich mit Sheikh Mahmut in dem mit Efeu überwucherten Innenhof des Hotels Plaza Athène in Paris. Mahmut hatte zwar eine Wohnung an der Avenue Foch in Sichtweite des Arc de Triomphe, aber das Plaza Athène war auf Gäste aus dem Morgenland bestens eingestellt.
Das Treffen war auf Bitten Rupert Grafs zustande gekommen.
Nach dem üblichen Geplänkel über das Wetter, den Sommer, die Situation in Nahost, in Mittelost, in Afghanistan, über die besten Tauchgebiete der Welt, über die Vorteile eines Porsche Cayenne kamen sie auf ihr Geschäft erst zu sprechen, nachdem die Hauptspeise gegessen war.
Es war –zu Grafs Zufriedenheit – Mahmut, der fragte, warum Graf um das Gespräch nachgesucht hatte.
„Wissen Sie, was ein Sonargerät ist?“ fragte Graf.
„Ja. Etwas, um unter Wasser zu lauschen.“
„Ein wenig komplizierter ist das schon,“ antwortete Graf. „Es gibt an Bord von Marineschiffen sowohl ein passives als auch ein aktives Sonar.“
Mahmut machte nicht den Eindruck, als ob er sich für Sonare besonders interessierte. Er las stattdessen in der Dessertkarte.
„Das passive Sonar besteht aus einer Reihe von am Bootskörper angebrachten Sensoren, die die Schallwellen aller Geräusche unter Wasser auffangen und analysieren,“ erklärte Graf. „Das aktive Sonar sendet selbst eigene Schallwellen aus und analysiert, ob und wie diese Wellen von einem Gegenstand zurückgeworfen werden. Die Schallsignale werden in Lichtsignale umgewandelt und sind wie auf einem Radarschirm als leuchtende Punkte auf einem Monitor zu erkennen.“
„Ja und?“ fragte Mahmut. Graf hätte genauso gut über die Qualität der Zylinderkopfdichtung des Motors von Mahmuts vor dem Hotel wartenden Maybach referieren können. Die wäre ihm genauso egal gewesen.
„Wir haben ein Problem mit dem Passivsonar für das erste Boot. Ein Lieferproblem,“ sagte Graf.
Mahmut ließ die Dessertkarte theatralisch auf den Tisch fallen.
„Was soll das heißen, Mr. Graf?“ fragte er in scharfem Ton.
„Wir hatten für das erste Boot wie für die anderen auch ein Produkt aus Deutschland vorgesehen. Die deutschen Sonarsysteme zählen zu den besten, die es gibt. Allerdings können wir in der Kürze der Zeit für dieses Boot kein deutsches Passivsonar bekommen. Der Zusammenbau und die Testphasen dauern länger als die Lieferzeit des Bootes selbst.“
Mahmut sah auf einmal aus, als wolle er im nächsten Moment platzen. Der Kopf hochrot, hörbar nach Luft schnappend.
„Sie haben sich vertraglich verpflichtet, Mr. Graf, ein überholtes und modernisiertes Boot abzuliefern. Also tun Sie das gefälligst!“ zischte Mahmut in einer Lautstärke, deren Aggressivität nicht zu überhören war.
Die Damen an den Nachbartischen sahen neugierig zu Graf und Mahmut herüber.
Jetzt las Graf interessiert in der Dessertkarte.
„Darf ich bitte eine Erklärung haben!“ forderte Mahmut.
Graf winkte dem Kellner, der in respektvoller Entfernung gewartet hatte und bestellte sich eine Crème brulée mit frischen Erdbeeren. Sheikh Mahmut war augenscheinlich der Appetit vergangen. Er wollte nur einen Espresso. Und einen Whisky.
„Unser Vertrag besagt, Exzellenz, dass wir die Systeme an Bord des von Pakistan zurückgegebenen Bootes modernisieren und diejenigen ersetzen, die von den Experten meines Unternehmens als sinnvollerweise erneuerbar angesehen werden. Wir könnten Ihnen und der Königlich Saudischen Marine also ganz einfach sagen, das Passivsonar ist noch bestens und bedarf nicht des Austauschs. Sie hätten nicht mal was gemerkt. Die Geräte funktionieren einwandfrei, und manche Marine wäre stolz, so etwas an Bord zu haben. Gerade bei einem solch kleinen Boot!“
Graf nahm gelassen einen Schluck aus seinem Weinglas.
„Ich würde Ihnen aber gerne das Beste liefern, was es gibt. Ein Sonarsystem mit größerer Reichweite, dass schneller als andere aufgefangene Geräusche analysiert, die akustischen Signale umwandelt in visuelle, und der Mannschaft eine schnellere Situationsanalyse erlaubt.“
„Wenn Sie keine Lösung haben, was stehlen Sie mir dann meine Zeit?“ fragte Mahmut frech. Graf beschloss, sich nicht alles von dem Kerl bieten zu lassen.
„Ich habe eine Lösung. Aber wenn die Sie nicht interessiert, ist es auch gut. Sollte die Marine sich später beschweren, werde ich sagen, der saudische Konsortialpartner habe das Problem für unbedeutend gehalten.“
Graf gab dem Kellner ein Zeichen, dass er zahlen wolle.
Mahmut gab dem Kellner ein Zeichen, er solle mit der Rechnung noch warten.
„Wie sieht Ihre Lösung aus?“ fragte Mahmut, etwas weniger aufgeregt.
„Nun, es gibt weltweit nur eine Handvoll Hersteller von wirklich erstklassigen Sonaren. Deutsche, Franzosen in Zusammenarbeit mit den Niederländern, Amerikaner. Sowohl die französischen als auch die amerikanischen Fabrikate sind bei der Saudischen Marine bekannt, da die in Frankreich und USA beschafften Überwasserschiffe damit ausgerüstet sind. Selbstverständlich sind die auf Überwasserschiffen eingesetzten Geräte nicht so aufwendig und nicht so leistungsstark wie die auf U-Booten.“
„Ja und?“
„Wir könnten ein deutsches Gerät älterer Bauart einsetzen, aber das ist dann nicht das modernste am Markt. Franzosen und Holländer haben ein ähnliches Problem wie wir. Die neueste Generation ist noch in der Erprobung, und die wird bis zum Abliefertermin des Bootes noch andauern. Mein Vorschlag ist, ein amerikanisches Gerät zu nehmen. Die US-Navy hat erprobte Geräte mit hoher Leistungsfähigkeit auf Lager. Die Amerikaner produzieren angesichts ihrer großen Schiffsserien immer auf Vorrat.“
„USA? Das macht Prinz Mirin niemals mit,“ antwortete Mahmut. „Er hasst die Amerikaner aus tiefstem Herzen! Sie wissen, er zahlt die Boote.“
„Ja und?“ fragte Graf. „Boykottiert er deshalb amerikanische Produkte? Fliegt er in keinem Jumbo-Jet von Boeing? Nimmt er keine Medikamente, die in den USA entwickelt wurden. Hat er nie Viagra ausprobiert?! Exzellenz, ich bitte Sie, bleiben wir pragmatisch!“
Mahmut sah Graf ernst an.
„Mirin fliegt nicht im Jumbo, weil er einen Airbus 340 besitzt, nur für sich allein. Medikamente? Weiß ich nicht. Viagra? Da steht mir kein Urteil zu. Ich kann nur wiederholen, er hasst Amerika und alles, was von dort kommt!“
Mahmut sah aus, als erwarte er, dass Graf nach dem Grund fragte.
Der dachte aber nicht daran, sondern sah Mahmut nur stumm an.
„Ihnen in Europa ist nicht bewusst, dass zahlreiche Mitglieder des saudischen Königshauses mit Frauen aus unseren Nachbarländern verheiratet wurden. Es gibt eine Vielzahl von Prinzen, die, aus Gründen des politischen Zusammenhaltes, mit Frauen aus den ersten Familien des Iran, des Irak, aus Syrien, Pakistan oder Afghanistan die Ehe eingegangen sind. Hätte man uns Araber gelassen, wir hätten die Konflikte zwischen Iran und Irak, zwischen Irak und Kuwait, selbst den letzten Angriff auf den Irak als innerfamiliäre Angelegenheiten regeln können. Im weiteren Familienkreis, sozusagen. Aber Amerika und Europa mussten sich ja unbedingt einmischen. Mit der Konsequenz von Hunderttausenden von Toten. Nur, weil man keine Geduld hatte!“
Mahmut winkte dem Kellner, um sein Whiskyglas nachgefüllt zu bekommen.
„Eine von Mirins Ehefrauen, Yasmin, zählte zur Verwandtschaft von Saddam Hussein. Irgendwas um mehrere Ecken. Also keine Tochter oder Nichte, aber die Nichte einer der Frauen eines seiner Brüder. Das reicht bei uns, um Verwandtschaft nicht zu vergessen.
Als Mirin die Frau heiratete, war sie 14 Jahre alt. Mirin verliebte sich in sie. Weil Yasmin schon die Haare einer Frau hatte, übte Mirin keine Zurückhaltung, und mit fünfzehn gebar sie ihm einen ersten Sohn. Es folgten zwei weitere Söhne.
Mirin war unsagbar stolz und glücklich. König Fahd persönlich beglückwünschte ihn mit warmen Worten zu dieser Verbindung und zu Mirins Beitrag zur Festigung der Beziehungen zwischen beiden Ländern.
Yasmin, die Kinder und ihre Begleitung waren zu Besuch bei Yasmins Familie in Bagdad, als die amerikanischen Bombardements begannen. An eine Ausreise war nicht zu denken!
Am 30. März 2003 haben die Amerikaner irrtümlich ein Wohnviertel in Bagdad bombardiert. Eines der sogenannten besseren Viertel. Yasmin, die drei Buben, Yasmins Mutter und ihr Bruder als Begleiter, alle kamen ums Leben. Alle ausgelöscht. Zusammen mit vielen anderen Menschen. Durch einen technischen Fehler. Durch ein Versehen. Die Leichen waren so zerstückelt, es war nicht mehr feststellbar, welches Körperteil zu welcher Person gehörte. Prinz Mirin hatte nicht einmal Gräber, an denen er hätte trauern können.“
Sheikh Mahmut kippte den inzwischen servierten Whisky in einem Zug herunter.
„Und Sie glauben allen Ernstes, Mr. Graf, dass ich Prinz Mirin überzeugen kann, ausgerechnet ein amerikanisches Produkt in sein neuestes Lieblingsspielzeug einbauen zu lassen?“
Rupert Graf blieb eine Weile stumm. Dann sagte er:
„Es wird wohl das Beste sein, wir lassen das alte Sonar im Boot. Es ist ein deutsches Produkt und brauchbar. Da Saudi Arabien dieses Boot wohl nicht dazu benutzen will, einen Krieg anzuzetteln, sollte dieses Sonar ausreichen. Man kann ja später dann immer noch etwas Moderneres einbauen.“
Scheich Mahmut sah Graf nachdenklich an.
Schließlich antwortete er:
„Ich werde mit Prinz Mirin sprechen.“
Lieutenant Commander Carl Almaddi hatte zunächst überprüft, wo genau in Riad sich der Absender der Nachricht aufgehalten hatte, als sie nach Dubai geschickt worden war.
Das Gebiet sollte eigentlich wegen der weitgehend rechteckig angelegten modernen Wohn- und Büroviertel leicht ausfindig gemacht und analysiert werden können.
Tatsächlich jedoch hatte sich das Gerät in einem der älteren Viertel Riads mit gewundenen Straßen und Gassen in das Netz der Saudi Telekom eingeloggt. Dieses Gebiet lag, wie Almaddi bei dem Vergleich mit einem Stadtplan feststellte, östlich von der Großen Moschee. Es war der gleiche Bezirk, in dem der Anrufer aus Rawalphindi den Prediger erreicht hatte.
Almaddi rief sich zunächst Google-Earth auf seinen Bildschirm und zoomte sich auf diese Gegend Riads ein. Er hatte zwar Zugang zu exzellenten militärischen Satellitenaufnahmen, aber mit Google-Earth ging es ohne die mehrfache Eingabe von Passwörtern und Zugangscodes erst mal schnell und unkompliziert.
Wie Carl Almaddi sah, war dies ein Stadtviertel mit überwiegend alten Geschäftshäusern, Läden, eng bebaut, mit Gebäuden selbst in den Innenhöfen. Grün schien es in dieser Gegend nicht zu geben. Lediglich auf dem Platz vor der Großen Moschee waren Palmen zu erkennen, und auf dem Mittelstreifen einer der größeren Straßen.
Hier befand sich keines der größeren Hotels wie dieses, aus dem der Prediger neulich mit seinem niederländischen Handy nach Pakistan telefoniert hatte. Lieutenant-Commander Carl Almaddi blieb nun doch nichts anderes übrig als sich in das militärische Spionagecomputernetz einzuloggen. Nachdem er sich mehrere Minuten lang mit der Eingabe von Identifizierungs- und Authentifizierungscodes herumgeplagt hatte, stand ihm die Welt offen.
Als Erstes rief er sich die Liste der öffentlich zugänglichen Gebäude und Anschriften auf, die in diesem Stadtviertel Riads registriert waren:
Mehrere kleinere Moscheen, einige Arztpraxen, eine Vielzahl von Geschäften und Läden für den Verkauf von Textilien und Kleidung, Schuhen, Lebensmitteln. Eine Apotheke.
Mehrere Büros kleiner Handelsgesellschaften.
Zwei nicht markengebundene Autowerkstätten.
Zwei Kindergärten, getrennt nach Geschlechtern.
Eine Koranschule, angegliedert an eine der Moscheen.
Eine Koranschule!
Die Satellitenbilder, die Lieutenant-Commander Carl Almaddi zur Verfügung standen, waren um Klassen besser und deutlicher als die bei Google-Earth.
Almaddi konnte sich soweit heranzoomen, dass er die Schriftzüge über den Geschäften, selbst Straßenschilder und Hausnummern lesen konnte, soweit sie nicht im Schatten lagen.
Da die Frauen in den Straßen Burkhas trugen und die Männer fast ausnahmslos Kufiyas, würde jedoch die Identifizierung einer bestimmten Person unmöglich sein.
Die Zeitspanne, in der ein Satellit eine bestimmte Gegend überfliegt und diese aufnehmen und filmen kann, ist recht kurz. Je nach Winkel und Flughöhe stehen zwischen 25 und 45 Minuten zur Verfügung. Allerdings kreisten über dem Großraum Afghanistan, Iran, Irak, Arabien, Israel gleich mehrere Satelliten, die zum Teil von Süd nach Norden unterwegs waren, von Ost nach West, von Südsüdost nach Nordnordwest. Dadurch hatten die amerikanischen Satelliten permanent Einblick in das, was am Boden geschah.
Solange Tageslicht herrschte.
Selbstverständlich gab es auch Aufzeichnungen aus Nachtstunden, mittels Infrarot, mittels Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräten. Allerdings waren diese Bilder nur geeignet, Bewegungen von Fahrzeugen, Fahrzeugkolonnen, großer Menschenmengen zu erkennen.
Da Lieutenant-Commander Carl Almaddi wusste, um welche Tageszeit an welchem Tag die Botschaft, die dann auf so umständlichem und dadurch verdächtigem Weg nach Dänemark gelangen sollte, in das Netz der saudischen Telekom eingespeist worden war, rief er sich die verfügbaren Video-Aufzeichnungen dieses Tages auf seinen PC.
Dabei konzentrierte er sich zunächst auf die Anschrift, unter der der Prediger Hadschi Omar bin Othman in Riad registriert war.
Er hatte brauchbare Aufzeichnungen ab dem Moment des Sonnenaufgangs.
Die sah er im Schnelldurchlauf an.
Erst nach dem Mittagsgebet hatte eine männliche Person das Haus Hadschi Omars verlassen, mutmaßlich der Prediger selbst. Von Figur und Statur her musste dies Omar sein. Almaddi konnte sehen, wie der Mann in ein auf der Straße vor dem Haus geparktes weißes Fahrzeug stieg.
Carl Almaddi hätte jetzt auf den zahlreichen Aufnahmen der NASA verfolgen können, wenn auch aus mehreren unterschiedlichen Blickwinkeln, wie der Prediger in einem 3er-BMW älterer Bauart bis genau zu der Koranschule fuhr, die Almaddi zuvor entdeckt hatte. Dies hätte jedoch erheblich länger gedauert als die Fahrt selbst, da der Computer die von den verschiedenen Satelliten gemachten Aufnahmen hätte abrufen und berechnen müssen.
In der engen Gasse gab es keine Parkmöglichkeit: Es standen jedoch mehrere Wagen in dem Vorhof der Moschee. Alle waren weiß.
Almaddi rief sich die Aufnahmen der Moschee auf den Bildschirm, die eine halbe Stunde nach dem Aufbruch von Hadschi Omar entstanden waren. Dies, so schätzte Almaddi, wäre die Fahrtzeit, die der Prediger bis zu der Moschee benötigt haben würde. Tatsächlich war auf den ersten Bildern kein BMW zu erkennen. Um Zeit zu sparen, rief Almaddi Bilder auf, die im Abstand von jeweils zwei Minuten entstanden waren. Plötzlich war ein weiteres Fahrzeug im Hof der Moschee. Ein BMW. Almaddi konnte das Nummernschild so weit heranzoomen, dass es lesbar wurde. Mehrere Klicks auf seinem Computer, und Almaddi wusste, das Fahrzeug war auf den Hadschi Omar zugelassen.
Lieutenant-Commander Carl Almaddi überprüfte nun die Figuren, die in etwa um diese Zeit die Koranschule besucht hatten.
Im Schnelldurchlauf seiner Videobilder konnte er erkennen, dass am Vormittag niemand dort ein oder aus ging.
Erst nach der Mittagszeit kamen etliche Besucher.
Ausschließlich Männer.
Almaddi zoomte die Personen heran.
Wegen der Umhänge und Kufiyas war es unmöglich, Gesichter zu erkennen. Almaddi gab trotzdem einen Befehl in seinen PC, erkennbare Merkmale der Gesichter zu vergrößern und abzugleichen mit denen von Personen, die von US-Geheimdiensten schon einmal irgendwo aufgezeichnet worden waren.
Das jedoch würde dauern. Trotz der enormen Rechnerkapazität erwartete Lieutenant-Commander Almaddi ein Ergebnis nicht vor Ablauf mehrerer Tage. Was immer hierbei herauskäme, würde an die Geheimdienste befreundeter Staaten gegeben werden mit der Bitte, ihrerseits eine entsprechende Prüfung vorzunehmen.
Um nicht schwindelig zu werden angesichts der enorm vergrößerten Bilder, die vibrierten wie der Blick durch ein mit zittriger Hand gehaltenes Fernglas, verkleinerte Almaddi den Grad des Zooms. Er schaltete auf schnellen Vorlauf. Wie in einem der alten Filme aus der Stummfilmzeit sah er Gestalten mit ruckenden Bewegungen in den Eingang der Koranschule gehen oder dort herauskommen.
Plötzlich stutzte er.
Er ließ die Aufnahme zurücklaufen und startete sie erneut.
Ein Mann in Uniform, der die Koranschule betrat.
Almaddi drückte die Pause-Taste und hielt das Bild an.
Er zoomte die Person heran.
Die Uniform war keine der Streitkräfte Saudi Arabiens.
Es würde eine Weile dauern, bis das Computersystem den Mann mit der notwendigen Schärfe so weit herangezoomt haben würde, dass Details erkennbar würden. Almaddi hatte Zeit, sich an dem Kaffeeautomaten im Flur des Büros eine Tasse füllen zu lassen.
Nun ist der normale Bürger der Ansicht, die Farben der Uniformen seien weltweit mehr oder weniger einheitlich:
Das Heer Braun, Grün, oder Grau.
Luftwaffe Graublau.
Marine: Weiß oder Dunkelblau.
Lieutenant-Commander Almaddi wusste es besser und war deshalb nicht überrascht, dass die Person, die er auf seinen Aufzeichnungen beim Betreten der Koranschule beobachten konnte, eine khakifarbene Uniform trug und dennoch eindeutig Rangabzeichen der Marine auf dem Uniformhemd hatte.
Nach weiterem Suchen und bei näherem Hinsehen: Der Pakistanischen Marine.
Der normale Bürger ist sich nicht wirklich bewusst, dass die Kameras von Spionagesatelliten in der Lage sind, aus dreihundert Kilometern Höhe festzustellen, was in der vor ihm auf dem Tisch seiner Terrasse liegenden Zeitung steht. Was er auf eine Ansichtskarte schreibt. Ob er in seiner Tasse Tee oder Kaffee hat. Vorausgesetzt, er befindet sich im Freien.
Lieutenant-Commander Carl Almaddi musste die Aufnahmen mehrerer Satelliten miteinander abgleichen, um die winzigen Abzeichen auf der Spange an der Brust des aufgezeichneten Uniformierten erkennen zu können, welche die bisherigen Verwendungen des Mannes anzeigten.
Etwas blinkte grell in der Sonne wie ein Blitz.
Almaddi schaltete auf nacheinander ablaufende Standbilder.
Auf der achten oder neunten Aufnahme war es nicht mehr zu übersehen:
Der Mann hatte die wenige Zentimeter lange stilisierte Brosche mit der Abbildung eines U-Bootes auf der Brust.
Der Mann war U-Bootfahrer!
Lieutenant Commander Carl Almaddi war jetzt hellwach.
Als erstes klinkte er sich in die Datenbanken der dänischen Telekom ein. Da diese wie fast alle großen Dienstleistungsgesellschaften weltweit insbesondere für Rechnungslegung und Zahlungsverkehr mit amerikanischen Computersystemen arbeitet, war dies kein Problem. Die Entwickler der amerikanischen Computerprogramme arbeiten aufs Engste mit US-Regierungsstellen zusammen. Deren Experten bauen unerkennbare Nebenprogramme ein, die den US-Behörden Zugriff auf alle möglichen, eigentlich dem Datenschutz unterliegenden Informationen erlauben.
Almaddi interessierte sich für die elektronische Post von Jussuf el Sahdi, dem Adressaten der Mitteilung in Kopenhagen. Nachdem alle europäischen Behörden auf Druck der Vereinigten Staaten die Verbindungsdaten sämtlicher Telefonnutzer für mindestens 60 Tage speicherten, konnte Carl Almaddi in aller Ruhe nachvollziehen, von wem Mr. Jussuf el Sahdi Post bekommen oder wem er geschrieben hatte. Die meisten Mitteilungen kamen von und gingen an e-mail-Adressen in Dänemark. Einige Mitteilungen gingen an Anschriften im Jemen.
Almaddi ließ seinen Computer alle diese mails aufrufen und abspeichern. Er überflog die Mitteilungen, die sich auf den ersten Blick lasen wie die Post zwischen Familienmitgliedern und Freunden. Aber die Rechner in Almaddis Behörde hätten die Möglichkeit, die Texte auf bestimmte Kriterien hin zu prüfen, die den Verdacht nahe legten, hier würde ein Code benutzt.
Eine Nachricht war eingegangen aus Deutschland, aber der Absender hatte einen arabischen Namen: hakeem.binzaif. Auch diese Adresse kam in Almaddis Rechner. Und auch diesen Text rief Almaddi sich auf.
Die Mitteilung war die blumige aber jammervolle Darstellung eines offensichtlich unter Heimweh leidenden Mannes, aufgrund der Wortwahl vermutete Almaddi, eines jungen Mannes. Offenbar wohnte der Mann in Hamburg, weil er diese Stadt in seinem Text mehrmals erwähnte. Gerichtet war der Brief an seinen „zutiefst verehrten weisen Lehrer und geistlichen Vater“.
Nun gut. Jussuf el Sahdi hatte, bevor er den Jemen verließ, dort als Lehrer gearbeitet.
Erstaunlich fand Almaddi jedoch, dass Jussuf die Nachricht aus Deutschland unmittelbar an eine e-mail-Anschrift in Dubai weitergeleitet hatte. Soweit Almaddi herausfinden konnte, gehörte diese Adresse einer saudischen Handelsgesellschaft, die in Dubai ein Büro unterhielt.
Aber auch hier war die Nachricht nicht geblieben. Sie war weitergeleitet worden an eine e-mail-Adresse in Saudi Arabien.
Jetzt wurde es spannend.
In religiöser Hinsicht leben die Saudis wie im Mittelalter. Es gibt immer noch öffentliche Auspeitschungen und Hinrichtungen, vor allem für Verfehlungen im moralisch-sittlichen Bereich. Aber trotzdem hat auch hier die Moderne Einzug gehalten.
Auch Verwaltungen von Moscheen haben Internetadressen. Und Web-Seiten.
Und die Anschrift, an welche die Mitteilung des jungen Mannes gegangen war, war ganz eindeutig einer Moschee zuzuordnen.
Lieutenant Commander Carl Almaddi fand die Web-Seite sofort unter dem auch in der e-mail-Adresse genannten Namen.
Sobald sich die Seite öffnete, kam ihm die Abbildung der Moschee bereits bekannt vor. Er musste nicht einmal seine anderen Bilder zum Vergleich heranziehen. Dazu hatte er sich heute schon zu sehr mit dem Gebäude und seiner Umgebung in der Altstadt Riads beschäftigt.
Auf der Web-Seite waren auch die Prediger genannt, die in der Moschee und ihrer angeschlossenen Schule lehrten.
Neben mehreren anderen würdig aussehenden Herren mit den für Imame typischen Kopfbedeckungen und langen Bärten prangte hier auch das Porträt von Imam Hadschi Omar bin Othman.
Was Lieutenant Commander Carl Almaddi jetzt noch herausfinden musste, war, um wen es sich bei dem Schreiberling in Hamburg handelte. Wahrscheinlich gab es Hunderte Hakeems bin Zaif in Saudi Arabien.
Erst las er noch einmal in aller Ruhe die Mitteilung aus Deutschland.
Dann klinkte er sich in die Datei in Brüssel, Belgien, ein, in der sämtliche Einreise- und Aufenthaltsgenehmigungen für die Schengen-Staaten gespeichert sind. Mehrere in den achtziger und neunziger Jahren in der kleinen Ortschaft Schengen in Luxemburg unterzeichneten Abkommen legten fest, dass innerhalb der Europäischen Union die inneren Grenzen entfielen und dass jemand, der von außerhalb Europas kam, sich innerhalb der EU frei bewegen kann.
Hier in Brüssel reduzierten sich die genannten Hakeems bin Zaif auf wenige Dateien.
Almaddi interessierte sich nur für die Visa, die innerhalb der letzten drei Monate an saudische Staatsbürger dieses Namens erteilt worden waren.
Das waren genau zwei.
Ein Hakeem bin Zaif bin Ahmat, Kaufmann aus Jeddah, 46, Jahre alt, und Hakeem bin Zaif al Sultan, Student der Ingenieurwissenschaften in Hamburg. Das Visum war ohne jedwedes Problem erteilt worden. Handelte es sich doch bei Hakeems Vater um einen der höchsten militärischen Würdenträger des Königreiches Saudi Arabien, Vizeadmiral Zaif al Sultan!
In diesem Augenblick läutete Almaddis Telefon. Als er abhob, hatte er Peter Huntzinger aus dem Royal Saudi Navy Support Office in der Leitung.
„Carl, du hast dich neulich dafür interessiert, ob Saudi Arabien U-Boote besäße. Letzte Information: Die haben gerade eine Reihe von Klein-U-Booten in Deutschland bestellt. Wir überlegen, ihnen einige Ausrüstungen zur Verfügung zu stellen.“
Rupert Graf, gerade am Nachmittag wieder gelandet nach einem zweitägigen Besuch in Buenos Aires und wegen der Zeitverschiebung trotz der fortgeschrittenen Stunde in Düsseldorf immer noch hellwach, traf sich mit Sabine Sadler im Restaurant Kitaro in der Nähe seiner Wohnung.
Sabine hatte ihn zuhause aufsuchen wollen.
Graf hatte dies abgelehnt.
Er war müde. Er war erschöpft. Er wollte nur noch eine Kleinigkeit essen und dann in sein Bett.
Rupert Graf hatte sich auch nur auf dieses Treffen eingelassen, weil Sabine wiederholte und immer drängendere Nachrichten auf seinen Anrufbeantwortern hinterlassen hatte; und da er noch so aufgedreht war von dieser kurzen aber weiten Reise. Da war es egal, ob er Babysepia in Knoblauchsoße aß oder sich schlaflos in seinem Bett wälzte.
Das Gespräch mit Sabine Sadler verlief zäh.
Rupert Graf war erstaunt, wie diese wenigen Wochen, besser gesagt, wenigen Tage der Trennung sie einander entfremdet hatten.
Natürlich war sie noch immer ein saftiges und attraktives junges Frauenzimmer!
Aber die Unbeschwertheit ihrer Beziehung war weg.
Graf fragte nach Sabines Familie, die er nie kennen gelernt hatte und die, wenn es sich vermeiden ließe, er auch nie kennen lernen würde.
Er fragte nach dem Bräutigam.
„Die Verlobung habe ich aufgelöst,“ antwortete Sabine. „Das Thema ist durch! Ich will zurück zu dir.“
„Warum?“
Rupert Graf liebte den irgendwann gelesenen Spruch: „Ich bin ja nicht eitel, auch wenn ich allen Grund hätte, es zu sein“!
„Du hast nie gemerkt, wie sehr ich dich liebe,“ sagte Sabine leise, Grafs Hand auf dem Tisch mit ihren beiden Händen umklammernd. „Ich würde so gerne bei dir bleiben.“
Sie sah ihm tief in die Augen. „Auch heute Nacht.“
Ahmed Falouf hatte eine ganze Reihe von Filmen über den Geheimagenten James Bond gesehen. Viel hatte er von den Geschichten nicht verstanden. Die arabischen Untertitel übersetzten die Dialoge nur unzureichend. Ahmed konnte nicht wissen, dass die Stories auch deshalb so schwer nachvollziehbar waren, weil die arabische Zensur alle Szenen mit leichtbekleideten oder ihr Haar offen tragenden Frauen, alle Flirt- und Kussszenen sowieso und alle weiteren Szenen, die das Auge eines gläubigen Muslim hätten beleidigen können, herausgeschnitten hatte.
Von daher dauerten die Filme nicht allzu lang.
Ahmed Falouf begann jedoch inzwischen, sich selbst wie eine Gestalt aus einem James Bond-Film zu fühlen.
Als richtiger Spion.
Allerdings war er keineswegs froh über dieses Gefühl.
Einmal im Monat kam es zu einem persönlichen Kontakt mit dem Mann, der sich als sein Führungsoffizier ausgegeben hatte. Die Treffen kamen an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Uhrzeiten zustande:
Mal in einer Moschee, mehrmals im Menschengewühl des alten Basars von Riad.
Zu zwei Treffen war der Mann in Begleitung einer Frau erschienen, von der Ahmed jedoch wegen des Schleiers nichts gesehen hatte. Diese beiden Treffen hatten in Restaurants stattgefunden, hinter den Spanischen Wänden, hinter denen Gäste in Begleitung ihrer Ehefrauen und Töchter speisten. Bevor der Kellner servierte, wurden die Familien hinter der Wand gewarnt, so dass die Frauen ihre Schleier herunterlassen konnten.
Der Mann, der sich als sein Führungsoffizier vorgestellt hatte, sah aus wie einer der zahlreichen muslimischen Ausländer, die in Saudi Arabien lebten und als Anwälte und Kaufleute tätig waren. Er schien das Leben eines Einheimischen zu führen. Arabisch sprach er mit einem Akzent, der aus Jordanien oder Palästina stammen konnte. Jedes Mal trug er Burnus und Kufiya.
In der Moschee hatte er neben Ahmed gekniet und die heiligen Gebete fehlerfrei mitgesprochen.
Ahmed wusste nicht einmal mit Sicherheit, ob der Mann tatsächlich ein Israeli war. Was ihn vermuten ließ, dass es sich um einen Israeli handelte, waren die profunden Kenntnisse um Ahmeds Familie in Ramallah und die Drohungen, was seinen Verwandten passieren würde, wenn er nicht mitarbeitete.
Von dem Mann wusste Ahmed keinen Namen und schon gar keine Anschrift.
Die Übergabe des für Siddiqui bestimmten Geldes an Ahmed war ein Mal in der Moschee und die beiden anderen Male bei den Treffen im Restaurant erfolgt.
In der Moschee hatte der Mann Ahmed beim Herausgehen mitten im Gedränge der Gläubigen unauffällig den Umschlag mit dem Geld zugesteckt. Im Restaurant hatten sie wegen der Paravents diese Rücksicht nicht nehmen müssen.
Ahmed Falouf hatte in dem toten Briefkasten für ihren Austausch von Nachrichten und USB-Sticks die Aufforderung vorgefunden, sich mit dem Mann zu treffen. Hierzu hatte es drei unterschiedliche Zeitvorgaben gegeben, denn im Vorhinein konnte niemand wissen, wann der General seinen Fahrer benötigen würde. Der Mann, so vermutete Ahmed, würde entweder zu allen drei Zeitpunkten am vorgesehenen Ort sein, oder aber, da, wie Ahmet vermutete, das Fahrzeugs des Generals unter Beobachtung stand, wissen, ob Ahmed Dienst als Chauffeur tun würde.
Heute trafen sie sich nach dem Nachmittagsgebet in dem gerade wieder öffnenden Alten Basar.
Das hatte den Vorteil, trotz der einsetzenden Dämmerung auf der noch leeren Gasse sehen zu können, dass der andere allein gekommen war. Sie mussten jetzt nur noch einander im Auge behalten, als die Händler die Rollläden und Gitter vor ihren Geschäften wieder hochzogen und der Markt sich mit dem üblichen Menschengewimmel füllte.
Kurz darauf standen sie nebeneinander und betrachteten die Auslage im Fenster eines Schuhgeschäftes.
Inzwischen war es dunkel. Markt und Gassen waren weniger durch die spärlichen Laternen als durch das aus den Läden und Buden nach außen fallende elektrische Licht erhellt.
„Was den neuen Freund aus Pakistan angeht, hier ist die erste Rate,“ sagte der Mann ohne Begrüßung oder ein Wort der Freundlichkeit und drückte Ahmed einen Umschlag in die Hand. „Eintausend Dollar.“
„Aber er will doch…“ versuchte Ahmet zu protestieren.
„Wir wollen erst sehen, was er liefert!“
Ahmed Falouf sah im Weggehen, dass der Mann das Schuhgeschäft betrat wie ein Kunde, der in der Auslage etwas für sich entdeckt hatte.
Während Ahmed sich seinen Weg durch die Menge der Menschen bahnte, jubelte er innerlich. Siddiqui wusste nichts von dem Geld, das Ahmed für den Kontakt mit Naqui zusätzlich verlangt hatte. Ahmed Falouf war überzeugt, seiner Hochzeit mit Zaidah wieder einen Schritt näher gekommen zu sein.
Hakeem bin Zaif mochte seine Deutschlehrerin nicht. Nicht, weil sie ihn schlecht behandelte. Im Gegenteil, sie war sehr freundlich. Sie war hübsch, etwas älter als er selbst, aber sie verwirrte und verunsicherte ihn.
Die Eltern der jungen Frau stammten aus Marokko. Sie, so hatte sie erzählt, war auch dort geboren, aber als Kind mit den Eltern nach Deutschland gekommen.
Sie sprach Deutsch wie eine Deutsche.
Sie sprach Arabisch wie eine Araberin.
Sie hieß Aisha. Ihr Name war abgeleitet von dem Namen der jüngsten Frau des heiligen Propheten Mohammed, Ayesha, die im Alter von neun Jahren vom Propheten geheiratet worden war.
Das Sprachinstitut hieß InterSpeech und hatte seine Klassenräume in einem schönen alten Gebäude an der Straße Eppendorfer Baum.
Neben Hakeem gab es drei weitere Schüler, Adnan, den Sohn eines im Generalkonsulat in Hamburg tätigen Diplomaten aus dem Oman, Rashid, Sohn eines Kaufmannes aus Tunesien, und Memo, Sohn eines ägyptischen Ingenieurs.
Alle sollten sie an der Universität Hamburg studieren, alle vier waren in etwa gleich alt, und alle wurden von Aisha völlig gleich behandelt.
Hakeem hatte inzwischen die unzähligen Frauen gesehen, die ihr Haar offen trugen, er hatte Frauen gesehen, in aufreizenden Kleidern, in hautengen Hosen, in Blusen, unter denen sich die Spitzen ihrer Brüste abzeichneten. Er hatte aber auch die züchtigen jungen Muslima gesehen, von denen es in Hamburg zahlreiche gab, die ihr Haar unter einem Kopftuch verbargen, und die den Blick senkten, wenn ein Mann sie ansprach.
Was Hakeem bin Zaif so verwirrte war, dass Aisha das Kopftuch trug, so, dass niemals eine Strähne ihres Haars zu sehen war. Aber ihre Blusen ließen oft ihre Brustspitzen erahnen, und unter den engen Hosen zeichnete sich die Falte ihres Leibes ab.
Zudem dachte Aisha nicht im geringsten daran, ihren Blick zu senken. Sie guckte ihren Schülern offen und keck in die Augen, lobte oder tadelte sie, und pflegte eine beunruhigend offene Sprache.
Hakeem war gleichzeitig hingerissen und abgestoßen. Aisha war bei weitem nicht so verrucht wie die Frauen in Europa oder den USA. Aber gerade, weil sie einerseits so züchtig war und andererseits so lasziv wirkte, wusste Hakeem seine Gefühle nicht einzuordnen. So wie Aisha stellte er sich die Jungfrauen im Himmel vor, die auf die Helden warteten, die ihr Leben für den Heiligen Glauben hingaben.
Hakeem träumte des Nachts von Aisha.
Er respektierte sie viel zu sehr, nicht als seine Lehrerin, sondern als Frau, als dass er gewagt hätte, sie anzusprechen und einzuladen, außerhalb der Kurse Zeit mit ihm zu verbringen.
In seinen Träumen jedoch umarmte er Aisha, drang ein in ihren warmen Leib, und wenn er dann aus dem Schlaf schreckte, legte er, Allah möge ihm vergeben, Hand an sich selbst und befleckte sich, um sich Erleichterung zu verschaffen.
Einige Male war er in den Stadtteil gegangen, vor dem Feldwebel Abd el Abd ihn dankenswerterweise versucht hatte, zu warnen. Hakeem hatte sich die Etablissements angesehen, die Schaufenster mit den üppigen Frauen. Auf einer Bühne sah er den Akt der Vermehrung, durchgeführt von etlichen Paaren gleichzeitig, die dann auch noch während der Vorstellung ihre Partner wechselten.
Bei diesen Besuchen hatte Hakeem bin Zaif versucht, sein erregtes Fleisch durch die Hand in seiner Hosentasche zu verdecken, immer in der Angst, jeden Moment würde der unbändige Zorn Allahs in Form eines Blitzes auf ihn herab geschleudert.
Nachdem jedoch der Blitz ausblieb, und nachdem Hakeem die Erregung und Neugier nicht mehr länger aushielt, ging er zu einer der üppigen Frauen in der Straße mit den Schaufenstern. Die Frau war sicherlich älter als seine Mutter. Aber Hakeem versank zwischen ihren enormen Brüsten, in ihrem nachgiebigen Fleisch, das so weich und geschmeidig war, dass er nicht mal merkte, in die Frau eingedrungen zu sein, und er dachte dabei an Aisha und daran, welche Sünde er gerade beging.
Immer noch blieb der befürchtete Blitz aus, und Hakeem nahm an, dass Allah ihn entweder nicht für wichtig genug erachtete oder dass Allah sein Tun nicht als Sünde ansah.
Hakeem gefiel der zweite Gedanke besser. Die Frauen, mit denen er das Lager teilte, waren schließlich Frauen der Ungläubigen. Und so, wie Hakeem es sah, entwürdigte er durch seinen Akt die Ungläubigen und ihre Frauen, wodurch er gleichzeitig Allah lobpries.
Trotzdem war ihm nicht wohl bei seinem Tun. Sünde blieb wahrscheinlich doch Sünde.
Und weil es letztlich Aisha war, die ihn zu diesen Sünden trieb, wurde sein Zorn auf sie immer größer.
Gerade deshalb war er so perplex, als sie ihm mit einer Handbewegung bedeutete, sie wolle ihn nach Abschluss der heutigen Unterrichtsstunden noch unter vier Augen sprechen.
Nervös trödelte Hakeem bin Zaif herum, als er sein Heft und seine Bücher einpackte. Ebenso trödelte er, als er seine Jacke von der Garderobe holte und noch einmal in den Klassenraum zurück schlenderte, den seine drei Mitschüler soeben verließen und in dem Aisha noch damit beschäftigt war, die Wandtafel sauber zu wischen.
„Ach, Hakeem,“ sagte sie. „Du wartest auf eine Nachricht aus Riad. Ich habe da etwas für dich. Lass uns noch einen Tee zusammen trinken. Hier um die Ecke gibt es eine nette Teestube. Am liebsten dort mag ich deren grünen Tee.“