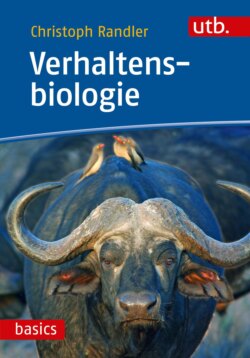Читать книгу Verhaltensbiologie - Christoph Randler - Страница 11
1.2 | Verhaltensbiologie – eine junge Disziplin
ОглавлениеBereits Aristoteles (384–322 v. Chr.) machte sich Gedanken über das Lernen und die Emotionen von Tieren. Die wissenschaftliche Sicht der Verhaltensbiologie ist dagegen erst etwa 150 Jahre alt. Charles Darwin (1809–1882) stellte klare Bezüge zwischen Verhalten und Evolution her; beispielsweise interpretiert er das Balzverhalten von Vögeln bzw. die ausgeprägte Gefiederfärbung derselben als Versuche, die Partnerwahl des Weibchens zu beeinflussen (sexuelle Selektion; → Kap. 7). Einen Aufschwung erlebte die Verhaltensbiologie aber erst im 20. Jahrhundert mit den Begründern der Ethologie (→ Kap. 3), die die Bedeutung von Endursachen (ultimaten Faktoren, der Interpretation des Zwecks des jeweiligen Verhaltens) betonten und die Auffassung vertraten, dass sich Verhaltensmerkmale klar identifizieren und messen lassen. Als besonderer Erfolg der Ethologie kann die Entzifferung der Bienensprache durch Karl von Frisch (1886–1982) gelten, der 1973 zusammen mit Konrad Lorenz (1903–1989) und Nikolaas Tinbergen (1907–1988) den Nobelpreis für Medizin/Physiologie erhielt. Lorenz und Tinbergen werden auch als die Gründerväter der Ethologie bezeichnet.
Während die Ethologie in Europa lange Zeit die dominierende verhaltensbiologische Forschungsrichtung war, entwickelte in den USA Burrhus Skinner (1904–1990) den Behaviorismus, eine alternative Forschungsrichtung, der die Annahme zugrunde liegt, dass alles Verhalten erlernt sei. Ethologie und Behaviorismus unterscheiden sich stark, was sich nicht nur in ihren unterschiedlichen Grundannahmen manifestiert, sondern auch in der Art und Weise, wie geforscht wird: Während Behavioristen sich in der Regel auf Laborexperimente beschränken und dort die Beziehung zwischen Reizen und Reaktionen analysieren, dominieren bei den Ethologen Feldversuche, von denen man sich erhofft, dass durch das genaue Beobachten ein und desselben Verhaltens bei unterschiedlichen Individuen – z.B. das Beutefangverhalten bei der Erdkröte (Bufo bufo) – allgemeingültige Aussagen über dieses Verhalten generieren lässt.
Einen anderen Ansatz verfolgt die Vergleichende Psychologie, welche weniger auf das Verhalten bei einzelnen Arten fokussiert, sondern nach artübergreifenden allgemeinen Grundsätzen des Verhaltens sucht. Die vergleichende Psychologie entstand in den USA parallel zur klassischen Ethologie in Europa. Erfolgversprechende Ansätze der Vergleichenden Psychologie untersuchen beispielsweise Unterschiede im Verhalten oder in der Entstehung von Verhalten (der sogenannten «Verhaltensontogenese») von Menschenaffen und Menschen. Da sich die Ethologie und die Vergleichende Psychologie recht nahe sind, kam es mehrfach zu fruchtbarer Zusammenarbeit, wodurch u.a. die Forschungsrichtungen der Verhaltensökologie und der Soziobiologie entstanden. Beiden Forschungsrichtungen ist gemeinsam, dass sie die Fitnessmaximierung ins Zentrum ihrer Untersuchungen stellen, d.h., den Überlebensvorteil und – noch wichtiger – den möglichst hohen Fortpflanzungserfolg als wichtigste Messgrößen untersuchen. Während die Verhaltensökologie auf die Wechselwirkungen zwischen dem sich verhaltenden Tier und seiner (belebten und unbelebten) Umgebung fokussiert, richtet sich der Blick der Soziobiologie auf die biologischen Grundlagen von sozialem Verhalten. Einen veritablen Aufschwung erlebte die Soziobiologie 1975 durch das Buch Sociobiology: The new synthesis von Edward O. Wilson (*1929), in dem der Autor Verhalten als etwas Egoistisches bezeichnete, nämlich als Mittel zu dem Zweck, den eigenen Fortpflanzungserfolg zu maximieren.