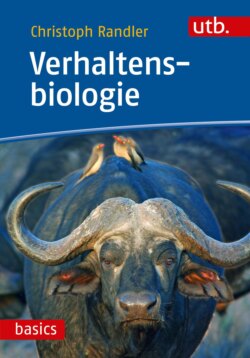Читать книгу Verhaltensbiologie - Christoph Randler - Страница 9
Inhalt
Оглавление1.1 Wie wird «Verhalten» definiert?
1.2 Verhaltensbiologie – eine junge Disziplin
1.3 Was tun Verhaltensbiologen?
1.4 Berufsfelder für Verhaltensbiologen
1.5 Was müssen Verhaltensbiologen können?
Verhaltensbiologie beschäftigt sich mit der Frage, was ein Tier macht und auf welche Weise es etwas macht. Die Verhaltensbiologie verfolgt dabei einen integrativen Ansatz, bei dem Zoologie, Evolutionsbiologie und Ökologie eine wichtige Rolle spielen. Die Verhaltensbiologie verwendet bei der Erforschung ihrer Fragestellungen zahlreiche Methoden, die sowohl Beobachtungen als auch komplexe Experimente umfassen und die entweder im Freiland oder im Labor stattfinden können. Die in der Verhaltensbiologie am häufigsten untersuchten Tiergruppen sind in absteigender Reihenfolge Vögel, Insekten, Fische und Säugetiere. Aktuell eher stark beforschte Themen sind die sexuelle Selektion, Kommunikation und Signale.
Verhaltensbiologie ist so alt wie die Menschheit selbst: In der Zeit der Jäger (Paläolithikum) hatte es für die Menschen Vorteile, wenn sie das Verhalten von Tieren beobachten, erklären und vorhersagen konnten, da sich auf diese Weise der Jagderfolg steigern ließ. Ebenso war es überlebenswichtig, selbst Beutegreifern, wie etwa den Säbelzahnkatzen (Machairodontinae), zu entkommen. Verhaltensbiologische Kenntnisse halfen, etwas zu essen zu bekommen, anstatt selber zur Speise zu werden; verhaltensbiologische Kenntnisse verhalfen der Spezies Mensch zu einem Überlebensvorteil (Manning & Dawkins 2012).
Verhalten findet ständig statt: «Man kann sich nicht nicht verhalten.» lautet die Abwandlung eines Axioms von Paul Watzlawick. Eine Feldmaus (Microtus arvalis) etwa, die sich nicht bewegt, zeigt womöglich adaptives Verhalten: Sie erhöht z.B. ihre Überlebenswahrscheinlichkeit beim Vorbeilaufen eines Fuchses, weil sie sich nicht durch Bewegung verrät. Ihr Verhalten kann aber auch nicht adaptiv sein; z.B. dann, wenn ihre Überlebenswahrscheinlichkeit durch Flucht vor dem Fuchs in ein Erdloch größer gewesen wäre als durch Tarnung. Aber unabhängig davon, ob die Feldmaus adaptives oder nicht adaptives Verhalten zeigte: Verhalten hat sie sich auf jeden Fall.
Verhalten ist also das, was ein Tier macht, und Verhaltensbiologie fragt danach, was, wie und warum es dies macht. Während die Frage nach dem «Was?» auf eine möglichst neutrale Beschreibung des Verhaltens abzielt, stehen beim «Wie?» die verschiedenen Taktiken, Strategien, Mechanismen und Prozesse des tierischen Verhaltens im Vordergrund. Die Frage nach dem «Warum?» soll schließlich erklären, weshalb es zu einem spezifischen Verhalten eines Tieres kommt.
Ein Beispiel: Beobachtet wird, wie ein Dachs (Meles meles) herumläuft und mit der Schnauze in der Erde bohrt. Eine mögliche Antwort auf die Frage, was der Dachs macht, ist, dass er nach Nahrung sucht. Die Frage nach dem «Warum?» kann aus zwei Perspektiven beantwortet werden: aus einer physiologischen und einer evolutionstheoretischen. Die physiologische Perspektive weist darauf hin, dass der Dachs nach Nahrung sucht, weil er Hunger hat, während die evolutionstheoretische Perspektive besagt, dass die Nahrungszufuhr ihm das Überleben sichert und damit Fortpflanzung möglich macht. Die Frage nach dem «Wie?» kann auf verschiedene Weise beantwortet werden, da manche Dachse eher an ganz bestimmten Orten nach Nahrung suchen, während andere bestimmte Vorlieben für eine bestimmte Nahrung haben (Requena-Mullor et al. 2016). Damit werden Unterschiede zwischen Individuen thematisiert.
Box 1.1
Verhalten illustriert am Jahreslauf einer Blaumeise
Eine Blaumeise (Cyanistes caeruleus) sucht an einem sonnigen Wintermorgen nach Nahrung. Sie muss fressen, um ihre Energiebilanz ausgewogen zu halten, d.h., um nicht zu verhungern (Homöostase, → Kap. 4). Am besten sucht und frisst sie energiereiche Nahrung, weil sie auf diese Weise in kurzer Zeit viel Energie aufnehmen kann (→ Kap. 5). Ihre Präferenz für energiereiche Nahrung beeinflusst also die Entscheidung, wann, was und wo sie frisst. Gerne frisst sie zudem im Verbund mit anderen Blaumeisen, weil dies mehr Sicherheit vor Beutegreifern (→ Kap. 6) mit sich bringt. Damit verschärft sich aber die Konkurrenz ums Futter, da sie dieses mit Artgenossen und gegebenenfalls Vertretern anderer Arten teilen muss. Da Blaumeisen oft im Verbund mit anderen Vögeln bei der Nahrungsaufnahme beobachtet werden können, ist der Nutzen der verbesserten Feindwahrnehmung offenbar größer als der Schaden durch die erhöhte Futterkonkurrenz. Beim Erscheinen von Feinden warnen sich Blaumeisen gegenseitig mit Alarmrufen; diese werden über die Artgrenzen hinweg verstanden, sodass auch andere Arten auf diese Warnrufe reagieren (→ Kap. 10). Fliegt ein Sperber (Accipiter nisus) vorbei, bleiben die Blaumeisen regungslos sitzen. Entdecken sie hingegen eine Eule, wird diese angegriffen und gemobbt. Warum das so ist, wird mit verschiedenen Hypothesen erklärt, darunter auch mit Altruismus (→ Kap. 11).
| Abb. 1-1
Ein Jahr im Leben der Blaumeise (Cyanistes caeruleus). A) Blaumeise bei der Nahrungssuche im Winter, B) bettelnde Jungmeise, C) Sperber (Accipiter nisus) als Prädator von Blaumeisen, D) Kohlmeise als Begleitart in gemischten Winterschwärmen. Fotos: C. Randler.
Im Frühjahr suchen und besetzen die Blaumeisen-Männchen Reviere und singen, um Weibchen anzulocken, aber auch, um anderen Männchen zu signalisieren, dass das Revier bereits besetzt ist. Manchmal kämpfen die Männchen um ein Revier. Erscheint ein Weibchen im Territorium, zeigen die Blaumeisen ein Balzverhalten, da – wie übrigens bei den meisten Meisenarten – Damenwahl herrscht. Weibchen wählen ein Männchen nach verschiedenen Gesichtspunkten aus, oft nach dem Ultraviolettanteil im Gefieder (→ Kap. 7). Brutpflege und Jungenaufzucht finden generell durch beide Eltern statt, obwohl Blaumeisen nicht unbedingt treu sind, sondern gerne mittels «außerehelicher» Kopulationen versuchen, ihre Gene breiter zu streuen. Erscheint ein Beutegreifer in der Nähe der Nisthöhle, so wird er angegriffen (Brutverteidigung). Blaumeisen legen sehr viele Eier, was mit der hohen Sterblichkeit der Jungvögel im ersten Lebensjahr zusammenhängen dürfte.