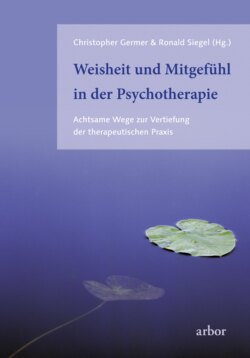Читать книгу Weisheit und Mitgefühl in der Psychotherapie - Christopher Germer - Страница 15
ОглавлениеKAPITEL 5
Der mitfühlende Therapeut
ELISSA ELY
Menschen sind keine Probleme, die gelöst werden.
DIANA TRILLING (1982, S. 339)
Anmerkung der Herausgeber: Die meisten Therapeuten halten sich für mitfühlend, und sie sind es auch wirklich. Doch wir sind alle mit Grenzen dessen konfrontiert, was wir tun können. Die folgende Geschichte illustriert, wie schwer es ist, angesichts des namenlosen Leides in der Welt mitfühlend zu bleiben.
An zwei Abenden der Woche besuche ich ein Obdachlosenasyl. Viele der Patienten, die ich da habe, hören Stimmen, und manchmal glauben sie, dass sie für Verbrechen bestraft werden, die sie nie begangen haben. Sie leben in großer Angst vor schrecklichen Ereignissen, die nie eintreten werden, und manchmal können sie das Schreckliche nicht vergessen, was sie tatsächlich erlebt haben.
Ich verschreibe Meditationen, halte bildlich gesprochen ihre Hand, bewundere ihre Stärken und gebe ihnen zu verstehen, dass ihre Symptome abnehmen werden und sich ihr Leben verbessern wird, wenn sie einfach durchhalten – wenn sie ihre Medikamente nehmen, regelmäßig Terminvereinbarungen mit ihren Therapeuten einhalten und sich von Drogen fernhalten.
Aber ich weiß, dass dies nicht immer so ist.
Dies ist die Geschichte eines Patienten aus dem Asyl. Sie begann mit einem Zeitungsartikel, den ich über ihn schrieb. Sein Intelligenzquotient lag unter 70. Weder trank er noch nahm er Drogen, aber es fiel ihm schwer, seinen Drang nach Lotterielosen zu kontrollieren. Wenn seine Zahl gezogen wurde, lud er die vielen Freunde aus seinem Umkreis, die er plötzlich hatte, zu chinesischem Essen und manchmal ins Kino ein.
Er wartete auf Hilfen vom Staat. Jeden Morgen ging er über die Brücke in einen Park in der Nähe. Er wanderte den ganzen Tag umher, machte isometrische Übungen, beobachtete Vögel und ging dann zum Obdachlosenasyl zurück. Er genoss die Natur, aber das Asyl regte ihn auf und schüchterte ihn ein. Seine Hände waren riesig und seine Arme wie Rohre von den vielen Liegestützen, die er machte. Wände und Mülltonnen hatten darunter zu leiden.
Nachher war er voller Reue. „Ich möchte diese Hände nie wieder aus meinen Hosentaschen nehmen und nie wieder jemanden schlagen, Frau Ely“, sagte er nach jeder Entgleisung. Bereitwillig nahm er die Medikamente gegen seine Wut.
Die sozialen Einrichtungen kümmerten sich nur zögernd um ihn. Das Department of Mental Health war an jemandem ohne eine Geschichte mit Klinikaufenthalten, Suizidversuchen oder einer Psychose nicht interessiert. Wir waren der Meinung, vor dem Hintergrund seines relativ niedrigen IQ wäre ihm besser mit einer Institution für Menschen mit einer geistigen Behinderung gedient.
Wochen vergingen, nachdem der Antrag eingereicht war – und dann wurde er ohne Begründung abgelehnt. Irgendwo erzählte uns ein Angestellter, dass der Patient berechtigt wäre, in seiner Angelegenheit einen ausführlichen Brief zu schreiben, der als ein Einspruch dienen würde. Es kam uns wie ein Widerspruch vor, dass er einen sehr durchdachten Schriftsatz verfassen sollte, um die eigene Unfähigkeit zu begründen, aber man kann mit den Irrationalitäten einer staatlichen Behörde nicht argumentieren.
Er machte weiter seine Liegestütze, nahm seine Pillen gegen die Wut und war außer an kalten Wintertagen immer draußen unterwegs. Er versuchte, sich selbst zu behandeln. Aber er begann Rückschritte zu machen, wieder Mülltonnen zu traktieren und Mitbewohner im Asyl zu bedrohen. Er nahm seine großen Hände oft aus den Hosentaschen.
Eines Abends nahmen wir ihn mit in das Büro. Wir mussten ihm sagen, dass auch der Einspruch, den wir ihm formulieren geholfen hatten, abgelehnt worden war, dass er immer noch nicht für Unterkunfts- oder Behandlungsprogramme angenommen wurde und dass keine Veränderung für ihn in Aussicht war. Wir hatten ihn beim Abendessen unterbrochen. Er hatte einen Becher Eis bei sich und saß da und aß es langsam. Um die schlechten Nachrichten hinauszuschieben, fragten wir ihn, wie sein Tag gewesen war.
„Ich war im Park“, sagte er. „Da habe ich meine Liegestütze gemacht. Ich mag am Morgen den Geruch der Bäume und schaue gern den Käfern zu. Da ist ein Habichtnest, das ich entdeckt habe. Einer der Habichte hat einen roten Schwanz, das ist das Weibchen. Der mit dem weißen Schwanz ist das Männchen, er ist einen Tick größer.“
Er war voller Wissen und stolz darauf.
„Wissen Sie was? Ich habe den gleichen weißgeschwänzten Habicht genau hier zur Zeit des Abendessens gesehen“, sagte er. „Er fliegt über die Brücke hierher und sucht nach Tauben. Das ist wie Steak für ihn. Es bleiben nichts als Federn übrig, wenn er fertig ist.“
Er stand auf und lenkte unseren Blick mit seinem Eislöffel aus dem Fenster. „Sie müssen abends mal den Baum ansehen“, sagte er. „Er ist schön. Es schenkt mir das Gefühl, dass ich Glück habe.“
Er streckte seine rohrförmigen Arme aus.
„Oh, ja“, sagte er und dachte zurück. „Ich habe Glück.“
Ich schrieb sein Porträt für die Lokalzeitung. Der Artikel war ein Gedicht (nicht in der Form, aber vom Thema her), und die Reaktion machte Mut. Die Leser hatten das Gefühl, dass sie an einem Moment der Erlösung teilnahmen. Sie bekamen ein unwiderstehliches Bild: von einem friedlichen Kenner der Natur, der mit seinem Plastiklöffel auf die Habichte zeigt. Kurz gesagt, er erlebte eine Zeit einer gewissen Berühmtheit. Es war, als hätte er in der Lotterie lauter Richtige.
Das war das Ende der Geschichte, die ich schrieb.
Aber das war nicht das Ende der Geschichte, die er lebte.
Ein paar Wochen später beschuldigte ihn eine Frau in dem Asyl, dass er ihre Brüste angefasst hätte. Es gab keine Zeugen. Sie hatte schon zuvor zahllose ähnliche Beschuldigungen gegen andere Männer vorgebracht. Aber dies sind Zeiten, in denen Behauptungen dieser Art besonderes Gewicht haben, und so wurde ihm der Zutritt zu dem Asyl verboten.
Er konnte nicht begreifen, was es bedeutete, ausgeschlossen zu sein. Diese Sache machte für ihn keinen Sinn. Unser Asyl war das Zuhause, das er kannte, und während der ersten paar Tage schlief er draußen auf der Bank vor der Eingangstür und bat das Personal, ihn reinzulassen. Schließlich schaffte er es bis in die Notaufnahme des städtischen Krankenhauses und bat dort, ihn zu uns zurückzuschicken. Alles, was er wollte, war, seine Wut-Pillen nehmen, seine Liegestütze machen und mit seinem Wissen über die Vögel herumwandern.
Schließlich verschwand er. Wir hofften, dass er irgendwie ein anderes Asyl gefunden hatte, aber wir hörten nie wieder etwas von ihm. Wir mussten uns um hundert andere obdachlose Männer kümmern.
Etwa ein Jahr später bekam ich einen Anruf von einer Krankenschwester. Sie rief von einer Station für Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten in einem Pflegeheim an. Unser Patient war in einem fast katatonischen Zustand aufgenommen worden. Er hatte das Asyl als seine Heimatadresse angegeben.
Die Krankenschwester beschrieb den körperlich fitten und mit Glück gesegneten Mann, den wir gekannt hatten, als steif, sediert und feindselig. Er war auch verhaltensauffällig – der schlimmstmögliche Begriff in der Sprache der Karteien –, denn er masturbierte auf den Fluren. Dieses Verhalten war alles, was das Personal von ihm wusste. Er war von Gefangenschaft, Unfähigkeit, sich auszudrücken, und Angst überwältigt, und seine einfältige Panik hatte genau den falschen Ausdruck gesucht. Zufällig hatte die Krankenschwester den Artikel gelesen, den ich über ihn geschrieben hatte. In dem Menschen, den sie vor sich hatte, hätte sie nie diesen poetischen Mann erkannt.
Gott sei Dank rief sie während der nächsten Monate ein paar Mal an, um um Rat zu fragen. Seine Verhaltensweisen hatten sich nicht verändert, und er trug eine elektronische Fußfessel, die piepte, wenn er die Station verließ. Er durfte das Gebäude nicht verlassen und nicht ins Freie oder in die Nähe der Vögel, die seine beste Behandlung waren.
Als das Pflegeheim geschlossen werden sollte, rief sie ein letztes Mal an. Es war noch nicht über ihn entschieden worden, und sie wusste nicht, wohin er überwiesen werden sollte. „Es ist eine Schande, dass die Leute bei diesen Geschichten nicht wissen, was als Nächstes mit ihnen passiert“, sagte sie eines Tages. „Darüber sollten Sie auch schreiben.“
Nachdem das Asyl ihn ausgeschlossen hatte, war er aus unserem Blick verschwunden, tauchte dann kurz wieder auf (gerade lang genug, um gesichtet und missverstanden zu werden) und verschwand dann wieder. Doch all diese Zeit, in und außerhalb unserer Sichtweite und unseres Bewusstseins, lebte er weiter, wurde immer mehr aufgegeben und weniger verstanden. Sein Leben ging weiter, außerhalb unserer Sichtweite.
Und dann verschwand auch die Krankenschwester.
Vier Jahre, nachdem er uns zum ersten Mal von seinem Glück erzählt hatte, erreichte uns ein Brief von einer neurologischen Klinik aus einer anderen Gegend des Staates. Der Umschlag hätte weggeworfen werden sollen, der Name darauf war so alt, aber glücklicherweise hatte jemand am Empfang ihn erkannt und an uns weitergegeben. Anscheinend gab er immer noch das Asyl als seine Heimatadresse an.
Der Bericht, den er enthielt, war erschütternd. Er war so verfasst, als gäbe es in diesem Patienten keine Person mehr – es gab kein einziges Zitat und nicht einmal eine Beschreibung seines körperlichen Zustandes. Man bekam das Gefühl, dass der Neurologe mit seinem Latein am Ende war. Er schrieb, dass es ohne irgendeine Information über die Geschichte dieses Mannes – und er hatte überhaupt keine Informationen – keine Möglichkeit gab, seinen Verfall zu verstehen. Die einzige Schlussfolgerung, die gezogen werden konnte, und die allein auf Beobachtung beruhte, war, dass sich sein Problemverhalten verschlimmert hatte. Deshalb plante man, die Medikation zu erhöhen.
Wir riefen den Neurologen an. Unser Patient lebt jetzt in einer Wohngruppe. Er ist ein vollkommener Niemand, unverständlich und nur an seinem weiter andauernden Problemverhalten erkennbar. Niemand möchte riskieren, seine Medikation zu senken. Niemand würde im Traum daran denken, ihn ins Freie zu lassen. Der bewunderte Mann, über den ich geschrieben und der von seinem Glück erzählt hatte, diese Person, die Vögel liebte, ist unerkennbar. Diese Person hat möglicherweise aufgehört zu existieren.
Wir haben unsere Berichte an die Klinik geschickt, und zwar alle, die wir hatten, damit sie den Patienten jetzt so kennen konnten, wie wir ihn damals gekannt hatten. Wir legten auch eine Kopie des Zeitungsartikels von damals bei, in der Hoffnung, er würde sie anregen, ihn mit Zartgefühl zu behandeln, er könnte eine Art VIP-Wirkung haben, ihn zu einem Menschen machen … Wir hatten ihn wieder aus den Augen verloren – aber wieder war sein Leben weitergegangen. Wir verlieren Patienten aus den Augen, aber ihr Leben geht weiter. Auch wenn dies nicht das Ende der Geschichte ist. Es ist nur das Ende der Geschichte, die ich aufschreibe.
Manchmal ist das, was wir tun, so einfach wie Zuhören. Manchmal sollte das, was wir tun, noch einfacher sein: Andere daran erinnern, wer der unerkennbare Patient ist. Patienten, Therapeuten, Nachbarn, Familie, wir sind alle Momentaufnahmen, die sich einander in ihrer Fülle nicht kennen. Die meisten Menschen halten ein Leben aus, in dem sie nur zum Teil erkannt werden, weil das Überleben nicht davon abhängt. Aber hin und wieder hängt es davon tatsächlich ab.