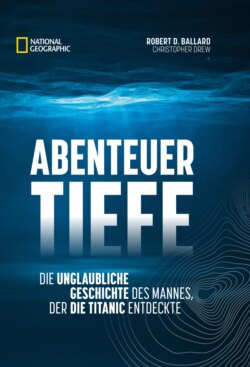Читать книгу Abenteuer Tiefe - Christopher Drew - Страница 10
KAPITEL 3 WEG IN DIE WISSENSCHAFT
ОглавлениеAls Margie und ich in Richtung Osten aufbrachen, erweiterte sich unser Horizont mit jedem Kilometer. Wir machten uns auf den Weg durch Wüsten und Steppenausläufer, waren nach zwölf Stunden in El Paso und dann, nach weiteren neun Stunden Fahrt durch verdorrte Landschaften, erreichten wir Dallas. Einmal hielten wir, um einen Schwarm Kanadagänse zu beobachten, die nordwärts zogen – genau wie wir. Im Rückblick auf ein Leben, das sich ganz der Erkundung des Planeten widmete, hält man es kaum für möglich: Ich war bis dahin noch nie östlich des Mississippi gewesen. Wir überquerten den Fluss bei Vicksburg und besuchten das Schlachtfeld aus dem Amerikanischen Bürgerkrieg, wo General Grant die Konföderierten zur Kapitulation gezwungen hatte. Ich ging durch das Gelände und stellte mir den Kampf vor. Danach Atlanta – und dann Washington, hier wartete eine fantastische erste Besichtigung auf mich. Schließlich ging es hoch nach Boston und wir bekamen gleich einen Vorgeschmack dessen, was uns in Neuengland erwartete: ein stürmisches Schneegestöber im März. Am nächsten Morgen zog ich meine nagelneue blaue Navy-Uniform an und war bereit für meinen ersten Arbeitstag – und musste direkt wieder zurück in die Jeans, um den VW aus dem Schnee zu buddeln.
Der Start im Nordosten war alles andere als einfach für einen Strandgutsammler aus Südkalifornien und meine ersten Tage in der Dienststelle für Meeresforschung verliefen kaum besser. Mein Training in der Army hatte darauf abgezielt, mich zum Krieger zu machen; dann bekam ich eine großartige Stelle, die mir ermöglichte, Tauchboote zu entwerfen und gleichzeitig an meiner Promotion zu arbeiten. Meine Aktivierung durch die Navy bedeutete einen beträchtlichen Umweg und eine drastische Gehaltskürzung. Aber nun war ich eben hier. Ich dachte damals, ich würde einfach meine Pflicht erfüllen und dann nach Kalifornien zurückkehren.
Ein Teil meiner Arbeit bestand darin, die Verwendung von Fördermitteln an Forschungsinstitute zu überwachen – wirklich der reinste Papierkrieg. Ich war der Verbindungsoffizier für einige Hochschulen – darunter das MIT (Massachusetts Institute of Technology), die University of Rhode Island und die von New Hampshire. Der bei Weitem größte Empfänger von Zuschüssen in meinem Verantwortungsbereich war die Woods Hole Oceanographic Institution, etwa anderthalb Autostunden südlich von Boston.
Über Woods Hole wusste ich bis dahin nur sehr wenig. Ich hatte so lange von einer Stelle am Scripps-Institut geträumt, dass ich mich nie richtig mit seinem Rivalen an der Ostküste befasst hatte – obwohl sich auch dort zahlreiche Wissenschaftler den Ozeanen widmeten. Das WHOI, wie es genannt wurde, befand sich in einem kleinen Dorf in Neuengland, voll malerischer, schiefergedeckter Häuschen, während Scripps klassisch südkalifornisch war – mit rollender Brandung und dem ganzen Drumherum. In Meeresforscherkreisen ist das ein bisschen so wie im Baseball die Rivalität zwischen den New York Yankees und den Boston Red Sox. Schon nach kurzer Zeit war mir klar, dass ich sehr viel Zeit dort verbringen würde.
Da stand ich nun in meiner blauen Winteruniform inmitten all der Menschen in Outdoor-Freizeitbekleidung. Von der Water Street aus spazierte ich über die Zugbrücke, die den engen Kanal zwischen dem Nantucket Sound im Atlantik und dem Eel Pond überspannte – eine kleine Lagune, dominiert von der Captain-Kidd-Bar, einem urigen Meeresfrüchterestaurant. Und dann, während ich auf der Brücke stand und fröstelte, erregte mitten in der Lagune etwas meine Aufmerksamkeit.
Schmuck, weiß, sechseinhalb Meter lang, so lag es da: Alvin, ein Tauchboot mit Platz für drei Personen, die damit in einer Tiefe von bis zu 1800 Metern den Ozean erforschen konnten. Eigentum der Navy, betrieben allerdings vom Woods-Hole-Institut, lag es zur Durchführung irgendwelcher Tests in dem kleinen Hafen. Der Anblick des Boots und mein Gespür dafür, wozu es in der Lage war, fesselten mich sofort.
Alvin war das einzige von einem amerikanischen Meeresforschungsinstitut betriebene Tauchboot. Sogar Scripps besaß keines. Bis dahin wurden Erkundungen des Tiefseebodens von der Wasseroberfläche aus mithilfe von Sonargeräten und anderen Methoden der Ferndetektion durchgeführt. Ich begriff, dass Alvin Wissenschaftlern ermöglichte, selbst unter Wasser zu gehen, dort zu manövrieren und alles mit eigenen Augen zu beobachten. Das war ein Wasserfahrzeug ganz nach meinem Geschmack. Es hatte seine Bewährungsprobe bereits bestanden, denn durch seinen Einsatz konnte eine Wasserstoffbombe ausfindig gemacht werden, die ein Air-Force-Bomber während eines Zusammenstoßes in der Luft verloren hatte und die auf den Grund des Mittelmeers gesunken war. Die Vorstellung, in einem bemannten Tauchboot zu arbeiten, das für unmittelbare visuelle Beobachtung konzipiert war, faszinierte mich – genau diese Art Wissenschaft wollte ich betreiben.
Meine Vorstellungsrunde an jenem ersten Tag in Woods Hole geriet zu einem wahren Spießrutenlauf. Es war wie ein Treffen mit den Göttern. Als Erstes war der Direktor von Woods Hole, Paul Fye, an der Reihe. Als ich mich damit brüstete, schon für Scripps zur See gefahren zu sein, kniff er seine Augen zusammen: »Nun, es freut mich sehr, dass Sie es schließlich doch noch an das beste Meeresforschungsinstitut der Welt geschafft haben.«
Danach begrüßte mich Kenneth O. Emery, genannt K. O., ein Experte für Kontinentalschelfe und einer der meistverehrten Schüler von Francis Shepard, dem berühmten Meeresgeologen. Ich legte außerdem Wert darauf, Bill Rainnie kennenzulernen, einen ehemaligen U-Boot-Offizier, der die Abteilung für Tiefseetauchgänge betreute. Er entschied, wer Zugang zu Alvin bekam.
Sie alle hießen mich im Lauf der nächsten zwei Jahre in ihrem Woods-Hole-Kreis willkommen. Dr. Emery lud mich sogar ein, als Teil des wissenschaftlichen Teams auf Forschungsschiffen mit hinauszufahren, was mein Chef bei der Navy genehmigte. Ich fühlte mich wie ins Aufbaustudium zurückversetzt. Endlich konnte ich meinen Träumen nachgehen.
Von nun an gab ich alles und war hoch konzentriert. Der Besatzungsführer an Bord von Alvin – George Broderson, oder kurz Brody – gab mir den Spitznamen »Weißer Tornado«, weil ich immer federnden Schrittes in meiner weißen Sommeruniform durch Woods Hole brauste und so meinen Bewegungsdrang auslebte.
Ob man es nun Glück nennt oder wie auch immer – irgendwie war ich an den perfekten Ort für mich gelangt und man empfing mich dort mit offenen Armen, wie ein Familienmitglied.
—
DURCH EINEN KONTAKT BEI MEINER NAVY-DIENSTSTELLE wurde ich Mitglied der Boston Sea Rovers, des prestigeträchtigsten Tauchklubs der Welt. Das war eine vielseitige, zähe Truppe von etwa 20 Männern, denen es nichts ausmachte, die Kälte des Nordatlantiks am eigenen Leib zu spüren. Jedes Wochenende während der Tauchsaison zogen wir uns die Ausrüstung über und sprangen ins kalte, dunkle Wasser, um nach Hummern zu tauchen und mit einer ganzen Kühltheke voll Köstlichkeiten wieder zum Vorschein zu kommen. Joe Hohmann, der mir in der Gruppe mit am nächsten stand, war so stark, dass er gleich zwei große Atemluftflaschen auf dem Rücken tragen konnte. Er fasste einfach mit der Hand in ein Loch und ließ sich dort von den Hummern beißen, um dann diese Zehn-Kilo-Dinger einfach so ans Tageslicht zu zerren. Zum Abschluss des Tages fuhren wir zu einer einsamen Insel, sammelten eine Tonne voll Moos und bereiteten dort über dem Feuer unseren Fang zu. Nach jedem Festmahl sprangen wir ein weiteres Mal ins Wasser, um die Butter vom Taucheranzug zu spülen.
An unserem alljährlichen Tagungswochenende läuteten wir den Freitagabend stets mit einer Cocktailparty in einem prachtvollen Restaurant ein, das wir »das Schloss« nannten. An den Samstagen hatten wir prominente Redner aus der Unterwasserwelt zu Gast wie etwa Jacques Piccard, der mit dem Bathyskaph Trieste bis auf 11 000 Meter Tiefe hinunter ins Challengertief getaucht war, die tiefste Stelle des Weltmeeres. Samstagabends wurden Filme über die Erkundung der Ozeane gezeigt. Frank Scalli, dem Moderator, wurde einmal von mehreren Mitgliedern ein riesiger Hummer überreicht, den sie unter dem tosenden Gelächter des Publikums wie einen Hund an der Leine über die Bühne führten. Jedes Jahr beschlossen wir das Wochenende mit einem Hummerauflauf bei Frank zu Hause. Er war Gerätetaucher und Vertreter der Firma U.S. Divers. Deren Inhaber war Jacques Cousteau, der der Welt durch Fernsehserien wie Geheimnisse des Meeres das Gerätetauchen und die Unterwasserforschung näherbrachte.
Wie sehr die Sea Rovers mein Leben beeinflussen sollten, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Ich sah, wie herausragende Redner uns mit farbenfrohen Unterwasserbildern förmlich in ihre Vorträge hineinzogen. Ich traf einige der besten Unterwasserfotografen und -filmer – Luis Marden und Bates Littlehales zum Beispiel, die für die National Geographic Society arbeiteten. Außerdem Melville Bell Grosvenor, von 1957 bis 1967 Präsident dieser Gesellschaft und Chefredakteur des Magazins National Geographic. Er war der Enkel von Alexander Graham Bell, dem Erfinder des Telefons und zweiten Präsidenten der National Geographic Society. Nicht zuletzt begegneten mir bei den Treffen der Sea Rovers die damals berühmtesten Persönlichkeiten der Unterwasserwelt: Al Giddings, der Kameramann, der später an Filmen wie Abyss – Abgrund des Todes und Titanic und vielen mehr mitarbeiten sollte; Rod und Valerie Taylor, bekannt für Filme, in denen sie auf Tuchfühlung mit Haien gingen; Harold Edgerton, ein MIT-Ingenieur, der mit Cousteau und anderen Unterwassertechnologien entwickelte; Eugenie Clark, eine Ichthyologin und Pionierin des Gerätetauchens, Spitzname »die Hai-Dame«; Paul Tzimoulis, ein früher Befürworter des Drucklufttauchens und Herausgeber der Zeitschrift Skin Diver; Joe MacInnis, bekannt für furchtlose Tauchgänge am Nordpol; Stan Waterman, Tauchpionier und Schöpfer von Unterwasserfilmen und Fernsehdokumentationen; schließlich Peter Gimbel, der zur Andrea Doria tauchte und Bilder von dem Wrack aufnahm. Auch Jacques Cousteau und sein Sohn Philippe gesellten sich oft zu uns.
Mit Interesse lauschte ich, wenn einige der Rovers davon schwärmten, wie gern sie mit ihren Geräten die Wracks von kleinen Schiffen und Sportbooten betauchten. Diese Vorstellung ließ mich fortan nicht mehr los. Wahrscheinlich wollte ich noch einen draufsetzen, denn Joe Hohmann erinnert sich, wie ich sogar damals, in den späten 1960er-Jahren, bereits davon sprach, die Titanic aufspüren zu wollen. »Meine Güte, was raucht oder trinkt dieser Typ bloß«, dachte Joe damals. Er hielt meine Ergüsse über die Suche nach der Titanic, wie er heute bekennt, für ein »Hirngespinst«.
—
DANN STELLTE 1969 erneut die Navy mein Leben auf den Kopf.
Da der Vietnamkrieg ein Loch ins Budget des Pentagon gerissen hatte, sah sich die Navy zu Einsparungen gezwungen. Rangniedrige Offiziere in der Forschung wie ich wurden vor eine Wahl gestellt: Entweder verpflichteten wir uns zum Vollzeitdienst in der Navy, oder wir stiegen aus. Meinen Doktor zu machen war mir wichtig; aber ich brauchte auch eine Arbeit.
Ich werde Dr. Emery und Bill Rainnie ihre Unterstützung in dieser Zeit nie vergessen. Dr. Emery schlug vor, ich solle mich in das Doktorandenprogramm von Woods Holes einschreiben. Und als andere befanden, ich könne mich nicht in einen Studiengang einschreiben und zugleich am selben Institut arbeiten, veranlasste er, dass ich an die Graduate School of Oceanography der Universität von Rhode Island pendeln konnte, um dort meine Promotion abzuschließen. In der Zwischenzeit hatte mir Rainnie versichert, ich sei so redegewandt, dass er mich anstellen würde, um Alvins Dienste in der Gemeinde der Meeresforscher anzupreisen. Ich erinnere mich, wie er sagte: »Wenn es noch eine versunkene Wasserstoffbombe gibt, könnte die Suche danach uns genug Aufmerksamkeit verschaffen.« Und ich entgegnete ihm damals, wenn Alvin es schaffen würde, die Titanic aufzuspüren, dann würde sowieso jeder das Tauchboot nutzen wollen.
Also verließ ich die Navy und fand wieder zurück zur Meeresforschung. Primär ging es bei meiner Untersuchung um eine geologische Vermessung des Meeresgrunds im Golf von Maine. Die Theorie der Plattentektonik gewann zu der Zeit zunehmend an Sicherheit: die Vorstellung, dass die Erdoberfläche aus großen Platten besteht, die sich wie in einem riesigen, synchronen Ballett bewegen. Sie können sich auseinanderbewegen, wodurch neue Kruste entsteht; sie können sich auch aufeinander zu bewegen, wodurch alte Platten wieder ins Innere der Erde abtauchen; oder, wie heute an der San-Andreas-Verwerfung zu beobachten ist, sie schleifen aneinander vorbei und lösen dabei Erdbeben aus. Dieses Bild von dynamischen Veränderungen in der Erdkruste über Millionen von Jahren hinweg ist heute weithin akzeptiert, doch in der damaligen Zeit standen viele dieser Vorstellung noch skeptisch gegenüber. Mich selbst überzeugte die Theorie und ich hatte das Gefühl, dass meine Forschung dazu beitragen konnte, sie zu bestätigen – schließlich lag ihr Hauptaugenmerk auf dem Auseinanderdriften der Nordamerikanischen und der Eurasischen Platte unterhalb des Golfs von Maine und der daraus resultierenden Entstehung des Nordatlantiks.
Jeder, der den Weg in die Wissenschaft wählt, muss eine Menge lesen – in meinem Fall waren es Hunderte von wissenschaftlichen Artikeln, um mir das nötige Hintergrundwissen anzueignen und eine Vorstellung davon zu bekommen, worauf genau ich während meiner Expeditionen in den Golf von Maine achten sollte. Allerdings fiel mir die Lektüre nach wie vor schwer. In der Zulassungsprüfung für ein weiterführendes Studium schaffte ich es im mathematischen Teil unter die besten fünf Prozent, während ich im sprachlichen Teil nur 460 von 800 möglichen Punkten erzielte – etwa sechs von zehn Studenten schnitten hier besser ab als ich. Außerdem wusste ich, wie sehr Lärm meine Konzentration beeinträchtigt. Als ich mich daher im Frühjahr 1970 an meine Forschung machte, brauchte ich einen ruhigen Ort. Zum Glück gibt es Bibliotheken.
Das Haus, in dem Margie und ich wohnten, war klein. Unser Sohn Todd war eineinhalb und ein weiterer Sohn, Douglas, war unterwegs. Wir brauchten mehr Platz, konnten aber finanziell keine großen Sprünge machen. Im nahe gelegenen Hatchville, unweit von Falmouth in Massachusetts, entdeckte ich ein Farmhaus mit 16 Zimmern – eine Bruchbude aus dem 17. Jahrhundert und kurz vor dem Abriss. Es kostete nur 20 000 Dollar und ich konnte als Anzahlung 4000 leisten, die aus dem Entlassungsgeld der Navy stammten. Mir selbst kam das Haus vielversprechend vor und ich traute mir zu, es zu renovieren. Doch als meine Mutter es irgendwann zu Gesicht bekam, brachte sie nur hervor: »Das kann nicht dein Ernst sein.«
Da ich aber ein Ventil brauchte, um meine überschüssige Energie loszuwerden, kam mir der Umbau des Hauses, Raum für Raum, gerade recht. Ich verlegte alle Rohre und Kabel und übernahm den Trockenbau. Ich riss Wände ein und brach das alte Fundament des einstigen Kuhstalls ab. Ich pflanzte Obstbäume, um für günstige Nahrung zu sorgen. All das verhalf mir zu einer sehr disziplinierten Routine. Zunächst ging ich ins Arbeitszimmer, das ich mir über der Küche eingerichtet hatte, und las dort 45 Minuten lang wissenschaftliche Artikel. Dann folgten als Belohnung 15 Minuten Arbeit am Haus – ich riss zum Beispiel etwas mit dem Vorschlaghammer ein. Entscheidend war, dass ich die Pausenzeiten streng einhielt und mich umgehend wieder ans Lesen machte. Diese Abfolge – geistig, körperlich, geistig, körperlich – gefiel mir und ich praktiziere sie bis heute.
Ich arbeitete so hart, um über die Runden zu kommen, dass mir nur wenig Zeit für das soziale Leben blieb. Seit unserem Umzug nach Hatchville hatte ich kaum mehr Gelegenheit, mit meinen Kumpeln bei den Sea Rovers tauchen zu gehen. Meine einzigen Freunde waren meine Arbeitskollegen. Dass Woods Hole eine kleine, isolierte Gemeinschaft war, die zumeist aus Akademikern bestand, machte die Sache nicht einfacher. Auch die Ehepartner waren oft sehr gebildet. Margie selbst war nie aufs College gegangen und ich merkte, dass diese intellektuelle Atmosphäre sie einschüchterte und sie sich unwohl fühlte, wenn wir etwas mit diesen Paaren unternahmen.
Auch ich war nie zuvor in Gesellschaft so vieler berufstätiger Frauen gewesen. So klug meine Mutter auch war – sie war als Hausfrau zu Hause bei den Kindern geblieben, genau wie die meisten anderen Mütter ihrer Zeit. Allmählich wurde mir bewusst, dass mein Bruder und ich uns beide dafür entschieden hatten, Hausfrauen genau wie unsere Mutter zu heiraten. Zwar war Margies Unbehagen im Umgang mit den Leuten aus Woods Hole leicht beunruhigend, doch da ich so viel zu tun hatte, dachte ich nicht weiter darüber nach. Außerdem freundete Margie sich auch mit einigen Ortsansässigen an.
—
FÜR MEINE PROMOTIONSFORSCHUNG fuhr ich auf den Golf von Maine hinaus – ein Becken, das entstanden war, als die Kontinentalplatten einst auseinanderdrifteten. Mein Ziel war, ein 3-D-Bild dieses inzwischen versunkenen Gebiets zu erstellen und auf diese Weise Daten zu erheben, mittels derer sich plattentektonische Vorgänge dokumentieren ließen. Alle 20 Sekunden feuerte ich einen Luftpulser ab, der den Meeresboden durchdrang. Die zurück an die Oberfläche reflektierten Druckwellen erlaubten uns, Bilder von den darunter verborgenen Strukturen zu erzeugen. Die ständigen Druckluftentladungen strapazierten die Nerven – vor allem derjenigen, die gerade schlafen wollten. Ein Besatzungsmitglied verlor irgendwann die Beherrschung und ging mit einem Messer auf mich los. Wer hätte gedacht, dass es in der Wissenschaft so brutal zugeht?
Gleichzeitig bewarb ich mich um staatliche Förderung, um Alvin mit zusätzlichen Instrumenten auszurüsten. Als ich meine Forschung aufnahm, lag das Boot im Trockendock. Es war geflutet worden und gesunken, nachdem einige Drahtseile gerissen waren; nun wurde es generalüberholt.
Landgeologen klettern einfach in ihren Geländewagen, fahren die Flanken eines Vulkans hinauf, und schon können sie durchs Lavafeld kurven. Auch ich bin ein Feldgeologe, nur eben unter Wasser, und ich wollte aus Alvin meinen ganz persönlichen Geländewagen für Fahrten auf dem Meeresboden machen, um auf Gestein einzuhämmern und Proben einzusammeln, die bei der Entschlüsselung der Geologie hilfreich sein konnten. Für das Entnehmen von Gesteinsproben wollte ich einen Bohrer mit Diamant-Bohrkrone anbringen und ich brauchte Akustiktransponder, um Alvins Bewegungen unter Wasser genauer nachverfolgen zu können. Durch solche Verbesserungen würden wir präzisere Daten bekommen und anderen Wissenschaftlern ermöglichen, die Entdeckungen zu überprüfen.
Tatsächlich erhielt ich nun, mit neuer Ausstattung und einem wieder zum Leben erweckten Alvin, interessante Ergebnisse. Nachdem ich vom Golf von Maine Gestein an die Oberfläche gebracht hatte, untersuchte ich dessen radioaktiven Zerfall und konnte es auf ein Alter von etwa 180 Millionen Jahren zurückdatieren, auf die Zeit der Öffnung des nördlichen Atlantiks. Diese Erkenntnisse stützten die Theorie der Plattentektonik – und zeigten, zu welcher Art von Wissenschaft mein kleiner Unterwasser-Geländewagen fähig war.
1971 schilderte Xavier Le Pichon, ein Meeresgeophysiker am CNEXO (dem Nationalen Zentrum für die Nutzung der Meere, einem französischen Regierungsinstitut), in einem Schreiben an Dr. Emery das Anliegen seines Teams, in der Grabensenke des Mittelatlantischen Rückens zu tauchen. Der Rücken ist Teil der längsten Gebirgskette der Erde und erstreckt sich fast ausnahmslos unter Wasser, in der Mitte des Atlantiks in Nord-Süd-Richtung, von der Arktis bis in den Süden Afrikas. Le Pichons Ziel war die Vermessung eines Gebiets von 150 Quadratkilometern Größe etwa 400 Seemeilen südwestlich der Azoren, von dem man annahm, dass es ein sogenanntes Spreading-Zentrum zwischen zwei divergenten tektonischen Platten sei. Ob wir glaubten, so seine Frage, dass man die Region mit Tauchbooten genauer vermessen könnte als mit Sonarfahrzeugen und Instrumenten, die Schiffe an der Wasseroberfläche ziehen? Und ob man auf diese Weise weitere Erkenntnisse gewinnen könnte, die die Theorie der Plattentektonik untermauern würden?
Für meine Begriffe ging es den Franzosen um einen Technologietransfer. Was Tiefseetauchgänge anging, so kam an Woods Hole niemand vorbei. Wir hatten Alvin und wir entwickelten gerade neue Technologien zur Positionsverfolgung. Die Franzosen wollten an dieses Wissen heran. Aber genau wie sie wollten auch wir mehr über die Geologie des Mittelatlantischen Rückens erfahren und ich war mir bewusst, dass eine derartige Expedition meinen großen Durchbruch bedeuten könnte.
Emery ließ mich eine Antwort verfassen, in der wir uns für das Projekt aussprachen. Jim Heirtzler, Vorsitzender der Abteilung für Geophysik und Geologie am Woods-Hole-Institut, übernahm die Leitung und wies mich an, für ein Treffen im Januar 1972 in Princeton eine Präsentation über die Einsatzmöglichkeiten von Alvin zu erstellen. Die Giganten der Geowissenschaften aus allen Teilen der Welt würden dort anwesend sein. Wenn alles gut verlief, würde sich die National Science Foundation den Franzosen anschließen und das Projekt mitfinanzieren.
Unter Meeresforschern haben Geophysiker den Ruf, große Denker zu sein, doch sie nutzten bis dahin nur hinter Überwasserschiffen hergezogene Sensoren, um den Meeresboden zu vermessen und sein magnetisches Profil zu bestimmen. Niemand war je hinabgetaucht und tatsächlich Zeuge davon geworden, wie frische Lava aus dem Erdinneren strömt und sich dort, wo sich die Platten trennen, neue Kruste bildet. Die großen Theoretiker brauchten empirische Wissenschaftler wie mich, um sicherzustellen, dass ihre Hypothesen auf Fakten fußten.
Da war ich nun, ein einfacher Doktorand und der Einzige in der Gruppe ohne Titel vor dem Namen, und sollte präsentieren, wie ich Alvin einsetzte, um diese Art von Beobachtungen einzuholen. Ich stand unten auf dem Parkett eines steil ansteigenden Hörsaals von Princeton und blickte hinauf in einen Himmel voller Titanen, von denen mir viele nicht eben freundlich gesinnt waren. Ich kam mir vor wie Daniel in der Löwengrube. Mit weichen Knien hielt ich meinen Vortrag. Frank Press, Geophysiker am MIT und späterer wissenschaftlicher Berater von Präsident Jimmy Carter, fragte mich direkt im Anschluss abschätzig, welchen maßgeblichen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn denn jemals ein Tauchboot ermöglicht hatte.
Jeder im Raum starrte auf mich herab, während mein Gehirn ratterte. Was konnte ich entgegnen? Viel Wissenschaft hatte Alvin ja noch nicht betrieben. Dann erhob sich Bruce Luyendyk – ein junger Geophysiker und wahrer Senkrechtstarter, der am Scripps promoviert hatte und nun für Woods Hole arbeitete. Er hatte eine freche Art und ich schätze ihn bis heute. Er blickte Press direkt an und erklärte ihm, dass er dafür nicht den Tauchbooten die Schuld geben könne. Die wissenschaftliche Gemeinde hatte noch nie versucht, sie in so großer Tiefe einzusetzen.
Beim Abendessen saß ich Maurice Ewing gegenüber, dem Gründer des Lamont-Doherty Earth Observatory, eines geowissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Columbia University. Er hatte schon etwas getrunken, als er mit seinem Zeigefinger in meine Richtung deutete. Unter Umständen würde er das Projekt unterstützen, sagte er, bevor er hinzufügte: »Wenn Sie scheitern, dann schmelzen wir Ihr Tauchboot ein und machen aus dem Titan Büroklammern!« Er warf mir regelrecht den Fehdehandschuh hin.
Mein Ehrgeiz war geweckt. Wir kriegen das hin, dachte ich. Die Akademie der Wissenschaften war einverstanden und die Französisch-Amerikanische Mittelozeanische Unterseestudie, bekannt als Project FAMOUS, war geboren.
—
DIE VORBEREITUNG AUF DAS FAMOUS-PROJEKT bedeutete nach meiner Promotionsforschung eine gewaltige Umstellung. Für mich war es ein Sprung vom Kontinentalrand in die Tiefsee. Ich hatte keine Erfahrung in der Tiefseeforschung, aber ich freute mich darauf. »Wenn sie uns tatsächlich mit unseren winzigen Tauchbooten in den Großen Graben tauchen lassen«, dachte ich, »wie sollen wir da unser Ziel verfehlen?« Wir würden die Vorreiter sein, die Allerersten, die in diese Welt hinabfuhren, um die Entstehung der Kruste zu beobachten und Teile der neu entstandenen Haut unserer Erde einzusammeln.
Die Franzosen sollten 1973 mit ihrem Bathyskaph, der Archimède, den Auftakt machen. Als einziger Amerikaner würde – wegen meiner Erfahrungen mit Alvin – ich sie begleiten. Dann sollte ich im darauffolgenden Jahr erneut hinausfahren, diesmal mit dem amerikanischen Team und mit Alvin, das gerade eine neue Titanhülle erhielt, die seine Tauchtiefe auf 3600 Meter verdoppeln würde – 800 Meter mehr als nötig, um die Grabensenke zu erreichen.
Abgesehen von der Wissenschaft war die Zusammenarbeit mit den Franzosen für mich nicht zuletzt deshalb großartig, weil sie mir Gelegenheit gab, nach Übersee zu reisen. Zur Organisation von Konferenzen flog ich nach Frankreich, wo ich mich mit Jean Francheteau, einem der Wissenschaftler, und Jean-Louis Michel, einem Ingenieur, näher anfreundete. Francheteau hatte am Scripps-Institut promoviert und dort seine Frau Marta, eine zauberhafte Amerikanerin, kennengelernt. Zwischen ihm und mir stimmte einfach die Chemie. Er war ein robuster, gut aussehender Mann mit lockigem Haar und großartigem Lachen – ein echter Kerl, auf seine französische Art. Außerdem ein absolut brillanter Kopf.
Er und Marta lebten in einem alten Bauernhaus in Brest im äußersten Westen Frankreichs, wo der Staat ein Meeresforschungszentrum betrieb. Während meines Aufenthalts wohnte ich bei ihnen und machte durch Jean auch Bekanntschaft mit Weinbergschnecken, landestypischen Käsesorten und Pasteten – kurz mit der feinen französischen Küche. Jean ging zu Fuß zur Arbeit, und als ich ihn begleitete, suchte er am Wegesrand nach Pilzen. Dank seiner kulinarischen Vorbereitung fühlte ich mich meinem Aufenthalt an Bord des französischen Forschungsschiffs gewachsen. Ich selbst war ja praktisch nur mit Fleisch und Kartoffeln groß geworden – doch auf einem französischen Schiff wurden Zunge und Innereien aufgetischt und es hieß: Friss oder stirb.
So fand ich mich im Sommer 1973 auf hoher See wieder. Ich trieb über dem Mittelatlantischen Rücken, während Le Pichon den ersten Tauchgang mit Archimède anführte. Dieses Tauchboot älterer Bauart ließ Alvin zwergenhaft erscheinen, war dafür aber deutlich schlechter zu manövrieren. Es fuhr wie ein Lastenaufzug einfach gerade hinab und wieder herauf. Ich beobachtete, wie der Projektleiter die Arbeit des ersten Tages beendete – im Wissen, dass tags darauf ich mit der Archimède an der Reihe sein würde.
Als ich an jenem Augustmorgen aufwachte, fühlte ich mich elend. Ich hatte mit Fieber und einer Halsentzündung zu kämpfen, wollte aber die Gelegenheit dieses Tages sicher nicht verpassen. Ich gurgelte mit warmem Salzwasser und machte mich bereit für den Tauchgang.
Zu dritt kletterten wir ins Innere der Archimède. Meine Begleiter, ein Marineoffizier und ein Ingenieur, waren beide Franzosen. Ihr gebrochenes Englisch war deutlich besser als mein Französisch, das nicht weit über »Bonjour!« hinausging. Der Bathyskaph schwamm aufgrund seiner riesigen Tanks, die mit Flugzeugbenzin gefüllt und deshalb leichter als Wasser waren. Zum Abtauchen füllte er seine Lufttanks mit Meerwasser und ließ etwas von dem Benzin ab.
Nun ging es nach unten. Bis zum Meeresboden dauerte es 90 Minuten, und dort bot sich uns dann ein wunderbarer Anblick. Ich sah mich um und sog alles in mich auf. Zu schwarzen, glasähnlichen Formen erstarrte Lava verlief symmetrisch in beiden Richtungen entlang der zentralen Achse der Grabensenke. Diese Landschaft bestand aus relativ neuer Erdkruste, das konnte man gar nicht übersehen. All die Einwände gegen die Theorie der Plattentektonik lösten sich einfach so auf. Der Beweis lag direkt vor unserem Sichtfenster.
Wir manövrierten langsam und entnahmen mit dem Greifarm der Archimède eine Gesteinsprobe. Dann passierte etwas Ungewöhnliches. Die Nase des Fahrzeugs kippte plötzlich nach unten, und ehe ich mich versah, stiegen wir mit Höchstgeschwindigkeit auf. Ich blickte auf die Instrumententafel. Die Anzeigenadel des Strommessers war abgefallen. Ein Stromausfall, dachte ich, und als dessen Folge hatten sich offenbar die elektromagnetischen Schieber der Ballastsilos geöffnet. Dadurch war etwas von dem schweren Eisenschrot freigesetzt worden, den die Archimède abwarf, um das Auftauchen einzuleiten. Während wir nach oben schossen, vernahm ich das Letzte, was man in dieser Situation hören will: »Au feu – Feuer!« Gleichzeitig stieg Rauch in meine Nase.
Meine Begleiter sprachen in schnellem Französisch mit den Leuten an der Oberfläche. Wir drehten die Sauerstoffzufuhr ins Innere der Tauchkugel ab und setzten unsere Sauerstoffmasken auf. Doch sogar mit Maske wurde mir schwindlig. »Vielleicht hyperventiliere ich«, war mein erster Gedanke. Ich konzentrierte mich auf meine Atmung, was mit angeschwollenem Rachen gar nicht so einfach war. Ich ließ bewusst Atemzüge aus, um meinen Sauerstoffspiegel zu senken, doch nach wie vor war ich benommen und mir war schwindlig. »Vielleicht stimmt etwas mit meinem Atemgerät nicht«, dachte ich und machte mich daran, es abzuziehen und zu untersuchen. Meine französischen Begleiter hielten das für eine Panikreaktion und pressten mir die Maske wieder ins Gesicht, sodass wir einige Augenblicke miteinander rangen. Dann sah ich im Blick des Piloten, dass es ihm dämmerte.
»Pardon, Bob«, sagte er, während er sich in die Höhe streckte, um das Ventil zu öffnen, das mich mit Sauerstoff versorgte. Das war bei einem Notfall eine seiner Aufgaben. In der allgemeinen Panik hatte er das vergessen, ebenso wie ich selbst.
Danach ging es mir wieder gut. Aber bei jedem späteren Treffen reckte sich der Pilot, sagte »Pardon, Bob« und tat so, als stelle er meinen Sauerstoff an. Lustig fand ich das nicht.
Alles in allem unternahmen die Franzosen während des ersten Teils des FAMOUS-Projekts sieben Tauchgänge. Wieder zu Hause, schloss ich mich ein und brachte in einem zehnmonatigen Endspurt meine Dissertation zum Abschluss: The Nature of Triassic Continental Rift Structures in the Gulf of Maine. Die Verteidigung der Doktorarbeit war ein weiterer Moment der Anspannung. Etliche Fakultätsangehörige stellten mir schwierige Fragen. Doch die harte Arbeit zahlte sich aus. Ich bestand. Ich hatte meinen Doktortitel in der Tasche und für den Rest meines Lebens konnte mir nie mehr jemand sagen, ich hätte nicht das Zeug dazu.
—
GUT GELAUNT KLETTERTE AM 1. JULI 1974 ein Mann namens Dr. Ballard an Bord von Alvin. Seit ich meine mündliche Promotionsprüfung bestanden hatte, waren nur wenige Tage vergangen, und nun kehrten wir für die zweite Phase des FAMOUS-Projekts zurück an den Mittelatlantischen Rücken. Die Franzosen arbeiteten im nördlichen Teil der Grabensenke mit der Archimède und einem neuen, untertassenförmigen Tauchboot, der Cyana, während das amerikanische Team mit Alvin weiter südlich tauchen würde.
Behutsam, um keines der Instrumente zu treffen, ließen sich drei von uns in die kleine Tauchkugel hinabsinken, deren Durchmesser gerade mal zwei Meter betrug. Darüber hinaus war sie bis obenhin mit Anzeigefeldern und Technik vollgepackt. Es war, als kletterte man ins Innere einer Schweizer Uhr. Sobald alle eingestiegen waren, setzten wir uns mit angewinkelten Beinen auf den Boden und lehnten uns von innen an den Druckkörper, wo jeder von uns sein eigenes Fenster hatte. Da in der Enge des Raums unsere Beine kreuz und quer übereinanderlagen, wurde aus dem Tauchen schnell ein Gemeinschaftserlebnis und wir witzelten, dass wir vor dem Aussteigen zuerst unsere Beine entknoten müssten. Wegen meiner Körpergröße war das tatsächlich nur eine geringe Übertreibung. Mit Pullover und Sandwich machten wir es uns in der Kugel gemütlich – eine alte Tradition in Tauchbooten, um während der üblichen acht Stunden unter Wasser Kälte und Hunger zu trotzen.
Der Pilot ging vor Beginn des Tauchgangs die Checkliste durch. Solange Alvin an der Wasseroberfläche war, herrschten in der Kugel weit über 30 °C, doch während des Abstiegs kühlte sie zusehends ab. Nach Erhalt der Taucherlaubnis fluteten wir unsere Lufttanks mit Meerwasser, wodurch sie schwerer wurden und wir abtauchten. Der Abstieg war langsam, mit etwa 30 Metern pro Minute oder knapp zwei Stundenkilometern. Fast als stünde man still. Wir ließen uns einfach sinken – den Antrieb des Tauchboots nutzten wir für den Abstieg nicht, da wir die Energie der Batterien für das Manövrieren am Meeresgrund sparen wollten. Die Schwerkraft erledigte die Arbeit für uns, und bis wir auf 2800 Meter Tiefe hinabgesunken waren, dauerte es eineinhalb Stunden.
Oft werde ich gefragt, wie ich meine große Energie in diesem beengten Raum so lang unter Kontrolle halten kann. Ich konzentriere mich sehr stark, vor allem durch meinen Blick, der sich unablässig nach draußen richtet. Während des Abstiegs wird es dort zunehmend dunkler, und dann erzeuge ich die dreidimensionale Landschaft selbst in meinem Kopf – mithilfe der auf den Instrumenten angezeigten Werte. Am Grund angekommen, erhellt dann das Licht aus Alvins Scheinwerfern die Szenerie. Ich bin ganz gebannt.
Nach dem Abtauchen verstummen nach und nach alle Geräusche von draußen, nur der Klang unserer Bordinstrumente bleibt übrig, die im Chor zu uns singen. Das Sonar macht ein charakteristisches Sch-sch-sch-sch-bing-bing-Bing, das mit seiner Aufschlüsselung der Landschaft um uns herum variiert. Ab und zu erreicht uns auf dem Schallwellentelefon eine Stimme aus dem Schiff über uns.
Zunächst befinden wir uns noch in der oberen Schicht, die von Haien und Delfinen bevölkert ist. Ich nenne sie die Cousteau-Schicht – das ist der sonnendurchflutete Teil des Ozeans, der von Jacques Cousteau in seinen Fernsehsendungen gezeigt wurde. Cousteau verbrachte die meiste Zeit in dieser seichteren Zone, und wir sagen immer, dass wir ihm auf unserem Weg zur Arbeit zuwinken.
Bald darauf bietet sich uns in der nächsten Region ein Anblick, den wir den umgekehrten Schneesturm nennen: Partikel von toten Tieren aus der oberen sonnigen Zone sinken langsam zu Boden, wo sich die Überreste ansammeln und langsam eine Schicht aufbauen, etwa einen Zentimeter pro Jahrtausend. Da diese Partikel kaum etwas wiegen, entsteht der Eindruck von Schneefall, doch weil wir schneller sinken, als die Teilchen fallen, sieht es so aus, als steige der »Schnee« nach oben. Das ist unser einziges Indiz, dass wir in Bewegung sind.
Wenn wir auf unserem Abstieg die Dämmerungszone erreichen – in etwa 200 Metern Tiefe –, erlischt das Sonnenlicht allmählich. 100 Meter tiefer ist es bereits stockdunkel. Dann startet das Feuerwerk, die Biolumineszenz, weil die Bewegung des vorbeiziehenden Tauchboots Lebewesen aufschreckt und sie veranlasst zu leuchten. Unser Blick geht starr durch das Fenster hinaus auf diese schwach funkelnden Sterne und kaleidoskopischen, plötzlich aufscheinenden Lichter. Das Schauspiel entfaltet einen ganz besonderen Zauber und findet in großer Stille statt. Wir hängen unseren eigenen Gedanken nach, während wir durch diese ozeanischen Welten gleiten, in denen es mehr Lebewesen gibt als irgendwo sonst auf der Erde. Manchmal höre ich Musik, während ich diese Welt an mir vorbeiziehen lasse.
Bei unserem Abstieg durch die Dämmerungszone passieren wir auch die tiefe Echostreuschicht – eine Welt von seltsamen Wesen, die nachts zum Fressen aufsteigen und dann vor Sonnenaufgang wieder tiefer hinabtauchen, um nicht selbst gefressen zu werden. Diese Schicht erhielt ihren Namen, als ein zur Messung der Wassertiefe eingesetztes Echolot an Bord eines Schiffs falsche Werte lieferte, weil der Schallstrahl von den Milliarden Kleinstlebewesen hier reflektiert wurde.
Auf etwa 1000 Metern Tiefe gehen wir in die Mitternachtszone über, in der sich kaum noch irgendetwas abspielt. Wir fallen weiter und es fällt schwer, sich vorzustellen, dass wir gerade in eine Gebirgskette hinabsinken. Normalerweise muss man Gebirge ersteigen, nicht zu ihnen hinuntertauchen. Es ist etwa so, als würde man einen Rundflug in einem Ballon machen – nachts mit einer Taschenlampe in den Rocky Mountains. Manchmal hörte ich während den Tauchgängen John Denvers Lied Rocky Mountain High. Seine Stimme klang herrlich in unserer kleinen Kugel.
Sobald wir an dem Punkt angelangt sind, wo es nur noch wenig zu sehen gibt, widmen wir uns den mitgebrachten Briefen, deren Absender sich ein Souvenir aus der Tiefe wünschen. Wir wollen sie während des Tauchgangs beantworten, geben dabei unseren Namen an sowie den Breiten- und Längengrad, an dem wir uns jetzt gerade befinden – genau so, wie das Astronauten im Weltall machen. Für gewöhnlich schrieben wir etwa 20 dieser Briefe während eines Tauchgangs und versandten sie, wenn wir zurück an Land waren.
In dieser Tiefe muss man sich immer über den Wasserdruck bewusst sein. Wenn ein Leser dieses Buchs ungefähr auf Meereshöhe zu Hause auf der Veranda sitzt oder die Straße entlangläuft, lastet eine Atmosphäre Druck auf ihm, oder, anders formuliert, ein Kilo auf jedem Quadratzentimeter seines Körpers. Sobald man unter Wasser ist, kommt pro zehn Meter Tiefe eine weitere Atmosphäre Druck hinzu. Wenn wir uns also 1000 Meter tief unter Wasser befinden, drücken 100 Atmosphären – oder 100 Kilo – von außen auf jeden Zentimeter von Alvins Rumpf. In 2800 Metern Tiefe lastet mehr als eine Vierteltonne Druck auf jedem Quadratzentimeter – genug, um uns auf der Stelle zu töten, wenn etwas schiefläuft. Aber zum Glück beschützt uns der Druckkörper um uns herum vor dem nur einige Zentimeter entfernt drohenden Unheil.
—
FAST SIEBEN WOCHEN LANG tauchten wir in diesem Sommer wieder und wieder mit Alvin hinab, verbrachten fünf Stunden in der Nähe des Grunds und kehrten an die Oberfläche zurück, um die Batterien erneut aufzuladen. Jedes Mal kam es uns wie ein Wunder vor, dort, wo sich die tektonischen Platten trennen, die neue Kruste zu sehen. Doch wir konnten es uns nicht leisten, einfach nur aus dem Fenster zu starren und nichts zu tun. Wir machten Fotos, sammelten Gesteinsproben und bündelten die gewonnenen Daten, um eine dreidimensionale Karte des Gebiets zu erstellen. Mit Ausnahme der Mittagspause – Pfeffersteak, Fleischwurst oder Erdnussbutter-Marmelade-Sandwichs – arbeiteten wir, sobald wir am Grund angekommen waren, fast ohne Unterbrechung. Eine wesentliche Entdeckung bestand darin, dass der Spalt, aus dem Lava zwischen den beiden tektonischen Platten hervorquoll, mit weniger als einem Kilometer Breite nur schmal war. Man konnte in einem einzigen Tauchgang von einer Krustenplatte zur gegenüberliegenden Schwesterplatte fahren.
Einmal jagte uns ein Erlebnis einen gehörigen Schrecken ein: Drei meiner Kollegen waren gerade am Meeresboden unterwegs, ich befand mich auf dem Oberflächenschiff und verfolgte ihre Fahrt auf einem Stück Papier, wo ein Gerät Alvins Bewegungen nachzeichnete. Wenn Alvin anhielt, um Gesteinsproben einzusammeln, wuchsen die Punkte, die seinen Standort markierten, zu einem Tintenfleck an. Bewegte sich das Boot erneut, ergab sich aus den Punkten wieder eine Linie.
Nach mehr als einer Stunde bemerkte ich, dass der Tintenfleck wuchs und wuchs und wuchs. »Normalerweise sollten sie nicht lang an dieser Stelle bleiben«, dachte ich. »Was ist da los?« Ich setzte mich an ein Telefon, das Schallwellen durchs Wasser übertrug, und rief Pilot Jack Donnelly unten im Boot an, um ihn ans Weiterfahren zu erinnern. Er sagte, dass sie es ja versuchten!
Sie versuchen es? Ich wurde hellhörig. Da auf einem Schiff in der Nähe Walter Sullivan, ein Reporter der New York Times, unsere Nachrichten mithörte, wollte die Besatzung nichts über ein mögliches Problem verraten. Doch irgendetwas hielt sie davon ab, sich wieder in Bewegung zu setzen. Wir mussten ein anderes U-Boot nach unten schicken, um ihnen zu helfen. Ich funkte meinen Ansprechpartner auf dem französischen Schiff an – Gérard Huet de Froberville, Kapitän der Archimède – und erkundigte mich nach seinem Befinden. Dann fragte ich ganz unschuldig, wann er wohl das nächste Mal auf Tauchstation gehen würde.
Auch er wurde hellhörig und begriff, worum es ging. Vielleicht würde er uns einfach einen Besuch abstatten, meinte er. Eine gute Idee, erwiderte ich.
Das französische Rettungsteam war gerade auf dem Weg zu uns, als das Telefon piepste. Der Pilot von Alvin war an der Leitung: Es gehe ihnen gut und sie würden ihre Erkundung nun fortsetzen.
Als sie wieder oben waren, erfuhr ich, warum der Tintenfleck immer größer geworden war. Wenn Vulkane ausbrechen, entstehen Erhebungen aus frischer Lava. Die Bewegung der Platten zieht die Lava auseinander und lässt Risse entstehen, die sich schließlich tief bis ins Innere einer Magmakammer erstrecken – ein mit geschmolzenem Gesteinsmaterial gefüllter Hohlraum unterhalb der Erdoberfläche. Irgendwann entleert sich die Kammer in einer Eruption. Die Besatzung hatte einen dieser Risse erforscht und er wirkte so breit, dass sie mit Alvin hineintauchten, um den Aufbau der Schichten im Inneren des Lavastroms in Augenschein zu nehmen.
Aber wenn ein Tauchboot nach unten fährt, dann nie nur hinunter, sondern immer zugleich vorwärts. Unsere Jungs waren also vorwärts und nach unten in die Spalte gefahren, ohne zu bedenken, dass sie zum Auftauchen ausreichend Freiraum über sich benötigten. Während sie in die Spalte hineinmanövrierten, war diese über ihnen immer enger geworden. Das Boot war in dem Riss stecken geblieben. Es saß fest.
Dass die Besatzungsmitglieder nicht den nassen Tod fanden, hatten sie einzig und allein der gläsernen Beschaffenheit der noch jungen Lava über ihnen zu verdanken. Mehr als eine Stunde lang stießen sie immer wieder von Neuem gegen die Decke, um den Raum über sich Schritt für Schritt zu vergrößern; so gelang es ihnen schließlich, sich aus der Engstelle zu befreien. Zurück an der Oberfläche, steckten Scherben der glasähnlichen Lava seitlich in Alvins Rumpf. Die Besatzung hatte unwissentlich ein paar Gesteinsproben gesammelt – und überlebt, um davon berichten zu können.
—
UNGEACHTET ALLER BEINAHE-UNGLÜCKE war das FAMOUS-Projekt ein voller Erfolg. Die Amerikaner führten 17 Tauchgänge mit Alvin durch. Die Franzosen tauchten 27-mal mit der Archimède und der Cyana. Das ganze Projekt unterstrich eindrucksvoll das Potenzial von Tauchbooten in der Tiefsee. Sie ermöglichten Feldgeologen wie mir, sich die Hände schmutzig zu machen – sozusagen das Feld des Ozeans zu begehen.
Der Meeresboden dehnte sich aus; wir konnten es mit eigenen Augen sehen. Wir tauchten hinunter zu der Grenze seiner Entstehung, in den Schoß von Mutter Erde, und dokumentierten den Vorgang, der sich entlang des Mittelatlantischen Rückens abspielte. Das war der letzte Beweis für jene, die die Plattentektonik anzweifelten. Wir waren nun in der Lage, Tausende von Fotos sowie Gesteinsproben und unsere eigenen Beobachtungen ins Feld zu führen, um diese Theorie zu bestätigen. Die Skeptiker konnten nicht länger spotten und Alvin blieb die Schande erspart, zu Büroklammern verarbeitet zu werden.
Meine ersten Jahre in der Forschung umspannten 180 Millionen Jahre, von der Öffnung des Atlantiks im Golf von Maine bis zur Entstehung neuen Meeresbodens im Mittelatlantischen Rücken heute. Mit der Arbeit für meine Dissertation und dem FAMOUS-Projekt hatte ich meine ersten Schritte als Wissenschaftler gemacht. Und ich hatte richtig Fuß gefasst! Sicher ein ungewöhnlicher Start der wissenschaftlichen Laufbahn eines Meeresgeologen aus Kansas.