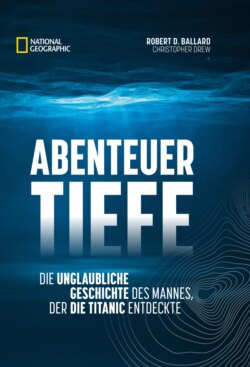Читать книгу Abenteuer Tiefe - Christopher Drew - Страница 11
KAPITEL 4 ZEIT FÜR NEUE LEHRBÜCHER
ОглавлениеWährend meiner Arbeit am FAMOUS-Projekt hatte ich den Kontakt zu den Sea Rovers aufrechterhalten und mich sogar um die Organisation der Vorträge für die alljährliche Tagung gekümmert. Bei einem der Treffen erzählte ich Melville Grosvenor von unserer Forschung zur Plattentektonik und unseren Tauchgängen an der Grabensenke des Mittelatlantischen Rückens. Obwohl er inzwischen aus der Spitze der National Geographic Society ausgeschieden war, hatte sein Wort dort noch Gewicht und er sagte: »Warum schreiben Sie darüber nicht einfach einen Artikel für unser Magazin?« Er stellte mich den Redakteuren vor und im Mai 1975 erschien der Artikel: Dive Into the Great Rift. Ich war Teil der National-Geographic-Familie geworden – eine Verbindung, die ein Leben lang anhalten sollte – und froh über die Gelegenheit, Laien die Wissenschaft näherzubringen und meine Begeisterung für die Unterwasserforschung mit ihnen zu teilen.
Doch als ich kurz nach Erscheinen des Artikels im Woods-Hole-Institut auf dem Gang an einem Kollegen vorbeilief, machte der eine abfällige Bemerkung, weil ich in einer Publikumszeitschrift veröffentlicht hatte.
»Dann ist es dir anscheinend entgangen«, gab ich zurück, »dass wir über dasselbe Thema letztes Jahr schon in Nature geschrieben haben« – einer der weltweit angesehensten wissenschaftlichen Fachzeitschriften.
Ich war immer der Überzeugung, dass ein guter Wissenschaftler in der Lage sein muss, seine Forschungen jedem interessierten Zuhörer verständlich zu machen – ob nun einem Collegeabsolventen oder einem Fünftklässler. Allerdings vertrat man an den meisten Forschungseinrichtungen andere Meinungen. Dort ging es wissenschaftlichen Puristen einzig und allein um die Publikation in renommierten Zeitschriften, da das ihrer Reputation den meisten Glanz verlieh. Während meiner Promotion hatte ich selbst gelernt, dieses Spiel zu spielen, und jetzt, im Jahr 1975, stand ich sogar unter noch größerem Druck, wichtige Entdeckungen zu machen und sie in Fachzeitschriften zu veröffentlichen, denn ich brauchte eine Festanstellung und somit die Freiheit, mich wissenschaftlich genau den Dingen widmen zu können, die mich am meisten interessierten.
Ich war 33, und um meine Karriere als Wissenschaftler am Woods-Hole-Institut fortführen zu können, musste ich bis zu meinem 39. Lebensjahr eine Festanstellung erhalten. Das Programm des Instituts war glänzend und die Messlatte lag enorm hoch. Die meisten Wissenschaftler, die nach ihrer Promotion dort eine Stelle antraten, mussten irgendwann weiterziehen.
Ich hatte drei Jahre in der Navy verbracht, und ich war zwar in dieser Zeit auch zu Forschungarbeit gekommen, aber dennoch hatten mir die meisten meiner gleichaltrigen Fachkollegen etwas voraus. Trotz der Navy-Projekte ging die Haltung in Woods Hole in die Richtung von: »Pech gehabt! Das war Ihre Entscheidung.« Ich hatte nie eine Bevorzugung wegen meines Militärdiensts erwartet – aber eine Bestrafung sicher auch nicht. Also musste ich wirklich eine Schippe drauflegen. Ich weiß noch, wie ich dachte: »Oje, werde ich das wirklich schaffen?«
In das Jahr 1976 startete ich mit einer Tauchmission am Kaimangraben, die uns hinunter bis in Alvins neue maximale Tauchtiefe von 3600 Metern führte. Wir wollten ein Spreading-Zentrum zwischen zwei Platten im Karibischen Meer erforschen, wo die tiefsten damals bekannten Unterseevulkane liegen. Von der National Science Foundation hatte ich soeben meinen ersten Zuschuss als Projektleiter erhalten, um diese Platten zu erforschen, die aneinander vorbeigleiten wie jene an der San-Andreas-Verwerfung, wobei durch die entstehenden Hohlräume geschmolzene Lava austritt. Wir befanden uns in der ersten Phase einer mehrjährigen Untersuchung und mir leuchtete nicht ein, warum ich nicht sowohl Wissenschaftler als auch Entdecker sein konnte – für renommierte Zeitschriften schreiben und zugleich die Allgemeinheit an der Faszination meiner Erkundungen teilhaben lassen. Also lud ich Emory Kristof, Fotograf für National Geographic, und Walter Sullivan, Wissenschaftsjournalist der New York Times, ein, sich uns anzuschließen. Ich tauchte zusammen mit anderen Forschern in den Graben, machte Fotoaufnahmen und sammelte Gestein, das uns mehr über den Aufbau der Erdkruste verraten würde.
—
INMITTEN DES PROJEKTS nahm ich allerdings eine kurze Auszeit für eine Unterwasser-Suchmission der anderen Sorte, die meine etwas traditioneller veranlagten Kollegen vermutlich auf die Palme brachte: Ich unterstützte National Geographic bei einem Artikel über das Ungeheuer von Loch Ness.
Als Emory Kristof vorschlug, ich solle mein wissenschaftliches Fachwissen zur Suche nach diesem sagenumwobenen Wesen einsetzen, dachte ich: »Warum eigentlich nicht?« Einiges sprach dafür. Ich hatte noch nie die schottischen Highlands gesehen – und nun ergab sich für Margie und mich die Gelegenheit, das nachzuholen, und man bezahlte mich noch dafür. Wir konnten das Geld aus diesem Projekt gerade gut gebrauchen. Und offen gesagt schadet es manchmal nicht, wenn man sich selbst nicht ganz so ernst nimmt – das redete ich mir jedenfalls ein. Also schlossen Emory und ich uns einer Gruppe von Tauchern an und setzten Sonar und Unterwasserfotografie ein, um uns ein Bild vom Grund des Sees zu machen. Zusätzlich brachten wir an einer speziell dafür angefertigten Vorrichtung Köder an, um das Ungeheuer ans Tageslicht zu locken.
Meine Überlegung war: Wenn es ein Ungeheuer von Loch Ness (im Singular) gab, dann musste es auch Ungeheuer von Loch Ness (im Plural) geben. Die erste Sichtung von »Nessie« ist aus dem Jahr 565 überliefert. Dann ist es wieder auf einem geheimnisvollen Foto aus den 1930er-Jahren zu sehen. Falls diese Tierart also über weit mehr als 1300 Jahre hinweg im Loch Ness überleben konnte, musste es in diesem Zeitraum mindestens 25 Nessies gegeben haben, um die Population aufrechtzuerhalten. Folglich sollten überall Nessie-Gerippe herumliegen, da Knochen sich – anders als in der Tiefsee – in Süßwasser nicht auflösen. Ich durchkämmte den Grund von Loch Ness mit einem Schleppnetz, doch zum Vorschein kamen nur Baumstämme und Dinge wie ein Schuh und ein Teekessel.
Ein interessantes Phänomen entdeckte ich allerdings: Wenn ich genau an der Längsachse des Sees entlangnavigierte, breitete sich die Heckwelle zu den felsigen Ufern auf beiden Seiten aus und prallte von dort zurück. Nachdem wir schon ein gutes Stück weitergefahren waren, trafen sich die zurückgeworfenen Wellen wieder in der Mitte und erzeugten eine stehende Welle aus zwei bis drei kleinen Hügeln, die erst nach ein paar Sekunden wieder verschwand. War es das, was die Leute gesehen hatten?
Als ich mich von den Highlands verabschiedete, hielt ich an einer Imbissbude am Straßenrand, um mir noch einen letzten »Monsterburger« zu bestellen. Zu Beginn unseres Abenteuers hatte ich mich schon einmal mit demselben Verkäufer unterhalten und er hatte mich angefleht, bloß nicht die örtliche Wirtschaft in den Ruin zu treiben, indem ich die Legende von Nessie widerlegte. Jetzt konnte ich ihn beruhigen. »Man kann gar nicht beweisen, dass es ein Tier nicht gibt«, sagte ich ihm, »wenn es dieses Tier überhaupt nie gegeben hat.« Die Reise war unterhaltsam gewesen und zum Abschluss besuchte uns noch ein Kamerateam der Fernsehsendung In Search Of…, in der Star Trek-Schauspieler Leonard Nimoy als Moderator mysteriöse Ereignisse in aller Welt untersuchte. Ich bin sicher, dass das bei meinen wissenschaftlichen Fachkollegen wieder besonders gut ankam.
—
WENN AUS MEINER FESTANSTELLUNG ETWAS WERDEN SOLLTE, kam es jedoch darauf an, Dinge zu beweisen, und nicht, sie zu widerlegen. Durch die Erfolge des FAMOUS-Projekts und unserer ersten Reise zum Kaimangraben erkannten nun immer mehr Wissenschaftler den Wert unserer sehr visuell geprägten Herangehensweise an die Meeresforschung. Es gab einige Anfragen, ob ich mich nicht einer Expedition anschließen wollte – vorausgesetzt, ich brachte mein Handwerkszeug mit: nicht mehr nur Alvin, sondern auch Angus (das Akronym für: Acoustically Navigated Geological Underwater Survey, akustisch navigierte geologische Unterwasservermessung), einen Kameraschlitten, den wir an einem langen Schleppseil bis auf eine Tiefe von 6000 Metern ins Meer hinablassen konnten. Ursprünglich war er nur ein einfacher »Klotz am Kabel« – eine Schwarz-Weiß-Kamera, die zum Schutz in vulkanischem Gelände von einem Stahlrahmen umgeben war. Ich hatte sie um zwei größere Farbkameras erweitert und an den frischen Lavaströmen im Kaimangraben getestet, und jetzt konnte Angus Tausende von Fotos schießen, die wir entwickelten, sobald wir ihn wieder aufs Mutterschiff gehievt hatten. Darüber hinaus musste ich ein Team zusammenstellen; die Leitung übernahmen Cathy Offinger und Earl Young, die bei allen wichtigen Entdeckungen während meiner Zeit am Woods-Hole-Institut mit an Bord waren.
Es machte allmählich die Runde, dass ich gut mit dem Meeresboden auf Tuchfühlung gehen konnte. Anfang 1977 wurde ich eingeladen, ein Team aus Forschern von MIT, Stanford, Woods Hole und der Oregon State University zu verstärken und 200 Seemeilen nördlich der zu Ecuador gehörenden Galapagosinseln zu tauchen, wo einst Charles Darwin zu seinen bahnbrechenden Theorien über die Evolution inspiriert worden war. Der Forschungsleiter, Jack Corliss, hatte mich auf Tauchgängen im Kaimangraben begleitet und wollte unbedingt Alvin zur Erkundung des Galapagos-Rückens einsetzen, eines weiteren Risses in der Erdkruste. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern hatte er Sedimente und Gesteinsproben an den Flanken des Rückens gesammelt, deren Entstehung man sich nur durch heißes Wasser erklären konnte, das durch die obere Kruste des Meeresbodens zirkuliert und dann an die Oberfläche strömt. Das deutete darauf hin, dass sich die Platten hier schneller voneinander trennen als jene am Mittelatlantischen Rücken und dass mehr Hitze austritt. Folglich stellte sich die Frage: Kann es sein, dass es Schlote im Meeresboden gibt, durch die warme Quellen – oder sogar richtig heiße – aus dem Untergrund hervorsprudeln?
Ein Jahr zuvor hatte ein Team vom Scripps-Institut das in 2400 bis 2700 Metern Tiefe gelegene Gebiet mit dem Sonarfahrzeug Deep Tow untersucht und einige geringfügige Temperaturanomalien festgestellt. Da sich Deep Tow in viel größerem Abstand zum Meeresgrund bewegte als Angus, war es für qualitätvolle Bilder meistens zu weit entfernt. Ich wusste, dass wir mit Alvin hinuntertauchen konnten, um ganz genau hinzusehen, doch mein wahres Ass im Ärmel würde Angus sein – der fotografische Kundschafter, der ein viel größeres Gebiet als Alvin abdecken und auch dessen Tauchziele dirigieren konnte.
Zur Vorbereitung auf die Galapagos-Tauchgänge erweiterten wir Angus um ein Temperaturmessgerät; wenn sich ungewöhnliche Werte ergaben, wüssten wir sofort, welchen Gebieten wir besondere Aufmerksamkeit schenken sollten. Wir ließen Angus bis auf eine Höhe von vier Metern über dem Meeresboden hinab, schleppten den Schlitten dann ganz langsam, mit weniger als zwei Knoten Meile für Meile und nahmen so in einem zwölfstündigen Durchgang Tausende von Fotos auf. An einer Stelle sahen wir auf dem Registrierpapier einen Temperaturanstieg, der mehr als drei Minuten hindurch anhielt. Zweifellos war Angus hier durch wärmeres Wasser gefahren.
Sobald der Film entwickelt war, galt also unser Interesse vor allem den Aufnahmen aus diesen drei Minuten. Wir saßen da und gingen die Fotos durch, auf denen frische Lava, dann noch mehr Lava und herumliegende Felsbrocken zu sehen waren. Plötzlich, in der Zeitspanne dieses Temperaturanstiegs, wird das Wasser in den Aufnahmen trüb. Und dann sehen wir all diese Muscheln, groß und weiß, auf dem Felsgestein. Muscheln? Da unten darf es eigentlich keine Muscheln geben, nicht in einer Welt völliger Finsternis, wo es nur wenig Nahrung gibt und nur blanken Fels. Was ist da los?
Hin und wieder hatte ich schon Fische in der Tiefe gesehen, die sich von kleinen Häppchen organischen Materials ernähren, das aus der oberen sonnenhellen Wasserschicht nach unten sinkt. Hier aber handelte es sich augenscheinlich um etwas völlig anderes – ein Ökosystem, mit dessen Existenz niemand gerechnet hatte.
Jetzt wussten wir, wohin wir mit Alvin navigieren mussten.
Jack Corliss und Tjeerd Hendrik van Andel – ein Freund aus Stanford, genannt Jerry und ebenfalls Teilnehmer des FAMOUS-Projekts – übernahmen den ersten Tauchgang. Als die Muscheln in Sichtweite kamen, sprang die Temperaturanzeige von den üblichen 2,5 °C bis auf 16 °C. Das Wasser im Licht der Scheinwerfer färbte sich hellblau.
»Wir entnehmen gerade eine Probe von einer Hydrothermalquelle!«, rief Jack durch das Unterwassertelefon. Er und andere hatten diesen Ausdruck zwar in ihren theoretischen Schriften benutzt, doch nie zuvor hatte jemand eine gesehen – einen Riss im Meeresboden, durch den heißes, mineralstoffreiches Wasser aus dem Untergrund strömte.
Verblüfft, dass eine Kolonie von Muscheln hier überleben konnte, fügte Jack hinzu: »Sollte die Tiefsee nicht eigentlich eher wie eine Wüste aussehen?«
Und es wurde noch bizarrer. Im Lauf der nächsten fünf Wochen unternahmen wir 20 weitere Tauchgänge am Galapagos-Rücken und entdeckten andere Gebiete, die von Lebewesen nur so wimmelten – wie Oasen in der Tiefe.
Ein Gebiet war von großen braunen Muscheln bevölkert, ein anderes von blumenähnlichen Lebewesen und ein drittes von Kolonien riesiger Bartwürmer, die an Rosensträucher erinnerten. Da niemand von uns Biologe war, benannten wir sie einfach nach unseren Assoziationen: Spaghettiwürmer, die Löwenzahnfläche, der Garten Eden. Die Lebewesen sahen atemberaubend schön und exotisch aus. Wir stießen auf ganze Gemeinschaften von Arten und Nahrungsketten, von denen nicht einmal in Biologiebüchern zu lesen war. Aber warum fanden wir sie dann hier? Ohne das Licht und die Wärme der Sonne ist Leben in dieser komplexen Form doch nicht möglich? Nichts von alledem passte zu dem, was wir an Schule und Universität gelernt hatten.
Man spricht immer vom Heureka-Effekt, wenn sich ein Wissenschaftler plötzlich bewusst wird, dass er zu einer bedeutsamen Erkenntnis gelangt ist. In unserem Fall kam der erste Hinweis auf die Funktionsweise dieses seltsamen Ökosystems, als John Edmond, ein Chemiker vom MIT, eines Abends Wasserproben aus einer der Quellen öffnete. Ein Geruch nach faulen Eiern breitete sich im Schiff aus. Wir husteten und öffneten rasch die Fenster. Was für ein Gestank! Wir kannten ihn: Schwefelwasserstoff. Das Zeug kann einen umbringen, wenn man zu viel davon einatmet.
Als wir ein paar der Muscheln öffneten, die Alvin mit seinem Greifarm am Grund eingesammelt hatte, fanden wir keine graue Masse, wie wir sie von unseren Sandklaffmuscheln auf Cape Cod kannten, sondern blutrotes Fleisch. Es sah aus wie rohes Steak und blutete wie eine Schnittwunde. Die Muscheln hatten keine inneren Organe – nur dieses matschige Zeug.
Für eine biologische Untersuchung mussten wir einige der Tiere von der Reise mitbringen, doch wir hatten kaum Formaldehyd, um sie zu konservieren. Also improvisierten wir. Mit Ausnahme von Bier sollte eigentlich kein Alkohol an Bord sein – doch einige Besatzungsmitglieder besaßen in ihrer Kabine einen Geheimvorrat. Nun kamen Gin- und Wodkaflaschen zum Vorschein und wir konservierten damit unsere Funde.
Als Forscher an Land die Muscheln unter dem Mikroskop untersuchten, entdeckten sie in ihrem Inneren eine große Menge sehr primitiver Bakterien – möglicherweise eines Typs, der bereits zu einer Zeit entstanden war, als sich erstmals komplexere Lebensformen auf der Erde bildeten. Grob vereinfacht könnte man sagen, dass diese Bakterien früh im Evolutionsprozess eine Abmachung mit den Muscheln getroffen hatten, so wie: »Tu mir den Gefallen und lass mich in deinem Körper leben. Dann kannst du auch diesen giftigen Schwefelwasserstoff einatmen, der dich sonst töten würde – aber nicht, wenn wir ihn uns teilen.«
Das war ein ziemlich guter Deal. Die gängige Lehrmeinung besagte: ohne Sonnenlicht keine Fotosynthese und ohne Fotosynthese keine komplexen Ökosysteme. Falsch! Bis dahin hatte niemand von diesen ungewöhnlichen Bakterien und ihrer Bedeutung für einen zweiten chemischen Vorgang gewusst, in dem wir heute eine der Grundlagen für die Entstehung von Leben sehen: die Chemosynthese. Hier zeigte sich uns eine der Wiegen des Lebens auf unserem Planeten, an die niemand je zu denken gewagt hatte.
Einige Jahre später kehrte ich mit Biologen zum Galapagos-Rücken zurück, die bestätigten, dass die im Inneren der Muscheln und Bartwürmer lebenden Bakterien die Fähigkeit hatten, einen Vorgang analog zur Photosynthese zu betreiben – allerdings im Dunkeln. Dazu nutzen sie in der Quellflüssigkeit enthaltene Moleküle zur Gewinnung von Energie und wandeln sie um in Substanzen, die das Überleben der Tiere sichern. Das rote, matschige Innere der Muscheln und die roten Spitzen der Bartwürmer waren voll Hämoglobin, dem Grundbaustein des menschlichen Bluts. Der Sauerstoffanteil in der Quellflüssigkeit war gering – und nur, weil er vom Hämoglobin gespeichert wurde, konnten sich die riesigen Muscheln und anderen Lebewesen damit ausreichend versorgen. Die Biologen waren genauso überrascht wie wir, dass die Bakterien in einer derart widrigen Umgebung für das Überleben einer komplexen Lebensgemeinschaft sorgen konnten.
Inzwischen hat sich in der Wissenschaft die Erkenntnis verbreitet, dass diese Gemeinschaften entscheidende Hinweise auf die Entstehung irdischen Lebens liefern – und darauf, wie sich Leben auch auf anderen Planeten bilden könnte. Genau diese Entdeckung steckt hinter der Entscheidung der NASA, heute Projekte zur Erforschung der Jupiter- und Saturnmonde voranzutreiben. Unter ihrer mit Eis bedeckten Oberfläche liegen Ozeanwelten, die weit größer sind als unsere eigenen Meere – und möglicherweise bergen sie Lebensformen, die uns völlig unbekannt sind.
—
NUR MONATE SPÄTER, im Juni 1977, kehrten mein Team und ich zurück an den Kaimangraben – die gigantische, von Guatemala bis nach Jamaica reichende Öffnung im Boden des Karibischen Meers –, um Lavaproben von den aktiven Vulkanen dort zu entnehmen. Tiefer als dort bin ich nie wieder getaucht – in einer Tiefe von mehr als 6000 Metern. Wir tauchten in der Trieste II, einem Bathyskaph der Navy, ähnlich der Archimède, dem französischen Tauchboot, das wir während des FAMOUS-Projekts genutzt hatten.
Der Auftakt zu dieser zweiten Expedition zum Kaimangraben ging allerdings daneben. Ich flog nach Panama, wo uns ein Schiff der Navy hinaus auf See bringen sollte. Erst auf der Gangway fiel mir auf, dass ich ein Kartenwerk der Navy mit vertraulichen Informationen im Flugzeug vergessen hatte. Ich winkte meinem Taxi, das gerade wendete, und in Windeseile rasten wir zum 34 Kilometer entfernten Flughafen zurück. Nachts hatte man dort allerdings keinen Zutritt. Es war zwar die Zeit vor dem 11. September, als die Sicherheitsbestimmungen an Flughäfen noch nicht so streng waren, trotzdem patrouillierten am Eingang bewaffnete Soldaten. Ich aber hatte nur meine Karten im Kopf, da sie für die Expedition von entscheidender Bedeutung waren. Deshalb ließ ich die Soldaten einfach links liegen, verfluchte mich selbst dabei zur Tarnung lautstark auf Englisch und betrat schließlich das Flugzeug, in dem gerade die Putzkolonne zugange war. Da lagen meine Karten – unangetastet im Gepäckfach. Wieder 34 Kilometer Taxifahrt, die Gangway hoch, und ich war bereit für die Arbeit, mit den Karten in der Hand.
Die Trieste II hatte eine stolze Historie und war viele Male modifiziert und aufgerüstet worden. Sie hatte die Wrackteile eines Atom-U-Boots, der 1968 gesunkenen USS Scorpion, vermessen und fotografiert; 1972 hatte sie eine versunkene Satellitenausrüstung geborgen. Mit 20 Metern Länge und 88 Tonnen Gewicht war die Trieste II eine lange und schwere Röhre. Wie beim französischen Bathyskaph Archimède beruhte auch bei ihr die Auftriebskraft auf Tanks voll Flugzeugbenzin. 1977 war diese Technik bereits veraltet und wendigere Schiffe wie Alvin hatten sich weitgehend durchgesetzt. Doch dieses Schiff konnte uns in eine Tiefe von 6000 Meter bringen – 2400 Meter tiefer als Alvin.
Am Tag unseres letzten Tauchgangs war es während des fast sechs Stunden dauernden Abstiegs friedlich genug für ein langes Schläfchen. Als der Pilot ankündigte, dass wir uns nur noch 60 Meter über dem Grund befänden, blickte ich gerade aus unserem einzigen Sichtfenster. Plötzlich entdeckte ich die Seite einer Vulkanwand, die unter uns aufragte. Unser Grundsucher hatte, warum auch immer, nicht angeschlagen.
»Grund!«, schrie ich. »Ich sehe Grund!«
Der Pilot ließ sofort etwas von dem als Ballast geladenen Eisenschrot ab, um unsere Sinkrate zu reduzieren. Aber Bathyskaphe sind nicht von jetzt auf gleich zum Stillstand zu bringen. Und so grub sich unser Bug mit einem beängstigenden Schleifgeräusch in den Steilhang. Die Felswand revanchierte sich, indem sie einen Stahlträger in unserem Bug verbog.
Jetzt konnte ich erkennen, was geschehen war. Während der Bug unseres langen Schiffs die steil abfallende Wand gekreuzt hatte, ragte das Heck – wo sich unser Grundsucher befand – noch immer über den tieferen Teil des Meeresbodens hinaus.
Doch das war erst der Anfang. Als ich einen Blick aus dem winzigen Sichtfenster warf, schimmerte etwas Buntes im Wasser. Es sah aus wie eine Luftspiegelung. Dieser Effekt stellt sich immer dann ein, wenn man Benzin oder Öl mit Wasser vermischt – und genau das konnte ich gerade beobachten. Ich sah Flugzeugbenzin. Das konnte nur bedeuten, dass einer unserer Auftriebstanks Leck geschlagen war und wir gerade das Benzin verloren, von dem unsere sichere Heimreise zurück an die Oberfläche abhing.
Der Pilot ließ sofort all unseren Ballast fallen und brach die Tauchmission ab. Wir starteten unseren Aufstieg. Doch bis zur Oberfläche brauchten wir sechs Stunden und die Frage war: Wie schnell entwich das Benzin? Würden wir das gesamte Benzin verlieren, bevor wir die Oberfläche erreichten, und würde die Endstation unseres Tauchgangs der Meeresgrund werden? Wir wussten es nicht.
Gebannt starrten wir auf die LED-Anzeige, die unsere Steigrate angab. Doch von einer Berechnung zur nächsten variierten die angezeigten Werte stark. Verlangsamte sich unser Aufstieg oder nicht? Das schien davon abzuhängen, ob man Optimist oder Pessimist war.
Sechs Stunden lang sagte niemand auch nur ein Wort. Uns war klar, dass wir die Oberfläche aus eigener Kraft erreichen mussten. Die Rettung durch ein anderes Boot war völlig ausgeschlossen, denn wir waren zu tief. Endlich, als sich schon das Licht der Sonne im Wasser abzeichnete, hörten wir ein Geknatter aus der Ferne – ein Schlauchboot machte sich auf, uns an der Oberfläche in Empfang zu nehmen. Ich erinnere mich noch gut an diesen ersten Atemzug an der frischen Luft, als wir endlich unsere Köpfe aus der Luke stecken konnten.
Nach diesem Erlebnis kamen mir Zweifel: Warum mache ich das eigentlich?
Ich verlor nicht den Mut, das wäre zu viel gesagt, und ungeachtet der Risiken habe ich auch danach noch zahlreiche Fahrten in Tauchbooten unternommen. Doch in mir wuchs der Gedanke: »Warum russisches Roulette spielen? Es muss doch einen besseren Weg geben.«
—
TATSÄCHLICH hatte ich schon wiederholt darüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht einen besseren, sichereren Weg der Erforschung gab. Ich erinnere mich an einen Tauchgang mit Alvin, bei dem wir auf eine von Riesenbartwürmern umgebene Quelle stießen. Als ich kurz zu einem der Biologen, Holger Jannasch, hinüberblickte, stellte ich fest, dass seine Aufmerksamkeit gar nicht dem Sichtfenster galt, sondern dem Vier-Zoll-Monitor, der das Bild von Alvins Kamera übertrug. Ich konnte es kaum glauben. Musste überhaupt jemand hier unten sein oder auch nur auf dem Schiff an der Oberfläche? Konnten wir nicht Roboter bauen, um das alles aus der Ferne zu betreiben?
Diese Idee nahm in meinem Kopf allmählich Gestalt an. Vorerst aber bestand wenig Zweifel, dass es für meine Festanstellung das Beste war, wenn ich noch mehr über Hydrothermalquellen herausfinden würde – zum Beispiel wie man ihren Fundort feststellen könnte. Sehr wahrscheinlich traten sie entlang der Mittelozeanischen Rücken auf. Ich beschloss, mich auf die Entwicklung eines Modells zu konzentrieren, mit dem sich ihr Vorkommen bestimmen ließ.
1979 schlossen sich mein Team und ich einer Expedition unter Leitung des Scripps-Instituts an, die uns etwa 100 Seemeilen südlich der mexikanischen Halbinsel Niederkalifornien an den Ostpazifischen Rücken führte, der den Meeresboden des Pazifiks von Mexiko bis an den Übergang zum Indischen Ozean südlich von Australien durchkreuzt. Entlang dieses Rückens hatte ich schon ein Jahr zuvor mit französischen Wissenschaftlern des FAMOUS-Projekts unter der Leitung meines Freundes Jean Francheteau geforscht, der nun bei unserer Expedition ebenfalls mit an Bord war. Es machte mich nervös, dass diese Fahrt auf der Melville von Fred Spiess geleitet wurde, meinem ganz persönlichen Kapitän Ahab, der mir 14 Jahre zuvor den Zutritt zum Aufbaustudiengang verwehrt hatte. Allerdings bezweifelte ich, dass er sich an mich erinnerte, und sah keinen Grund, ihn daran zu erinnern.
Spiess und die meisten anderen Wissenschaftler an Bord forschten zu vulkanischer und seismischer Aktivität, während Jean und ich uns auf das Auffinden von Quellen konzentrierten. Allerdings gab es an Bord nur eine einzige Seilwinde, um Fahrzeuge ins Wasser hinabzulassen, und Spiess bestand darauf, dass sein Deep-Tow-Sonarfahrzeug den Vortritt erhielt. Angus war von einem starken, schützenden Stahlkäfig umgeben, wohingegen Deep Tow eher einem hochpräzisen Rennwagen glich und deutlich anfälliger für Schäden war. Als Spiess’ Team damit in eine unterseeische Felswand krachte, musste es zur Reparatur eingeholt werden.
Das verschaffte mir die Gelegenheit, Angus zu Wasser zu lassen – und es dauerte nicht lange, bis wir Spuren von Hydrothermalquellen fanden. Sie sahen allerdings anders aus als jene am Galapagos-Rücken. Das aus den Schloten entweichende Wasser wirkte trüber, beinahe wie schwarzer Rauch; also entsandten wir Alvin in die Tiefe, um die Quellen vor Ort zu untersuchen.
Dudley Foster steuerte Alvin in ein Dickicht von seltsamen, kaminartigen Strukturen. Einem der Schlote, der schwarze Wolken aus gelösten Mineralien ausspie, näherte er sich.
»Das Zeug schleudert es hier raus wie aus einer Lokomotive!«, rief Dudley hoch zu uns. Der »Rauch« glich wirklich dem einer mit Kohle betriebenen Dampfmaschine. Als Dudley an den Schlot heranfuhr, verzeichnete Alvins Messsonde knallheiße 33 °C – deutlich höher als die Temperaturen an den Galapagos-Quellen. Die Hitze war so groß, dass sie die Spitze von Alvins Thermometer zum Schmelzen brachte.
An diesem Abend sprachen Jean und ich über die Beschaffenheit dieser rauchenden Schlote. Zwei Jahre zuvor waren wir am Galapagos-Rücken auf ähnliche röhrenförmige Ablagerungen gestoßen – sie waren damals allerdings in Stücke zerbrochen, als ich mit Alvins Greifarm etwas davon einsammeln wollte. 1978 dann hatte auf einer von Jean und mir geleiteten Forschungsreise mit der Cyana ein mexikanischer Wissenschaftler etwas Vergleichbares gesehen und eine Probe entnommen, die schließlich als ein Sulfid identifiziert wurde, das reich an Zink, Kupfer, Blei, Silber und nicht zuletzt Gold war. Einen solchen Mineralstoff hatte man nie zuvor am Meeresboden gefunden. Und niemand hatte je eine Schornsteinlandschaft wie jene gesehen, die sich nun vor unseren Augen eröffnete. Die Szene wirkte, als stamme sie direkt aus der industriellen Revolution.
Tags darauf ließen Jean und ich zunächst ein Messgerät für deutlich höhere Temperaturen auf Alvin installieren und führten dann selbst einen weiteren Tauchgang zur selben Stelle durch. Wir mussten das Ganze einfach mit eigenen Augen sehen. Einige der Schlote waren 1,80 Meter groß und stießen riesige schwarze Rauchwolken aus. »Als würden sie direkt hinab in die Hölle führen«, sagte Jean.
Als wir uns einem aktiven Schlot näherten, erinnerte uns der Pilot daran, die Temperatur abzulesen. Zum Glück! Wir waren fassungslos, denn die Anzeige war bis auf 350 °C hinaufgeschossen – um ein Vielfaches über den Siedepunkt hinaus. Schnell traten wir den Rückzug an. Unser Druckkörper aus Titan hätte der Hitze zwar standgehalten, doch nur wenig näher, und unser Bullauge aus Plexiglas wäre zerborsten, was zu einer massiven und tödlichen Implosion geführt hätte. Unsere Berechnungen hatten zwar darauf hingedeutet, dass so heiße Flüssigkeiten in der Magmakammer einige Kilometer unterhalb des Meeresgrunds erzeugt werden konnten. Aber dass sie immer noch so heiß waren, wenn sie dann ins offene Meerwasser austraten, damit hatten wir nicht gerechnet. Und genau das war der Fall.
Auf darauffolgenden Durchgängen fand Angus weitere Raucher und wir wiesen Alvin den Weg dorthin, um sie in Augenschein zu nehmen. Kurz zuvor hatten wir ein automatisiertes akustisches Navigationssystem installiert, das von einer einzigen Person bedient werden konnte – Deep Tow hingegen war auf ein drei- bis vierköpfiges Navigationsteam angewiesen. In Bezug auf unsere Position in der langen Rivalität zwischen Scripps und Woods Hole hatten wir zu dieser Zeit ein ziemlich gutes Gefühl – was offensichtlich meinen Ehrgeiz befeuerte, denn ich bat Steve Gregg, der die Navigation von Angus betreute: »Wenn du Wache hältst, stell Musik an, mach etwas Popcorn und leg deine Füße auf den Computer.« Diese lockere Einstellung würde Spiess – einen ehemaligen Navy-Offizier, der sich strikt an die Vorschriften hielt – in den Wahnsinn treiben. Außerdem bemalten wir Angus für jeden Raucher, den er entdeckte, per Schablone mit einem kleinen Schlot – so wie US-Jagdflugzeuge im Zweiten Weltkrieg für jeden Abschuss eines japanischen Zero-Flugzeugs mit dem Bild einer aufgehenden Sonne versehen wurden.
Auf dieser Fahrt begleitete mich mein Vater. Eines Abends stand er gerade auf dem Oberdeck, als er hörte, wie Dr. Spiess auf dem darunterliegenden Deck heraustrat und einen lauten Seufzer tat, beinahe einen Schrei. Dieser zugeknöpfte Typ verlor nur selten die Fassung, doch offensichtlich hatte ich ihn an den Rand der Verzweiflung gebracht.
In nachfolgenden Tauchgängen entdeckte unser Team weitere Schlote, von denen manche fast neun Meter hoch waren. Wir nannten sie »Schwarze Raucher« oder »Weiße Raucher«, je nach Farbe ihres Ausstoßes. Ausnahmslos bestanden sie aus polymetallischen Sulfiden – den gleichen Mineralien, die man im Vorjahr in der Probe gefunden hatte. Als wir die Flüssigkeit genauer betrachteten, sahen wir, dass sie beim Verlassen der Schlotöffnung noch klar war. Doch sobald sie sich mit dem 4 °C kalten Wasser am Grund vermischte, wurde sie abgeschreckt und verfärbte sich durch die Ausfällung der gelösten Mineralien zu Mikrokristallen schlagartig schwarz. Nun hatten wir eine erste Vorstellung davon, wie diese kaminartigen Strukturen entstehen konnten. Zunächst schießt heiße Flüssigkeit durch einen neu entstandenen Riss im Fels und vermischt sich mit Meerwasser. Die Mineralien fällen aus und setzen sich am Rand der Öffnung ab, wodurch der Schlot immer weiter in die Höhe wächst, bis er irgendwann kopflastig wird und umkippt, nur um den Prozess von Neuem in Gang zu setzen. So entsteht schließlich ein großer, aus Mineralien bestehender Hügel mit Verbindungen zu vielen einzelnen Schloten, ein Gebilde, das an eine Orgel erinnert.
Unsere Entdeckung trug dazu bei, die Chemie des Meerwassers besser zu verstehen. Im Chemieunterricht lernt man den Wasserkreislauf kennen: Die Wärme der Sonne lässt Wasser aus den Weltmeeren verdunsten. Dieses reine Wasser sammelt sich in feuchten Wolken, aus denen es als Regen zur Erde fällt und durch Flüsse wieder zurück ins Meer fließt, wobei es chemische Stoffe aufnimmt. Schließlich verdunstet es wieder und der Kreislauf beginnt von vorn.
Doch die chemische Zusammensetzung von Fließgewässern und einem Eimer Seewasser unterscheidet sich merklich. Seltsamerweise verschwinden einige der ins Meer fließenden Stoffe einfach, während sich stattdessen andere Stoffe im Meerwasser nachweisen lassen. Doch wo liegt deren Ursprung?
Mit der Entdeckung dieser extrem heißen Schwarzen Raucher erkannten wir ein zweites, das gesamte Weltmeer umspannendes Kreislaufsystem, das seit Millionen von Jahren im Inneren des Meeresbodens zirkuliert. In den Sulfidablagerungen, aus denen die Schlote bestanden, fanden wir Kupfer, Blei, Silber, Zink und Gold – wertvolle Metalle in Mengen, die groß genug waren, um einen Unterwasser-Goldrausch auszulösen, der im Augenblick gerade erst an Fahrt gewinnt.
—
PLATTENTEKTONIK, Hydrothermalquellen und Schwarze Raucher. In schneller Abfolge hatten wir – alle Wissenschaftler, die mit mir zusammen auf See waren, Franzosen und Amerikaner – dafür gesorgt, dass Teile der Geologie-, Biologie- und Chemielehrbücher, die uns durch unser Studium begleitet hatten, nun neu geschrieben werden mussten. Das FAMOUS-Projekt ließ unser Geologiebuch alt aussehen; die Entdeckung der Quellen unser Biologiebuch; der Fund der Raucher unser Chemiebuch. Es war der perfekte Dreierpack. Viele Wissenschaftler verstanden von der Theorie hinter den Entdeckungen und vom Ausmaß ihrer Bedeutung mehr als ich. Doch ich war in der glücklichen Position, über die richtige Ausrüstung zu verfügen und über die Fähigkeit, sie an den richtigen Orten einzusetzen. Ohne Angus’ Kameras sowie Alvins Sichtfenster, durch die Wissenschaftler in den Ozean blicken konnten, hätten wir niemals die Beweise selbst in Augenschein nehmen können.
Bald darauf nahm ich ein Angebot von Dr. van Andel an, 1979 bis 1980 ein akademisches Sabbatjahr in Stanford zu verbringen, wo ich an wissenschaftlichen Artikeln über unsere jüngsten Entdeckungen arbeiten konnte. Der Stichtag für meine Festanstellung rückte näher und ich war überzeugt, dass sie mir inzwischen auch zustand. In Woods Hole wurden Festanstellungen von einem Gremium externer Experten vergeben, doch als ich hörte, wer Mitglied des Ausschusses sein und über mein Schicksal entscheiden würde, war das wie ein Schlag in die Magengrube: einige meiner größten Rivalen, darunter – richtig geraten – Dr. Spiess. Gerade noch hatte ich ihn auf See herausgefordert und jetzt fühlte ich mich, als hätte ich ein Fadenkreuz direkt auf meiner Stirn.
Ich beschloss, Margie und unsere Jungs mit nach Kalifornien zu nehmen. Unser Haus in Hatchville würden wir vermieten. Falls mir die Festanstellung versagt bliebe, würden wir einfach an der Westküste bleiben – in dem Staat, in dem ich aufgewachsen war. Ich war lange nicht hier gewesen, doch die Angel- und Campingausflüge mit meinem Vater waren mir noch im Gedächtnis, und ich legte großen Wert darauf, mit Todd, inzwischen elf, und Dougie, bald neun Jahre alt, Ähnliches zu unternehmen. Außerdem trainierte ich Todds Basketballteam und wir hatten die Gelegenheit, einige Zeit zum Schwimmen und Angeln an unserem bevorzugten Urlaubsort zu verbringen: einer Hütte von Margies Vater am Whitefish Lake in Montana.
Dennoch musste ich eingestehen, dass sich meine Ehe zunehmend in einer Krise befand. Genau wie in Woods Hole zeigte Margie auch in Stanford kein Interesse an Unternehmungen mit meinen beruflichen Freunden oder an meinem Geistesleben. Gleichzeitig verfolgte ich aber die Scheidung meines Bruders, der inzwischen bei Apple in der Softwareentwicklung arbeitete. Und da ich sah, wie schwer diese Zeit für seine drei Kinder war, wollte ich mich um ein harmonisches Miteinander mit Margie bemühen – zumindest solange unsere Jungs noch zu Hause lebten.
Immer noch straften mich manche Akademiker mit Geringschätzung, da ich weiterhin für National Geographic schrieb. Ich hatte Magazinartikel über den Kaimangraben, die Oasen um die heißen Quellen sowie die Raucher veröffentlicht. Gerade arbeitete ich an meiner ersten Fernsehdokumentation für National Geographic Television und in meinen Ohren hörte ich schon die lautstarken Vorwürfe von einigen meiner Kollegen, das sei reine Angeberei. Doch gleichzeitig hatte ich große Artikel für Nature und Science mitverfasst, zwei der wichtigsten wissenschaftlichen Fachzeitschriften; zwei weitere Texte waren gerade in Arbeit, von denen einer schließlich den Newcomb-Cleveland-Preis für den besten in Science veröffentlichten Artikel des Jahres 1980 gewinnen würde. Mäkler spotteten, ich würde einfach ins Blaue hinein forschen, um zu sehen, was es alles so zu entdecken gab. In ihren Augen war das keine Wissenschaft – ich stolperte einfach nur über Dinge. »Wenn das so ist«, dachte ich, »dann lasst mich doch einfach weiterstolpern.«
Bei dieser Nervenbelastung fügte es sich glücklich, dass der Vorsitzende des Ausschusses, der über meine Festanstellung befand, Robert W. Morse war, ein früherer Unterabteilungsleiter für Forschung und Entwicklung bei der Navy und nun in hohem Amt am Woods-Hole-Institut. Nicht zuletzt war er mein Tennispartner. Von ihm erfuhr ich später, dass der Ausschuss schriftliche Einschätzungen von anderen Experten eingeholt hatte – darunter einige, die noch nie auch nur irgendein nettes Wort verloren hatten, egal über wen. Außerdem hatten sie sich an Wissenschaftler gewandt, die erst vor Kurzem mit mir zusammen auf dem Wasser gearbeitet hatten, darunter Jerry van Andel von Stanford, Harmon Craig vom Scripps und John Edmond vom MIT.
Letzten Endes wurde die Entscheidung in einer Abstimmung getroffen, und so versammelten sich alle Beteiligten am 14. Februar 1980 an einem Tisch. Ich selbst durfte nicht anwesend sein, doch Morse verriet mir später, dass Spiess, als er an der Reihe war, darüber schimpfte, wie sehr ich nach Aufmerksamkeit gierte.
Dann fragte Morse: »Wenn Ballard am Scripps wäre, würden Sie ihn fest anstellen?«
Spieß antwortete: »Jepp.«
Ich war unglaublich erleichtert. Endlich! Jetzt war ich festangestellter Wissenschaftler am Woods-Hole-Institut und durfte selbst entscheiden, wohin die Reise für mich und mein Team in Zukunft gehen sollte.