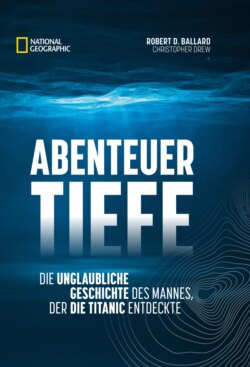Читать книгу Abenteuer Tiefe - Christopher Drew - Страница 9
KAPITEL 2 SCHWEIZER TASCHENMESSER
ОглавлениеDas College stand vor der Tür, und erst kurz zuvor waren wir nach Long Beach gezogen, in eines dieser klassisch-kalifornischen Häuser mit Halbgeschossen, die oft in Fernsehserien zu sehen waren, wenn es um die Sonnenseite des Lebens ging – mit Palmen und dem ganzen Drumherum. Ich weiß noch, wie ich am Küchentisch das Vorlesungsverzeichnis der University of California in Santa Barbara wälzte. Es war zweieinhalb Zentimeter dick.
Eifrig blätterte ich von Seite zu Seite, von Hauptfach zu Hauptfach, von Kurs zu Kurs. Das College kam mir vor wie ein einziges riesiges Bufett, und ich wollte mir nicht einen Bissen davon entgehen lassen.
Dass ich Meeresforscher werden wollte, wusste ich. Das war beschlossene Sache. Aber Meeresforschung war ein Aufbaustudiengang. Voraussetzung war eine solide Grundlage in einer der Naturwissenschaften. Wegen meiner Verbindungen zum Scripps und meiner Teilnahme an den Exkursionen war ich ziemlich zuversichtlich, später dort promovieren zu können. Also machte ich mich auf die Suche nach einem Hauptfach, das mich in eine perfekte Ausgangsposition dafür bringen würde. Dr. Revelle hatte mir empfohlen, Mathematik, Chemie, Physik oder Geologie zu studieren. Dann stieß ich auf etwas, das sich »Studium der Naturwissenschaften« nannte. Der Studiengang war ambitioniert. Aus den obigen vier Fächern waren zwei im Hauptfach, die anderen beiden im Nebenfach zu belegen und die Studiendauer betrug fünf Jahre. Vielleicht hätte ich es angesichts meiner Schwierigkeiten mit Texten und Prüfungen etwas langsamer angehen sollen. Im sprachlichen Teil des Eignungstests hatte ich nur 444 von 800 möglichen Punkten erzielt, im mathematischen Teil 538. Trotzdem war ich optimistisch, durch zusätzliche Sommerkurse sogar die Studiendauer auf viereinhalb Jahre verkürzen zu können. Das Studium war eine frisierte 450-PS-Version dessen, was Dr. Revelle vorgeschlagen hatte, und es würde ohne Zweifel Eindruck auf die Scripps-Jury machen – ganz zu schweigen von meinem Vater und meinem Bruder, der gerade im Turbogang sein Physikstudium in Berkeley absolvierte und auf die Promotion zusteuerte.
Also ging es ab an die UC Santa Barbara, deren Campus direkt oberhalb des Pazifiks lag und sich entlang traumhaft schöner Klippen und rund um eine eigene Lagune ausbreitete. Es verstand sich von selbst, dass ich mich einer Studentenverbindung anschließen würde, da mir die YMCA-Klubs so gut gefallen hatten. Für männliche Studenten waren zwei Jahre Mitgliedschaft im Ausbildungskorps für Reserveoffiziere (ROTC) verbindlich, und obwohl unser Campus an der Küste lag, konnte man den Dienst nicht bei der Navy, sondern ausschließlich bei der Army ableisten. Ich trat gerne bei, da ich in der Nähe von Militärstützpunkten groß geworden war und eine Verantwortung spürte, meinem Land zu dienen. Ein Basketballstipendium hatte ich zwar abgelehnt, weil mein Vater fürchtete, das könnte meinem Studium im Weg stehen, doch in der Mannschaft meines Jahrgangs spielte ich trotzdem. Nach der Schule und in den Ferien hatte ich gejobbt und ein bisschen Geld angespart, und eines Abends setzte sich mein Vater mit mir an den Küchentisch und ließ mich ein Budget aufstellen. Ich steigerte mich so sehr in die Planung hinein, dass ich Mom sogar nach der Zahl der Blätter auf einer Rolle Klopapier fragte, um meinen Bedarf zu ermitteln. Dad meinte, so genau müsste ich es nun auch wieder nicht nehmen.
In meinem ersten Semester schaffte ich in Chemie eine Eins, aber in Mathematik und Deutsch III konnte ich mich gerade noch so auf eine Drei retten. Während der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung in Deutsch musste mir ein Weisheitszahn entfernt werden. Mitten beim Eingriff, so erzählte mir der Zahnarzt später, fing ich plötzlich an, seine Fragen auf Deutsch zu beantworten.
Als Hauptfächer wählte ich Geologie und Chemie – Geologie, weil Dr. Norris Meeresgeologe war, und Chemie wegen meiner Eins im ersten Kurs. Die Grundlagenkurse musste ich auch in Physik und Mathematik belegen.
In den meisten Fächern konnte ich mich mithilfe eines Tricks behaupten, den ich mir in meiner Highschool-Zeit beigebracht hatte: Ich machte gedanklich Fotos von meinen Aufzeichnungen und rief diese Bilder während der Prüfung wieder ab. Umso größer war der Schock, als ich in den Kursen zu Differenzialgleichungen und Organischer Chemie nur eine Vier bekam. Die Prüfungen bestanden zum Teil aus Textaufgaben und ich hatte Schwierigkeiten, mir eine begriffliche Vorstellung davon zu machen. Sobald die Wörter in meinem Kopf ankamen, zerbrachen sie einfach in 1000 Teile. Ich las sie aufs Neue, wieder und wieder, aber es war zwecklos.
Im Sommer darauf war ich für ein paar Ferienkurse eingeschrieben und arbeitete außerdem für die Ocean-Systems-Abteilung in der Firma meines Vaters, der North American Aviation. Nach Präsident John F. Kennedys Ankündigung eines bemannten Flugs zum Mond hatten Unternehmen wie North American, das heute zum Boeing-Konzern gehört, ihren Tätigkeitsbereich auf die Raumfahrt ausgedehnt und betrachteten zunehmend auch die Tiefsee als das nächste Gebiet, dessen Erkundung sich lohnen würde. Meine Aufgabe in diesem Sommer bestand darin, Hunderte von Karteikarten über die Geschichte von Tiefsee-Tauchbooten zusammenzustellen.
In meinem ersten Studienjahr wurde ich zum Jahrgangssprecher gewählt und schaffte es, ein Mädchen von klassisch-kalifornischer Schönheit und messerscharfem Verstand davon zu überzeugen, mit mir auszugehen. Ihr Name war Lana Rose. Gemeinsam gingen wir auf Verbindungsfeiern und Bälle, und einfach nur, weil ich derjenige war, mit dem sie ausging, gewann ich an Ansehen. Schon bald wollte ich sie voller Begeisterung meinen Eltern vorstellen. Leider kamen wir so spät zu Hause an, dass wir sie fürs erste Kennenlernen aus dem Bett werfen mussten. Doch sogar zu dieser späten Stunde erlagen alle ihrem Charme.
Es waren die frühen 1960er-Jahre und an den meisten Colleges wurden innenpolitische Debatten zunehmend hitzig geführt. Ich war in einem Eisenhower-Republikaner-Haushalt aufgewachsen und Santa Barbara war ein sehr konservatives Pflaster. Von JFKs Wirken in seinem Schloss Camelot in Washington bekam man nur wenig mit. Wir wussten, dass sich Collegestudenten in anderen Städten den Freedom Riders angeschlossen hatten, um sich für die Bürgerrechte im Süden des Landes einzusetzen. Doch von den tiefgehenden Erschütterungen, ausgelöst von den sozialen Unruhen, die schon bald jeden amerikanischen Campus in Aufruhr versetzen würden, war noch nichts zu spüren. Hier war nach wie vor die örtliche Gruppe der John Birch Society einflussreich, einer rechtsaußen-antikommunistischen Organisation. Ihre Mitglieder protestierten gegen einen Campusbesuch von Margaret Mead, der Anthropologin, deren Studien über Urkulturen einigen Rechten nicht in den Kram passten. Ich setzte mich in dieser Auseinandersetzung früh für das Recht auf freie Meinungsäußerung ein und schließlich konnte sie ihre Rede halten.
Das amerikanische Engagement in Vietnam war noch in einem frühen Stadium. Das Pentagon unterstützte Südvietnam, den Angriffen des Vietcong im Norden des Landes entgegenzutreten, indem es Berater entsandte. Allerdings zweifelte von den Offizieren, die unser ROTC-Programm leiteten, keiner daran, dass die Vereinigten Staaten letztlich Truppen dorthin entsenden würden. Richtig bewusst wurde mir das zu Beginn des dritten Studienjahrs, als ich mich entscheiden musste, ob ich Offizier der Army werden oder aus dem ROTC ausscheiden wollte – wobei dann die Gefahr bestand, nach dem Abschluss zum Militärdienst eingezogen zu werden.
Wenn die Pflicht ohnehin bald rufen würde, wollte ich ihr mit dem goldenen Streifen eines Offiziers oder dem Abzeichen eines einfachen Soldaten begegnen? Und vielleicht noch wichtiger: Hatte ich Talent für Menschenführung und fand ich Gefallen daran?
Das wollte ich herausfinden.
Offen gestanden: Das ROTC-Programm machte mir Spaß. Schon in Sportteams und bei den Pfadfindern hatte ich gern Uniform getragen – ich verband damit positive Eigenschaften wie Disziplin und Teamfähigkeit. Beim ROTC kleideten wir uns jeden Donnerstag vor dem Exerzieren in Khaki oder Wintergrün und verbrachten folglich die Mittwochabende damit, unsere Schuhe mit Spucke auf Hochglanz zu polieren. Außerdem war ich ein talentierter Schütze. Als ich noch ein Junge war, hatte mein Vater mir sein .22-Gewehr geschenkt, und es kam auch zum Einsatz – beim Besuch bei meinen Großeltern in den Hügeln um San Diego, wo die Walnussfarmer von einer Eichhörnchenplage belästigt wurden. Pro Schwanz erhielt ich 25 Cent, und da ich die Munition selbst bezahlte, musste jeder Schuss sitzen. Jahr für Jahr stieg ich in der ROTC-Hierarchie weiter auf. Im zweiten Studienjahr wurde ich mit dem Spitzenplatz unter den Kadetten ausgezeichnet, und nachdem ich mich entschieden hatte, dabeizubleiben und Offizier zu werden, wurde mir dieser Titel im Jahr darauf erneut verliehen.
Beim ROTC bekam ich auch ein Gefühl dafür, wie stark visuell orientiert ich bin. Offiziere der Air Force besuchten unsere Einheit mit einem Flugsimulator: Wir sollten sie informieren, sobald wir Hunderte Meter unter uns auf dem Boden einen Panzer ausmachen konnten. Kaum hatten sie den Simulator gestartet, sagte ich: »Da ist er.« Einer von ihnen meinte: »Verdammt, du hast recht!« Nachdem mir das wieder und wieder gelungen war, fragten sie mich, ob ich in die Air Force eintreten wollte.
Die wichtigere Prüfung erwartete mich im Sommer nach dem dritten Studienjahr, als ich sechs Wochen in Fort Lewis südlich von Tacoma im Bundesstaat Washington verbrachte, um an einem sogenannten Reaktionstraining für Führungskräfte der Army teilzunehmen. Im Prinzip ging es den Ausbildern darum, uns in Belastungssituationen aus dem Gleichgewicht zu bringen, um uns zu testen – und sie waren nicht zimperlich. So konnte einer von ihnen plötzlich sagen: »Sie sind tot!«, obwohl man alles richtig gemacht hatte. Man hatte dann einfach Pech gehabt und war von einer imaginären Mörsergranate erwischt worden. Einmal wurde tatsächlich ein Drill Sergeant getötet, als ein Kadett aus nächster Nähe versehentlich einen Schuss in seine Nierengegend abfeuerte. Wir benutzten Platzpatronen, doch aus so kurzer Entfernung können sogar die tödlich sein.
Wir wurden in Trupps aufgeteilt, die üblicherweise aus je vier Kadetten bestanden. Zwei Trupps bildeten eine Gruppe und vier Gruppen einen Zug. Jeden Abend wurde uns ein Rang für den nächsten Tag zugewiesen. Immer einer von uns leitete einen Trupp und erhielt eine Mission, und wenn die im Gange war, änderten die Ausbilder das Missionsziel oder »töteten« den Anführer – einfach nur um zu sehen, wie wir uns an die neue Situation anpassten. Dabei schrien sie einen ständig an. So wusste man rasch, ob man das alles schaffen würde. Irgendwann musste sich jeder fragen: Bin ich Anführer oder Mitläufer?
Eine der Missionen bestand darin, einen feindlichen Soldaten gefangen zu nehmen, während die eigene Gruppe sich durch bewaldetes Gelände auf die Frontlinie zubewegte. Dort befand sich ein Minenfeld zu unserer Linken, ein Minenfeld zur Rechten und eine Barriere aus NATO-Draht direkt vor uns. Der erste Kadett kam noch durch den Stacheldraht, doch dann, als sich der zweite am Hindernis befand, eröffnete der Feind das Feuer. Was tun? Die Gruppe war jetzt zweigeteilt. Wird der Anführer dem im Stacheldraht gefangenen Kameraden befehlen, sich flach hinzulegen, damit der Rest der Gruppe auf seinem Rücken das Hindernis passieren kann – auch wenn dieser eine dabei in den rasiermesserscharfen Draht gedrückt wird? Das wollte man mit diesem Test herausfinden. Der Grundgedanke war, den Feind zurückzudrängen, die Gruppe wieder zu vereinen und dann den Mann aus dem Draht zu befreien und seine Wunden zu versorgen, bevor die Mission fortgesetzt wurde.
Ein anderes Mal inspizierte der Drill Sergeant beim Morgenappell unsere Gesichter, ob wir eine »ordentliche Militärrasur« hatten, wie er das nannte. Er gab sich erst zufrieden, als wir uns so gründlich rasiert hatten, dass jeder kleine Schnittwunden im Gesicht hatte. Zur ersten Übung traten wir zwischen Zelten auf einem Feld an. Wir wurden angewiesen, Gasmasken aufzusetzen und in eines der Zelte zu gehen, wo aus einer Blechmülltonne Tränengas ausströmte. Man befahl uns, die Maske abzunehmen und Name, Rang sowie Kennziffer zu nennen. Sobald wir unsere Masken abgenommen hatten, fingen die Rasurverletzungen an zu brennen, als ob uns jemand Säure ins Gesicht geschüttet hätte. Manche schafften es gerade noch, Namen und Rang richtig zu sagen. Aber spätestens bei der Kennzahl verloren alle die Beherrschung und brachen in heftiges Husten aus.
Dann – vor dem Hintergrund des schneebedeckten Gipfels von Mount Rainier, im einsetzenden Regen – versammelten wir uns auf einer Metalltribüne und der Sergeant erklärte uns, was im Fall eines Nervengasangriffs zu tun war. Jeder von uns erhielt ein Röhrchen mit einer Nadel daran, die als Spritze mit dem Gegenmittel dienen sollte. »Stehen Sie auf«, hieß es, »lassen Sie Ihre Kampfanzüge bis zu den Knöcheln runter und setzen Sie sich wieder hin.«
»Jetzt nehmen Sie das Röhrchen fest in Ihre Hand und die Nadel zwischen Zeige- und Mittelfinger«, sagte der Sergeant. »Das Kommando lautet ›eins, zwei, rein damit‹, und auf ›rein damit‹ stoßen Sie die Nadel in Ihren Oberschenkel; etwas seitlich versetzt, damit Sie den Knochen nicht erwischen.«
Angespannt warteten wir auf das Kommando – mit der Hose an den Knöcheln und der Nadel in der Hand. »Eins, zwei, los!«, schrie der Sergeant, und alle stießen die Nadel in den Oberschenkel.
Der Sergeant sah uns böse an. »Ich habe nicht ›rein damit‹ gesagt«, knurrte er. »Also ziehen Sie sie wieder heraus; wir beginnen noch mal von vorn.«
Wir rissen die Nadeln heraus. Mit Regentropfen vermischtes Blut rann an unseren Beinen hinab. Ich konnte das Geräusch von Helmen hören, die auf die Metalltribüne krachten; einige Kadetten waren ohnmächtig geworden. Der Rest von uns hörte beim nächsten Mal genauer hin.
»Jetzt werde ich herumgehen und hinten auf das Röhrchen klopfen, um zu prüfen, ob die Nadel tatsächlich ganz eingedrungen ist«, sagte er. Nach dieser reizenden Einweisung und nach Abschluss seines schmerzhaften Klopftests wurden wir angewiesen, uns erneut in Formation aufzustellen.
Als Brigadekommandeur an diesem Tag musste ich die Züge beim Marsch über das Feld anführen. Dabei wurden wir aus heiterem Himmel von der Seite mit Gaskanistern beworfen, woraufhin die meisten Männer zu Boden fielen und einen Würgekrampf bekamen. Da ich an der Spitze marschierte, war ich vom Gas verschont geblieben; doch der Sergeant machte mir Beine, als ich vom Feld herunterkam. »Kadett Ballard! Wo sind Ihre Männer? Zurück aufs Feld! Und kommen Sie erst zurück, wenn jeder einzelne Ihrer Männer versorgt ist!« Wenig später lag ich genau wie meine Kameraden auf dem Boden und erbrach mich.
Im Laufe dieser sechs Wochen kämpften wir mit Bajonetten und robbten unter Stacheldraht entlang, während scharfe Schüsse über unsere Köpfe hinwegpfiffen. Ich wurde zu einem erfahrenen Gewehrschützen, erzielte 94 von 100 möglichen Punkten, und in Bezug auf körperliche Leistungsfähigkeit landete ich von 1400 Kadetten auf dem sechsten Platz. Außerdem gewann ich Erkenntnisse, die in gefährlichen Momenten später auf See von entscheidender Wichtigkeit für mich waren. Ich lernte, dass man erst im Ernstfall beurteilen kann, wie ein Mensch wirklich gestrickt ist – ob er sich davonmacht oder die Stellung hält. Einige verließ der Mut, wenn der Sergeant sie anbrüllte; andere flippten aus, wieder andere schmissen hin. Mir aber kam es in diesen Augenblicken höchster Anspannung so vor, als liefe alles in Zeitlupe ab. Ich wurde äußerst ruhig, beobachtete, dachte nach und versuchte zu begreifen. Ich lernte, dass Führung auch bedeutet, seine Leute um sich zu versammeln, wenn etwas schiefläuft.
Doch ebenso wurde mir beigebracht, dass ich jeden Deserteur sofort erschießen sollte, da ich sonst alle anderen mit verlieren könnte. Hätte ich das an der Front jemals getan? Wahrscheinlich. Hätte ich danach je wieder meinen Frieden gefunden? Wahrscheinlich nicht.
—
ICH WAR IM HÖHENFLUG, als ich aus Fort Lewis zurückkam. Im Spätsommer absolvierte ich ein paar Ferienkurse in Los Angeles an der UCLA. Ich traf Arthur Ashe, den späteren Wimbledonsieger, der nach Erhalt seines Tennisstipendiums frisch hier angekommen war – und ich schlug ihn sogar in einem Tennisturnier. Wieder zurück in Santa Barbara, wo das vierte Studienjahr anstand, lief alles hervorragend. Ich wurde stellvertretender Brigadekommandeur unserer ROTC-Einheit. Wenn nötig, konnte ich einen mürrischen Monolog halten wie ein grummeliger General oder auch in einer mitreißenden Ansprache alle zusammentrommeln. Menschenführung lag mir. Meine Fortgeschrittenenkurse in Geologie und Chemie genoss ich. Außerdem hatten Lana und ich uns verlobt und meine Bundesbrüder in der Verbindung beneideten mich darum.
Doch dann, im Frühjahr des darauffolgenden Jahres, verdüsterte sich alles. Aus heiterem Himmel ließ Lana mich sitzen. Ich war wie benommen und schämte mich. In jenem Sommer verbrachte ich sehr viel Zeit beim Gerätetauchen – häufig an der Küste von Big Sur, südlich der Monterey-Halbinsel. Meinem Vater erzählte ich, dass es mir dabei um wissenschaftliche Erkenntnis ging. Aber vermutlich spürte er, dass ich meine Gedanken in andere Bahnen lenken wollte, weit weg von Lana – und vielleicht auch von meiner Zukunft.
Für mein Aufbaustudium hatte ich fest das Scripps im Visier. Immer wieder redete ich mir ein, dass die eine schlechte Note sie nicht abhalten würde, mich in ihr Promotionsprogramm aufzunehmen. Schließlich hatte ich während der Highschool ein Praktikum dort gemacht und den Kontakt zu einigen der Funktionsträger gehalten. Da das Scripps Forschung für das Militär betrieb, war ich auch im Glauben, dass mein Aufenthalt in Fort Lewis und mein Titel als Ausgezeichneter Absolvent einer militärischen Ausbildung des ROTC dort auf Anerkennung stoßen würde.
Aber ganz im Hinterkopf war da auch schon ein kleines Fragezeichen. Als ich mein neuntes und letztes Semester an der UC Santa Barbara begann, lag mein Notendurchschnitt etwa bei 2,0. Nicht sonderlich gut für eine Bewerbung am Scripps, aber ich hoffte, mein interdisziplinärer Studiengang würde das wettmachen.
Zur Bewerbung fuhr ich hinunter nach La Jolla, um dort ein Aufnahmegespräch mit Fred Noel Spiess zu führen, dem Direktor des Labors für Meeresphysik am Scripps-Institut. Er hatte im Zweiten Weltkrieg 13 U-Boot-Patrouillen mitgemacht und überlebt, wofür er mit militärischen Ehrenmedaillen ausgezeichnet worden war. Er hatte einen Harvard-Abschluss als Master im Bereich Ingenieurwesen und war in Berkeley zum Doktor der Physik promoviert worden. Und er war ein respekteinflößender, herausragender Meeresforscher.
Ich hatte ihn nie zuvor getroffen und ging voll Begeisterung in unser Gespräch. Er hingegen war kalt und distanziert. Die Unterredung dauerte nicht sehr lang und ich erinnere mich, wie ich beim Hinausgehen dachte: »Oh je, ob daraus etwas wird?«
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten und kam in einem Brief von Dr. Spiess. Man hatte mich abgelehnt.
Ich wusste, dass das passieren konnte. Trotzdem kam es mir jetzt vor, als würden alle meine Träume platzen. Verzweifelt stellte ich mich selbst infrage. »Ich bin einfach nicht zum Meeresforscher geschaffen«, dachte ich.
Schlimmer noch war der Gedanke, dass ich es anders hätte angehen können. Ich hatte mich für einen irrsinnig schweren Studiengang entschieden. Es war einfach zu viel. Der Sport, die Studentenvertretung, das Verbindungsleben, das ROTC. Ich war wie ein Schweizer Taschenmesser – in vielen Bereichen ziemlich gut, aber auf keinem Gebiet meisterhaft. Ich hätte mich einschließen und mehr lernen sollen.
Außerdem fand ich später heraus, dass die Empfehlungsschreiben, auf die ich gebaut hatte, scharfen Tadel enthielten. Mein Studienberater, Dr. Norris, nannte mich darin »umgänglich«, doch mit etwas zu starkem Interesse am »gesellschaftlichen Treiben«. Ein anderer Professor lobte meine »dynamische, aufgeschlossene Persönlichkeit« und betonte, wie überaus vielseitig ich war, von »ungewöhnlicher Begabung« – doch »nur bereit, so viel zu leisten wie nötig, um das Studium mit Prädikat abzuschließen, mehr jedoch nicht«.
Wahrscheinlich erzählte ich auch meinem Bruder von der Absage, doch zu diesem Zeitpunkt standen wir uns nicht mehr so nahe, als dass ich seinen Rat gesucht hätte. Außerdem war er inzwischen verheiratet und saß gerade in Berkeley an seiner Doktorarbeit im Bereich Teilchenphysik. Angesichts seiner Erfolge fühlte ich mich noch mehr wie ein Versager.
Die Flamme wurde ganz schwach. Alle schienen mir zu raten, hinzuschmeißen und stattdessen Verkäufer zu werden, ins Geschäftsleben einzusteigen oder Ähnliches. Mir war klar: Ich musste mich aufraffen, mich selbst so aufmuntern, wie ich es im Umgang mit der Truppe gelernt hatte. Im Angesicht der feindlichen Bedrohung weiter vorwärtsmarschieren. Ich dachte an mexikanische Boxer im Fernsehen, wie diese kleineren Kämpfer ihren Gegnern zu sagen schienen: »Du wirst dir noch in meinem Gesicht die Hand brechen.« Kaum hatten sie einen Schlag erlitten, rappelten sie sich schon wieder auf. Diese Eigenschaft bewundere ich an Menschen.
Also rappelte auch ich mich wieder auf.
—
MEINE LEIDENSCHAFT FÜR DAS MEER kehrte zurück und wie besessen begab ich mich auf die Suche nach neuen Optionen. Da ich nur Scripps vor Augen hatte, hatte ich keine Recherchen über andere Graduiertenprogramme angestellt. Meine Verlobte war verloren, mein Traum zerplatzt – ich wollte an einen Ort, wo ich niemanden kannte. Da fand ich heraus, dass die Universität von Hawaii in Manoa, einem Stadtteil von Honolulu, einen Masterstudiengang in Meeresforschung anbot und ihn bald um ein Doktorandenprogramm erweitern wollte. Das war zwar nicht Scripps, aber es verschaffte mir wieder eine Perspektive.
Ich musste so schnell nach Honolulu reisen, dass ich sogar die Abschlussfeier in Santa Barbara verpasste. Nachdem ich die Army um einen Aufschub vom aktiven Dienst gebeten hatte, machte ich mich auf die Suche nach einem Nebenjob. In seinem Unterstützungsschreiben war Dr. Norris vielleicht nicht als mein größter Fürsprecher aufgetreten, aber er erzählte mir doch von seinem Bruder Ken – einem UCLA-Professor, der im Sommer Wal- und Delfinforschung am Oceanic Institute östlich von Honolulu betrieb. An das Institut war der Sea Life Park angeschlossen, ein Aquarium mit Delfin- und Walshows. Ich lieh mir ein Moped, brauste dorthin und hatte kurz darauf gleich zwei Jobs in der Tasche: Ich sollte Delfine und Wale für die Touristenshows trainieren und Ken Norris im Sommer bei der Forschung unterstützen.
Die Sonne, die tropische Brise und das Herumtoben mit Delfinen entpuppten sich als großartige Mittel, um mich wieder aufzubauen. Delfine sind soziale Wesen. Sie genießen es, wenn man sie streichelt. Wir schrieben das Jahr 1965 und an einem Ort wie dem Sea Life Park kamen damals niemandem ernsthafte Zweifel, wenn es darum ging, den Tieren allerlei unterhaltsame Tricks beizubringen. In der Walfängerbucht paddelten hawaiianische Mädchen in Kanus im Becken herum und schwammen mit den Tieren. Im gläsernen Tümmlerschaubecken zeigten wir das Training und die Intelligenz der Delfine. Sie schwammen nicht einfach nur herum, machten Luftsprünge oder führten auf der Schwanzflosse stehend Hula-Tänze auf. Wir schafften es, ihre Fähigkeiten auf eine höhere Ebene zu heben.
Einem meiner Lieblinge – Keiki, einem Großen Tümmler – brachte ich bei, Schwimmringe in sein »Sparschwein« zu befördern, einen Fahrradkorb knapp unter der Wasseroberfläche. Danach sollte er die Ringe zu mir bringen. Ich gab ihm je einen Fisch für einen weißen, fünf Fische für einen roten und zehn für einen blauen Ring. Er begriff schnell und brachte mir fortan die blauen Ringe zuerst. Während der Show »verdiente« er sich diese Ringe, die er aber so lange in seinem »Sparschwein« aufbewahrte, bis er sie in Fische umtauschen konnte.
Es gab vier Auftritte am Tag, und so lernte ich, das Publikum einzuschätzen und durch improvisierte Einlagen bei Laune zu halten. Die Abende verbrachte ich mit den anderen Delfintrainern in Waikiki. Eine Trainerin war die Tochter eines lokalen Radiomoderators und dadurch genossen wir in unseren Stammrestaurants ein kleines bisschen PromiSonderstatus. Nach dem Essen besuchten wir oft die Auftritte von Don Ho, dem hawaiianischen Sänger, dem bald darauf mit seinem Lied Tiny Bubbles der landesweite Durchbruch gelingen sollte. Der Trick war, erst kurz vor dem Ende seiner letzten Show anzukommen, sodass wir nur noch einen Drink bestellen mussten statt der üblichen zwei.
Ich war wieder auf der Suche nach einer Partnerin. Ein hübsches, braunhaariges Mädchen, Marjorie Hargas, wohnte auf der anderen Straßenseite und kam eines Tages herüber, um sich vorzustellen. Sie hatte einen Teil ihrer Kindheit genau wie mein Vater in Montana verbracht und sich dann aufgemacht, allein die Welt zu erkunden; ihr erster Stopp war Hawaii. Ich fand das ziemlich mutig. Zusammen kurvten wir in meinem heiß geliebten 1958er Chevy-Impala-Cabriolet herum. Die Impalas waren in dem Jahr erstmals auf den Markt gekommen und seitdem wollte ich so einen besitzen. Diesen fand ich zum Schnäppchenpreis direkt in Honolulu, die Farbe war eine Art Lila, also nannten wir ihn »Die Traube«.
Als ich in jenem Winter über Weihnachten nach Hause kam und Mom erzählte, dass ich Margie weinend am Flughafen in Honolulu zurückgelassen hatte, schickten ihr meine Eltern ein Flugticket, damit sie mit uns feiern konnte. Damals heiratete man früher als heute. Auch wenn mich meine Eltern nicht unter Druck setzten, wusste ich doch, dass sie sich über eine Hochzeit freuen würden. Richard war seit drei Jahren verheiratet und sie hatten bereits einen Sohn. Margie einen Antrag zu machen kam mir also einfach richtig vor. Wir hatten Spaß zusammen und mein Idealbild einer Ehe war noch immer das, mit dem ich selbst aufgewachsen war. Ich kaufte einen Ring für sie, und als wir nach Hawaii zurückkehrten, waren wir verlobt.
AN DER UNIVERSITÄT LIEF ALLES NACH PLAN und meine Arbeit für Dr. Norris war faszinierend. Wir untersuchten, wie schnell Delfine schwimmen und warum sie in große Tiefen tauchen können, ohne Embolien zu erleiden so wie andere Säugetiere oder Menschen.
Ich wusste nicht, dass Delfintrainer des Instituts an einem streng geheimen Navy-Forschungsprojekt mitarbeiteten, bis mich eines Tages die Anfrage erreichte, Delfine zur Tötung feindlicher Taucher in Vietnam abzurichten. Offenbar entsandte der Vietcong nachts Schwimmer in die Bucht von Cam Ranh, um Sprengstoff an amerikanischen Versorgungsschiffen anzubringen. Da die Bucht voller Treibgut war, konnte man die Schwimmer nur schwer von anderen Sonarzielen unterscheiden. Man erhoffte sich von den Delfinen, dass sie die Taucher entdecken und ihre Trainer informieren würden. Die Trainer sollten dann einen Speer mit einem Gaskanister auf der Nase des Delfins befestigen. Das Tier würde zurückkehren und den Speer in die Brust des Tauchers rammen und ihn damit töten.
Mir erschien es nicht richtig, die Tiere dieser Situation auszusetzen, darum lehnte ich das Angebot höflich ab.
Wenig später hatte ich ein weiteres verstörendes Erlebnis in Bezug auf den Vietnamkrieg. Einer meiner Kameraden aus dem ROTC arbeitete inzwischen beim militärischen Nachrichtendienst und war auf Heimaturlaub, als ich mich mit ihm und einem Freund am Fort DeRussy, einem Militärstützpunkt am Waikiki-Strand, auf ein paar Drinks traf. Mehrmals fragte ich, was genau ihre Aufgabe in Vietnam sei, bis mein Freund schließlich sagte: »Das willst du gar nicht wissen.« Oh doch, beteuerte ich, weil ich wahrscheinlich selbst bald dort im Einsatz sein würde.
Einige Drinks später wurde er offener. »Na schön, ich sage dir, was dich erwartet«, sagte er. »Du nimmst drei frisch von der Patrouille aufgegriffene Vietcong mit auf einen Flug im Hubschrauber, wirfst zwei von ihnen raus und verhörst dann den dritten.«
In dieser Nacht tat ich kein Auge zu. Nie im Leben wollte ich mich an so etwas beteiligen. Gleich am nächsten Morgen ging ich zur Rekrutierungsstelle des Marinestützpunkts Pearl Harbor und füllte ein Formular aus, in dem ich einen Wechsel von der Army zur Navy beantragte, was jedem Ausgezeichneten Absolventen einer militärischen Ausbildung zustand. Dann flogen Margie und ich nach Kalifornien, um zu heiraten – und, wie ich dachte, um uns dort niederzulassen. Mein Chef während des Praktikums in der Firma meines Vaters – Andreas »Andy« Rechnitzer, eine Legende im Bereich der Tiefseeforschung – hatte mir eine Vollzeitstelle in meiner alten Heimat Long Beach angeboten, wo ich helfen sollte, ein Tiefsee-Tauchboot für die Ölindustrie zu entwerfen. Das Unternehmen war auch bereit, mir eine Promotion an der University of Southern California finanziell zu ermöglichen. Das Angebot erschien mir als perfekte Gelegenheit, wieder ein höheres Tempo anzuschlagen.
Wir hatten uns noch gar nicht richtig eingelebt, als ein paar Monate später das sprichwörtliche Schicksal an die Tür klopfte. Es kam in Form eines Vertreters der Navy, der mich über die Genehmigung meines Wechselantrags informierte. Bald schon wurde ich der Dienststelle für Meeresforschung am Standort Boston unterstellt, wo ich als Verbindungsoffizier für den Kontakt zu Meeresforschern verschiedener Hochschulen zuständig war, darunter der größte Rivale von Scripps auf dem Gebiet der Meeresforschung, die Woods Hole Oceanographic Institution auf Cape Cod.
Also kletterten Margie und ich in unseren gerade erst gekauften VW Käfer, klebten einen 1000-Dollar-Scheck unter das Armaturenbrett und machten uns auf die Reise von der Pazifik- an die Atlantikküste.