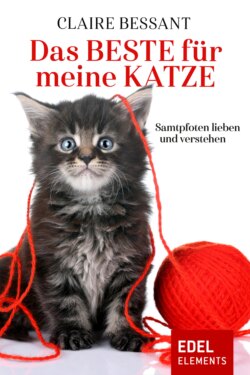Читать книгу Das Beste für meine Katze - Claire Bessant - Страница 8
Оглавление3
DIE WILDE KATZE
Als Einstimmung auf die Hauskatze und ihr Leben in unseren Wohnungen kann es nicht schaden, sich zunächst mit den wilden Katzen vertraut zu machen: Wie leben sie, wie verhalten sie sich und wie fügen sie sich in ihre Umwelt ein? Wenn wir wissen möchten, wie die Katzen uns sehen, müssen wir ihre Motivation verstehen und wissen, wie sie allein zurechtkommen. Wie gehen sie mit anderen Katzen um? Wo fühlen sie sich wohl und was meiden sie? Unsere Studienobjekte werden verwilderte Katzen und frei lebende Hauskatzen sein. Vorab gilt es, einige Definitionen zu klären.
»Verwilderte« Katzen sind Hauskatzen, die völlig ohne menschlichen Einfluss leben. Sie verhalten sich im Extremfall wie echte Wildtiere, lassen sich nicht berühren und geraten in Panik, wenn sie eingesperrt werden. Verwilderte Katzen leben durchaus in der Nähe von Menschen, weil sie dort das beste Nahrungsangebot vorfinden, sie werden sich aber nie an ein Leben als Haustiere gewöhnen – wir sollten sie respektieren wie jedes wilde Tier.
»Halbverwilderte« Katzen hatten bereits Kontakt zu Menschen. Sie schließen sich anderen Katzen an – auch verwilderten Katzen –, wenn sie eine ergiebige Nahrungsquelle finden. Manche lassen sich zähmen und leben dann zufrieden mit Menschen zusammen. »Bauernhofkatzen« treffen immer wieder einmal mit verwilderten oder halbverwilderten Katzen zusammen, bleiben aber in der Regel in einer eigenen Gemeinschaft auf den Höfen. Sie stibitzen Milch, schleichen sich in den Flur, fangen Mäuse und Ratten – wie die Katzen im Bilderbuch. Allerdings laufen heute auf Bauernhöfen keine freundlichen Kühe in hölzernen Scheunen herum und knabbern am Heu, in dem die Kätzchen friedlich in den Sonnenstrahlen spielen, die durch Ritzen im Dach einfallen. Obwohl die Bilderbuchzeiten endgültig vorbei sind, haben Katzen auf den Bauernhöfen überlebt. Sie suchen in Futtersilos nach Mäusen, kommen ins Haus und werden von den Menschen gefüttert. Dennoch leben sie trotz Familienanschluss immer noch relativ frei und wild auf dem Hof.
»Hauskatzen« leben ständig bei den Menschen. Sie teilen unser Leben und bleiben in der Wohnung. Vielfach dürfen sie frei entscheiden, ob sie im Zimmer bleiben oder ins Freie gehen wollen. Hauskatzen gelten als Familienmitglieder, die selbstverständlich auch einen Umzug mitmachen. Im Urlaub kommen sie ins Katzenhotel und wenn sie krank werden, bringen wir sie zum Tierarzt. Wenn es nötig ist, können aus Hauskatzen aber wieder halbverwilderte Katzen werden, die sich eigenständig durchschlagen.
Natürlich gibt es innerhalb der Hauskatzen unterschiedliche Gruppen, je nachdem, was sie dürfen und was nicht. Einige Katzen leben ausschließlich in der Wohnung, weil ihre Besitzer sie nicht ins Freie lassen wollen oder können. Solche Wohnungs- oder Schoßkatzen schließen sich sehr eng an ihren Besitzer an und sind in jeder Beziehung von ihm abhängig: Futter, Toilette und Spiele. Ließe man sie frei, würden sie zunächst in Panik geraten, sich aber recht schnell wieder den veränderten Lebensbedingungen anpassen.
Nur einige Rassekatzen können sich nicht mehr ohne weiteres in der Freiheit zurechtfinden. Perserkatzen haben durch Zucht ein derart dichtes, langes Unterfell, dass sie sich nicht mehr selbst säubern können. Ohne die Pflege durch den Besitzer würde ihr Fell verklumpen. Die Katze würde sich schnell äußerst unwohl fühlen. Außerdem können Perserkatzen mit ihren kurzen Schnauzen nicht mehr effektiv jagen. Sie würden vermutlich verhungern. Eine andere Art, die haarlose Sphinxkatze, würde einen durchschnittlichen Winter nicht überstehen.
EINZELGÄNGER UND GRUPPENTIGER
Wer Katzen verstehen möchte, sollte sich zunächst klarmachen, wie Katzen miteinander leben. Während die meisten wilden Katzen als Einzelgänger leben, haben sich die Vorfahren unserer Hauskatzen zu Gruppen zusammengeschlossen. Wie weit ist diese Entwicklung bei unserer Hauskatze fortgeschritten?
Die Europäische Wildkatze, die ein streng einzelgängerisches Leben führt, braucht große Reviere. Ein Quadratkilometer kann eine bis drei Katzen ernähren. Verwilderte Katzen schließen sich in der Nähe eines sicheren Unterschlupfes oft zu Gruppen zusammen. In der Nähe einer Müllkippe, in Häfen oder bei Hotels steht mehr regelmäßige Nahrung zur Verfügung. Hier leben bis zu 100 Katzen pro km2. In manchen Stadtvierteln erhöht sich die Dichte sogar auf bis zu 2000 Katzen pro km2. Auf Bauernhöfen, wo die Katzen zusätzlich gefüttert werden, leben zwischen 5 und 100 Katzen pro km2. Kern einer solchen Katzengemeinschaft ist eine weibliche Katze, die Sicherheit für ihre Jungen braucht. Die Entfernung und Verteilung verfügbarer Futterquellen bestimmt, wie weit eine weibliche Katze laufen muss, um ihre Jungen mit Futter zu versorgen. Eine üppige und regelmäßige Futterquelle bedeutet kleine Reviere, spärliche, weit verbreitete Futterquellen lassen nur große Reviere zu. Die Reviergröße einer weiblichen Katze richtet sich also nach Nahrungsangebot und Verstecken, während die Kater ihre Reviere an die der Weibchen anpassen!
Brünstige Kater bewegen sich durch die Reviere mehrerer Katzen. Ihre eigenen Reviere sind etwa dreimal größer als die Reviere der Katzen. Die Reviergröße verändert sich im Laufe des Jahres, je nachdem, wo sich die Katzen aufhalten und wie viele es sind. Kater, die nicht in der Brunst sind, besetzen deutlich kleinere Reviere, etwa so groß wie die der Katzen.
Weibliche Katzen, die sich ausschließlich über die Jagd versorgen, leben gewöhnlich allein, doch um eine sichere Futterquelle schließen sich häufig mehrere Katzen zusammen und ziehen ihre Jungen gemeinsam groß. Während sich die jungen weiblichen Katzen eine Zeitlang bei den Müttern aufhalten, werden die geschlechtsreifen Männchen vertrieben. Es kann Jahre dauern, bis sie selbst Vater werden, denn die älteren Revierkater bewachen ihre Territorien eifersüchtig.
Wie ist es den wilden Vorfahren unserer Hauskatze gelungen, sich vom Einzelgänger zu einem Gruppentier zu entwickeln? Experten gehen davon aus, dass das Futterangebot entscheidend war: Bot sich den Katzen eine ausreichende Futterquelle, überwanden sie den Instinkt, allein zu leben und duldeten andere Katzen neben sich. Heute geht die gegenseitige Toleranz sogar so weit, dass Katzen ihre Jungen in einer gemeinsamen Kinderstube aufziehen und sie gemeinsam verteidigen. Da die weiblichen Katzen in einer Gruppe häufig miteinander verwandt sind, fördern sie mit der Unterstützung der anderen Jungen auch die Verbreitung ihrer eigenen Gene. Ganz fremde Katzen werden meist vertrieben. Von den Katern können sich nur sehr wenige fortpflanzen. Dabei ist es im Sinne der Evolution, dass Katzen fremde Kater fast immer als Paarungspartner akzeptieren. Sie bringen neue Gene in das Erbgut ein und konkurrieren nicht – wie fremde Katzenmütter – um das Nahrungsangebot.
Die Reviere der Kater überschneiden sich. Sie sind zu groß, als dass ein Kater sie allein verteidigen könnte. Die meisten Kater suchen sich ihre Partnerin in einer Katzengruppe oder bei einzeln lebenden Katzen. Dasselbe Muster findet man auch bei wilden Katzen. Brünstige, starke Männchen streifen weiter herum als Kater, die weiter unten in der Rangordnung stehen. Das Leben in der Gruppe entwickelt sich also dank der Unterstützung durch den Menschen – dem Futterangebot –, während die Stabilität der Gruppe von den Weibchen abhängt.
DOMINIERENDE KATZEN UND TREULOSE KATER
Betrachten wir das Leben in einer Katzengruppe etwas genauer: Sogar einzelgängerische, wilde Katzenweibchen halten sich in 80 Prozent ihrer Zeit in einer selbst gewählten Gruppe auf – bei ihren Jungen.
Für Katzengruppen gilt:
• Hauskatzen schließen sich zu Gruppen zusammen, wenn sie genügend Nahrung finden. Diese Gruppen bestehen meist aus miteinander verwandten Katzen und mehreren Generationen ihrer weiblichen Jungen. Sie verhalten sich fremden, weiblichen Katzen gegenüber aggressiv.
• Brünstige Kater wechseln von Gruppe zu Gruppe. Die jungen Kater werden vertrieben und suchen eigene Reviere.
• Junge Kater schließen sich nicht zu Junggesellengruppen zusammen, sondern leben allein, anders als beispielsweise Löwen.
• Brünstige Kater halten keinen Kontakt zu ihren Jungen
• Brünstige Kater sind anderen Katern gegenüber feindlich und aggressiv. In kleinen Gruppen reagieren sie sogar aggressiv auf nicht geschlechtsreife Kater, weil diese in kleinen Gruppen eine größere Bedrohung darstellen.
• Weibliche Katzen helfen sich bei der Geburt und ziehen ihre Jungen gemeinsam auf.
• Wenn in einer Wohnung eine Katze mit ihren neugeborenen Jungen und der dazugehörige Kater Zusammenleben, sollte man in der ersten Zeit den Kater vom Wochenbett fernhalten.
Forscher haben viele Katzengruppen untersucht und dabei festgestellt, dass die männlichen Katzenbabys häufiger mit ihren männlichen Geschwistern als mit älteren Katzenjungen Kontakt haben. Auch die Kätzchen bleiben lieber bei ihren Schwestern als bei älteren Katzen. Könnte dieser engere Kontakt auf der gemeinsamen Sozialisation (siehe Kapitel 10) beruhen?
KÖRPERSPRACHE UND DUFTSIGNALE
Wenn wir die Signale betrachten, mit denen sich Katzen untereinander verständigen, verstehen wir vielleicht besser, was sie uns mitteilen wollen. Möglicherweise können wir dann mit einigen typischen und für uns problematischen Verhaltensmustern besser umgehen. Betrachten wir dazu entsprechende Verhaltensweisen in der Natur:
In der Form ihrer Kommunikation sind unsere Hauskatzen ihren wild und einzelgängerisch lebenden Verwandten immer noch sehr ähnlich. Allerdings leben Hauskatzen auf viel engerem Raum zusammen als Wildkatzen. Sie schließen sich nicht zu kooperierenden Jagdgesellschaften (wie z.B. Löwen) zusammen. Ihre Kommunikation muss nicht nur über große Entfernungen funktionieren, sondern auch im direkten Kontakt.
Wilde, eng zusammenlebende Tiere müssen lernen, sich gegenseitig zu tolerieren und Konflikte oder gar Kämpfe zu vermeiden. Hunde sind Rudeltiere. Sie fühlen sich nur in der Gruppe sicher und verfügen über eine Vielzahl von Ausdrucksmöglichkeiten. Ihren Platz in der Rangordnung des Rudels festigen sie durch Beschwichtigungs-, Dominanz- oder Unterwerfungsgesten. Eine strenge Hierarchie und die Regeln für die Plätze innerhalb der Rangordnung verhindern unnötige Kämpfe und sparen Energie. Bei gemeinsamen Aktionen kennt jeder seinen Platz und handelt entsprechend, ohne dass um jede Entscheidung gekämpft wird. Obwohl es auch in einem Wolfsrudel immer wieder Unruhe gibt, bleiben bedrohliche Aggressionen gegeneinander aus. Die gute Zusammenarbeit ist nur möglich, weil Hunde über ein breites Spektrum differenzierter Körpersprache verfügen.
Die einzigen Katzen, die in einer Gruppe leben und bei der Jagd miteinander kooperieren, sind die Löwen. Für die Harmonie der Gruppe sind die Löwinnen und ihr Nachwuchs verantwortlich. Die männlichen Löwen leben nur so lange mit den Löwinnen zusammen, bis sie von einem jüngeren, stärkeren Männchen vertrieben werden. Bis auf kleine Junggesellengruppen leben die männlichen Löwen keineswegs in Harmonie miteinander.
Auch unsere Hauskatzen benutzen Signale, um sich anderen Katzen mitzuteilen. Eine einzelgängerische Katze setzt die Botschaften vor allem ein, um Artgenossen abzuschrecken. Sie hinterlässt Duftsignale, die mehrere Stunden oder gar Tage haften bleiben. Ihre Wirksamkeit hängt vom Wetter ab. Regen kann den Duft abwaschen oder der Wind ihn in die falsche Richtung wehen, oder die Situation ändert sich schneller als die Botschaft. Das erinnert an einen Brief mit einer Einladung zu einem bestimmten Termin. Noch während der Brief unterwegs ist, könnte ein wichtiger Termin die Einladung sinnlos machen. Wir können per Telefon oder E-Mail die Einladung zum Glück rückgängig machen. Eine wild lebende Katze hat es da schwerer.
Wie gesagt entscheidet das Futterangebot darüber, ob Katzen allein oder in Gruppen leben. Wenn die Ressourcen (Nahrung, Unterschlupf) nur für sie und ihre Jungen ausreichen, verteidigt eine Katze ihr Revier gegen andere Katzen. Kater vertreiben konkurrierende Kater. Bei den Revierkämpfen stehen den Kontrahenten allerdings sehr wirksame Waffen zur Verfügung, mit denen sie gefährliche Wunden reißen können. Ehe es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, nutzen Katzen alle möglichen Signale, um einen Kampf abzuwenden. Katzen fehlt das Verhaltensrepertoire der Hunde, die mit Dominanz- und Unterwerfungsgesten ein soziales Rangordnungssystem aufrechterhalten. Sie setzen keine derartigen Unterwerfungsgesten ein, kennen aber dennoch viele Möglichkeiten, um sich einer Konfliktsituation zu entziehen. Sie setzen alles daran, einen potenziellen Kontrahenten durch aggressive Drohungen zu vertreiben, anstatt sich selbst dem Risiko einer Verletzung auszusetzen. Ihr abgestuftes System von Drohungen und Kompromissen nützt nicht der Gruppe, sondern der einzelnen Katze. Über kurze Entfernungen setzen Katzen Duftsignale in Kombination mit Körpersprache ein. Zum persönlichen Duft jeder einzelnen Katze kommt der gemeinsame Gruppenduft. Jede fremde Katze ohne Gruppenduft wird als Eindringling angesehen. Man könnte Katzen als Einzelgänger mit der Option zum sozialen Leben definieren: Wenn sie wollen, verhalten sie sich sehr freundlich. Ihr Leben in einer Gruppe ist nicht organisiert, d.h. einige Mitglieder sind intoleranter, gewaltbereiter oder dominanter als andere, ohne dass diese Unterschiede sich in Form einer allgemein akzeptierten Rangordnung äußern würden.
Natürlich gibt es Situationen, in denen selbst eine einzelgängerische Katze den Kontakt sucht. Ein Beispiel dafür ist die Paarung, durch die das Überleben der Art gesichert wird. Dabei dienen mehrere Signale der Kommunikation über große Distanzen. Dank dieser ganz besonderen Signale finden Kater eine rollige Katze auch aus weiter Entfernung. Katzen teilen anderen Katzen mit, dass sie paarungsbereit sind oder in Ruhe gelassen werden wollen. Sie markieren mit Urin, Kot und Sekreten aus mehreren Drüsen ihr Revier nicht nur zur eigenen Bestärkung, sondern auch, um anderen Katzen ihre Präsenz anzuzeigen. Laute stimmliche Kommunikation findet dagegen nur während der Paarungszeit statt, wenn sich Kater und Katze finden müssen. Durch laute Schreie versuchen Kater auch potenzielle Konkurrenten von einem bestimmten Weibchen fernzuhalten. Die Rufe rolliger Katzen und das laute Maunzen der Kater sind über große Entfernungen zu hören. Die übrigen Lautäußerungen dienen dazu, andere Katzen fernzuhalten. Auf kurze Distanzen werden die Laute durch Körpersprache unterstützt. Freundliche Lautäußerungen gibt es nur zwischen einer Katzenmutter und ihren Jungen.
MARKIERTE GRENZEN
Katzen können ausgezeichnet riechen. Dabei hilft ihnen das Jacobsonsche Organ, ein spezielles Riechorgan im Gaumendach. Beim sogenannten Flehmen heben die Katzen die Oberlippe an und lenken die Luft durch den leicht geöffneten Mund in konzentriertem Strahl genau auf dieses Organ. Auch Pferde und Hirsche können flehmen. Durch Lippen- und Zungenbewegungen strömen kurze Luftstöße ins Gaumendach und konzentrieren die Duftmoleküle. Damit können Katzen gezielt bestimmte Duftinformationen aus der Umwelt empfangen.
Flehmen
Um das Flehmen einer Katze zu bemerken, muss man sie sorgfältig beobachten: Sie zieht die Oberlippe leicht zurück und saugt die Luft in kurzen Stößen auf das Jacobsonsche Organ im Gaumendach. Katzen zeigen das Flehmen besonders häufig, wenn man ihnen Katzenminze anbietet. Möglicherweise fließen die Informationen über die Duftstoffe auf ähnlichen Wegen ins Gehirn wie LSD bei Menschen. Katzenminze ist harmlos, die Wirkung kurzlebig und macht nicht abhängig. In Katzenspielzeugen wird dieser Duftstoff als »Catnip« bezeichnet. Katzen reiben, miauen oder rollen sich gerne, wenn sie mit Katzenminze in Berührung kommen.
Viele Tierarten, von den Insekten bis zu den Säugetieren, kommunizieren über Duftstoffe, sogenannte Pheromone, die wie Hormone im Körper eine bestimmte Reaktion auslösen. Darauf weist bereits der Name hin (pheros ist griechisch und bedeutet »weit«, horman»auslösen«). Ein Pheromon wirkt bei Artgenossen bereits in kleinsten, über die Luft übertragenen Dosen. Ihre wichtigste Rolle übernehmen die Pheromone in der sexuellen Kommunikation: Wenn ein Kater kurz nach einer Katze durch den Garten geht, schnuppert er an Markierungen oder Urin und nimmt häufig den Duftstoff durch intensives Flehmen auf, insbesondere, wenn die Markierung von einer empfängnisbereiten Katze stammt. Vermutlich sondern Drüsen im Gesicht, auf den Pfoten, dem Hinterteil und am Schwanz solche Pheromone ab.
Urin ist ein sehr wirkungsvoller, über größere Entfernungen wirksamer Botenstoff. Katzen, die ihren Urin in einem Loch verscharren, versuchen ihre Anwesenheit zu verschleiern. Der Duft kann nicht aufsteigen und durch den Wind verbreitet werden. Katzenmütter verbergen auf diese Weise, dass ihre Jungen in der Nähe sind und schützen sie so vor Raubtieren. Unter der Erde verscharrter Urin kann nicht als verräterischer Duft aufsteigen. Dieser Trick funktioniert vor allem bei einzeln lebenden Katzen, während er in der hohen Katzendichte in unseren Städten weniger Wirkung zeitigt.
Andererseits kann Urin auch als deutliches Signal aktiv versprüht werden. Wenn Katzen vertikale Flächen, etwa in Höhe einer Katzennase, mit Urin einsprühen, setzen sie eine von allen bemerkbare Duftmarke. Dazu stellen sie sich mit dem Rücken zur Fläche und spritzen mit zitterndem Schwanz und tretelnden Beinen etwa ein Milliliter Urin nach rückwärts. Kater intensivieren diese Markierungen, wenn sie eine rollige Katze in der Nähe wahrnehmen.
Neben dem Urin geben Katzen Sekrete aus den Analdrüsen ab. Bakterien zersetzen den Urin, sodass aus Sekreten und Abbauprodukten des Urins der charakteristisch scharfe Geruch von Katern entsteht. Vermutlich sind im Urin Aminosäuren enthalten, die von den Bakterien zu schwefelhaltigen Substanzen mit stechendem Geruch umgebaut werden. Aus dem Duft des Urins schließen Katzen auf die Gesundheit der Kater. Nur wenn sich der Kater von einem gesunden, proteinhaltigen Futter ernährt hat, kann er Aminosäuren ausscheiden. Ein kräftig duftender Urin weist also den Weg zu einem gesunden, gut ernährten Kater! An windstillen Tagen können Katzen den Urinduft eines Katers noch aus 12 Metern Entfernung riechen.
Forscher und Verhaltensforscher sind sich noch nicht einig, ob Katzen auch mit ihrem Kot eine Botschaft hinterlassen. In ihrem eigenen Revier scharren die meisten Katzen eine Grube, erleichtern sich und scharren alles wieder zu. Dieses Verhalten könnte dazu dienen, den Eigengeruch zu verbergen oder es ist ein Ausdruck der Sauberkeit: Die Katze möchte ihr Revier nicht verunreinigen. Viele wild lebende Raubkatzen – auch manche Hauskatzen – hinterlassen aber Kothaufen an besonders prominenten Stellen in ihren Revieren, was als Botschaft interpretiert werden könnte.
Eine weitere Botschaft mit Fernwirkung sind die gut sichtbaren Kratz- und Duftspuren, die Katzen an ihren regelmäßig benutzten Wegen hinterlassen. Damit zeigen sie den Besitz ihres Reviers an. Mit den Pheromonen vermitteln sie anderen Katzen, welches Territorium besetzt ist und welche Wege von mehreren Katzen benutzt werden. Während die Pheromone langsam schwächer werden, bleiben die Kratzspuren dauerhaft erhalten.
Eine wichtige Rolle nehmen auch die Lautsignale ein, die über größere Entfernung gehört werden. Die meisten Fernsignale dienen dazu, andere Katzen fernzuhalten. Nur in der Paarungszeit locken Katzen durch laute Rufe einen Paarungspartner herbei.
Katzen in Paarungsstimmung machen damit auf sich aufmerksam und rufen Kater aus größerer Entfernung herbei. Entsprechend demonstrieren Kater ihre Anwesenheit. Die Rufe locken Katzen an und weisen andere Kater in ihre Schranken. Artgenossen, die solche Rufe hören, können an unterschiedlichen Stimmlagen erkennen, ob sie von einer paarungsbereiten Katze oder einem kampfwilligen Kater stammen.
GUTE UMGANGSFORMEN
Einzeln lebende, erwachsene Wildkatzen kommen meist mit Fernkommunikation aus. Nur in der Paarungszeit nähern sie sich ihren Rivalen und dem anderen Geschlecht. Enge Kontakte auf kürzeste Entfernungen gibt es natürlich zwischen Katzenmüttern und ihren Babys. Unsere Hauskatzen leben dagegen ständig in Gruppen, ähnlich wie Löwen. Sie verständigen sich über Duft- und sichtbare Signale. Zu Lautäußerungen kommt es nur selten, allenfalls zwischen Katzenbabys und ihren Müttern. Und mit dem Menschen, doch davon später.
Das Kratzen auf vertikalen, meist hölzernen Flächen erfüllt drei Aufgaben: Es entfernt die alte, abgenutzte Oberfläche und schärft die Krallen; es hinterlässt ein gut sichtbares Zeichen; und die Duftdrüsen zwischen den Krallen verwandeln die Kratzspur in eine Duftmarkierung. Dominante Katzen kratzen gerne vor anderen, unterlegenen Katzen, möglicherweise um ihnen zu zeigen, wer »das Sagen hat«.
In der Kommunikation auf kurze Entfernungen spielen Düfte eine große Rolle. Eine Katze besitzt mehrere Duftdrüsen, die individuelle Duftnoten produzieren. Sie sitzen unter dem Kinn, in den Mundwinkeln, an beiden Schläfen, an der Schwanzbasis und auf dem Schwanz.
Katzen streichen mit den Drüsen über Zweige und vertikale Flächen, um ihre persönlichen Duftnoten zu hinterlassen – für sich und andere Katzen. Während wir diese Düfte nicht wahrnehmen, sind sie für andere Katzen sehr interessant. Kater beschnuppern die Hinterlassenschaft von Katzen, um deren Paarungsbereitschaft zu überprüfen.
Katzen reiben sich aneinander, um ihre persönlichen Düfte auszutauschen und nehmen dabei einen gemeinsamen Gruppenduft an, der jede andere Katze ausgrenzt, die nicht zu dieser Gruppe gehört. Während der Kopf die individuelle Duftnote behält, nehmen Flanken und Schwanz eher den Gruppenduft an.
Wissenschaftler fanden heraus, dass der »Kopfduft« einer Katze vor allem ihr selbst nützt: Sie überträgt ihre eigenen Pheromone an bestimmte Stellen innerhalb ihres Reviers. Wenn sie durch ihr Revier streift und regelmäßig auf den eigenen Duft stößt, fühlt sie sich sicher und kann sich entspannen.
Naturgemäß ist die visuelle Kommunikation auf die direkte Nähe zu anderen Katzen beschränkt. Hier überwiegen Signale, die potenzielle Konflikte entschärfen: Selbstbewusste Katzen sträuben die Haare und stellen sich seitlich, um größer zu wirken. Andere versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen, indem sie sich mit angelegten Ohren an den Boden drücken. Vermutlich bemerken wir aber längst nicht alle subtilen Signale, die eine Katze ihrem Gegenüber übermittelt.
Es wäre interessant zu wissen, ob in Gruppen zusammenlebende Hauskatzen andere Signale austauschen als wilde, allein lebende Katzen. Immerhin treffen Hauskatzen ständig aufeinander, während eine wilde Katze visuelle und taktile Kommunikation nur während der Paarungszeit und bei der Jungenaufzucht benötigt. In dem ausgezeichneten Buch Die domestizierte Katze, das Turner und Bateson herausgegeben haben, sind wissenschaftliche Forschungsergebnisse zum unterschiedlichen Verhalten unserer Hauskatzen zusammengestellt. Das Buch ist eine faszinierende Lektüre für jeden, der sich für das Verhalten von Katzen interessiert.
Offenbar nähern sich ausschließlich Hauskatzen – und auch Löwen – mit der typischen »Schwanz-hoch«-Haltung. Einzelgängerisch lebenden Katzen fehlt dieses Verhalten; Wildkatzen heben nur den Schwanz, wenn sie mit Urin markieren wollen. Vielleicht hat sich dieses Verhalten zum Zeichen für freundschaftliche Annäherung entwickelt. Eng miteinander lebende Katzen sind darauf angewiesen. Hauskatzen und Löwen haben aber noch ein weiteres gemeinsames Verhalten: Sie reiben gerne ihre Körper aneinander. Vermutlich versichern sie sich damit gegenseitig ihrer Gruppenzugehörigkeit.
Obwohl die gegenseitige Fellpflege gerne als Zeichen der Zuneigung interpretiert wird, gibt es auch andere Erklärungsmöglichkeiten. Forscher haben herausgefunden, dass die Fellpflege häufig von bestimmenden Katzenpersönlichkeiten ausgeht, die ihre Partner sogar beißen können! Vielleicht festigen dominante Katzen über den Putzvorgang nur ihre Position.
Das typische Rollen einer Katze geht auf die sexuelle Aufforderung einer weiblichen Katze zurück, auch bei Wildkatzen. Wilde Kater rollen sich nicht voreinander. Bei Hauskatzen kommt es dagegen vor, dass junge, männliche Kater sich vor älteren Katern rollen. Möglicherweise drücken sie damit eine Form von Unterwerfung aus, um einem Angriff des stärkeren Männchens vorzubeugen. Bei wilden Katzen kommt es ausschließlich im Umfeld der Paarung zur wechselseitigen Fellpflege oder dem Reiben von Körper an Körper. Hauskatzen benutzen die direkte Berührung dagegen regelmäßig als Begrüßungsgeste. Interessanterweise benutzen Katzen, die in der Wildnis als Einzelgänger leben, in einer Gruppe im Zoo ebenfalls diese Form der Begrüßung. Möglicherweise fehlt den wilden Katzen einfach nur die Gelegenheit, einen Partner mit freundlichem Körperreiben zu begrüßen.
Obwohl unsere Hauskatzen von Wildkatzen abstammen, haben sie sich an das Leben in der Gruppe angepasst. Voraussetzung dafür sind ein gutes Futterangebot und sichere Verstecke. Neben zahlreichen Signalen für die Fernkommunikation benutzen Katzen ein reiches Repertoire von Verhaltensweisen, um sich im direkten Kontakt zu verständigen. Anders als frei lebende, wilde Katzen, die nur ausnahmsweise Gelegenheit zur Interaktion mit Artgenossen finden, sind unsere eng aufeinanderlebenden Hauskatzen stärker auf diese Form der Kommunikation angewiesen.