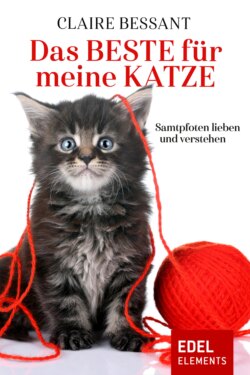Читать книгу Das Beste für meine Katze - Claire Bessant - Страница 9
Оглавление4
WARUM SIND KATZEN ETWAS BESONDERES?
Die meisten Menschen finden den Anblick einer Katze ästhetisch. Sicher war das einer der Gründe, warum die Ägypter Katzen in ihre Häuser ließen und sich bemühten, sie möglichst rasch zu zähmen. Vermutlich suchten sie sich besonders attraktive Tiere aus, vielleicht Exemplare mit deutlichen Streifen und hellem Fell. Aus der Paarung gingen Nachkommen mit anderen Fellmustern hervor. Im Zusammenleben mit den Menschen entstanden neue Varianten und unterschiedliche Farben und Fellformen. Noch heute werden Fellfarben und Muster von Rassekatzen nach strengen Kriterien gezüchtet. Obwohl sich das Fell unserer Katzen in Muster, Farbe und Haarlänge merklich unterscheidet, hat ihr Körper etwa die Form und Größe ihrer Ahnen behalten. Es gibt zwar Unterschiede von Rasse zu Rasse, doch selbst die größte Katze ist kaum doppelt so groß wie die kleinste. Vielleicht liegt das nur daran, dass Katzen erst seit etwa 100 Jahren gezielt gezüchtet werden, vielleicht sind Katzen aber auch genetisch weniger variabel als Hunde. Der Unterschied zwischen dem kleinsten und dem größten Hund ist enorm! Die gezüchtete Größe einer Hunderasse richtet sich nach seinen für den Menschen wichtigsten Fähigkeiten: Einige Rassen wurde auf Schnelligkeit gezüchtet, andere müssen Wölfe jagen und wieder andere müssen durch Fuchs- und Kaninchenbaue kriechen können.
Das Erbgut der Katzen macht sie zu perfekten Raubtieren, doch offenbar gibt es nur wenige Gene für Fellfarben und Größe. Von der ursprünglichen Beziehung zwischen Mensch und Katze – Katzen halten Vorratsspeicher frei von Mäusen – ist heute nichts mehr geblieben. Tatsächlich lehnen es viele Katzenhalter sogar ab, dass ihr Haustier Mäuse ins Haus schleppt. Dafür entwickelten sich andere, hoch geschätzte Eigenschaften der Katze.
Wir haben durch Zucht weder ihr Wesen noch ihr Aussehen entscheidend verändert. Da auch ihr Verhalten weitgehend gleich geblieben ist, sind sich alle Katzen unabhängig von der Rasse in Bezug auf ihre Instinkte und Fähigkeiten recht ähnlich. Bei Hunden ist das völlig anders. Ein Labrador kann jederzeit alles und jedes apportieren und ein Terrier jagt allem hinterher, was sich bewegt. Die Katze ist sich über die Jahrtausende selbst treu geblieben und teilt noch immer zahlreiche Eigenschaften mit ihren wilden Verwandten.
EINFACH VOLLKOMMEN
Wenn Aussehen und Fähigkeiten zusammenpassen, zu welchen »Fähigkeiten« einer Katze würde ihr Aussehen passen? Machen wir ein Gedankenexperiment: Wie würde ein Team von Spezialisten vorgehen, um die perfekte »künstliche Katze« zu konstruieren?
Eine Katze ist auf Fleischnahrung angewiesen, und muss in der Lage sein, andere Tiere zu erbeuten. Ihr Körper kann bestimmte Stoffe nicht selbst herstellen. Sie lebt von hochwertigem Futter und braucht regelmäßig Nachschub. Pflanzen kommen als Nahrung nicht in Frage. Ihre Beute, also Ratten, Mäuse und kleine Nagetiere, ist vor allem in der Dämmerung, also bei schwachem Licht, aktiv. Da sich diese kleinen Tiere blitzschnell ins Unterholz zurückziehen können, müssen sich Katzen sehr leise anschleichen und blitzschnell zupacken können. Der Zugriff muss unmittelbar tödlich sein, damit das Beutetier nicht doch noch entkommt – eine zweite Chance gibt es nicht.
Anders als Wölfe oder Löwen jagt eine Katze allein und nicht im Team. Sie kann keinen Hinterhalt mit anderen Rudelmitgliedern legen, sondern muss vom ersten Heranpirschen an ein stets wachsames Beutetier bis zum endgültigen Zugriff alles allein erledigen.
Sollte sich das Spezialistenteam einen Hund als Vorbild nehmen, wird es bald feststellen, dass dessen Fähigkeiten für die »künstliche Katze« nicht ausreichen. Die Katze ist einem Hund weit überlegen: Sie muss sich selbst versorgen und allein zurechtkommen. Sie muss leise schleichen und blitzschnell und tödlich zuschlagen. Um ihrer Beute zu folgen, braucht sie einen kräftigen und gleichzeitig beweglichen Körper. Das Team würde also eine lange Wirbelsäule mit abgerundeten Wirbeln – für die Beweglichkeit – konstruieren, die in einem langen Schwanz endet, der die Balance hält. Die Glieder wären über sehr bewegliche Gelenke und stabile Sehnen verbunden. Der Schultergürtel wäre schmal und die Schlüsselbeine nicht fest mit der Schulter verbunden. Nur weil ihre Schlüsselbeine elastisch über Muskulatur verankert sind, können sich Katzen auch auf schmalsten Unterlagen elegant und sicher bewegen. Dank der verkleinerten Schulterblätter kann eine Katze ihre Schulter mit den Beinen nach vorn bewegen, was der Schrittlänge und den fließenden Bewegungen zugute kommt, ohne dass Kraft verloren geht. Die Katze geht auf den Zehen. Die Polster an ihren Pfoten entsprechen unseren Zehen und Teilen des Mittelfußes. Sie macht lange, weite Schritte, berührt den Boden nur leicht und hebt die Zehen sofort wieder ab. Das Konstruktionsteam müsste also Hinterbeine mit kräftigen Muskeln konstruieren, um den Körper nach vorn zu bewegen. Die Vorderbeine sollten plötzliche Stopps abfangen können. Eine Katze kann aus langsamem Gang rasch in schnellen Lauf wechseln. Dabei drückt sie sich mit beiden Hinterbeinen zugleich vom Boden ab, das Rückgrat krümmt und streckt sich elastisch, um mehr Spannkraft und damit größere Schrittweiten zu erzielen. Im Sprung überwindet eine Katze das Fünf- bis Sechsfache ihrer Körperlänge.
Für unser Spezialistenteam wäre dies schon eine fast unlösbare Aufgabe, aber damit wäre die Arbeit längst noch nicht getan. Wie verhält sich ein kleines Beutetier, das um sein Leben rennt? Es ist enorm schnell und kann blitzschnelle Haken schlagen. Mit dem Maul wäre es kaum zu erwischen. Wölfe schlagen ihre Zähne in die Beute, aber sie jagen im Rudel und können aus verschiedenen Richtungen zupacken. Eine Katze braucht andere Mittel, um ihre Beute zu stellen: Das Team muss ihre Vorderfüße mit wirksamen Waffen ausstatten. Je schärfer die Krallen, desto besser. Andererseits wären lange, scharfe Krallen ein Hindernis beim Anschleichen und sie würden sich beim schnellen Laufen rasch abnutzen. Das gilt in der Tat für die Krallen eines Hundes, aber er braucht sie nur zum Laufen. Also denkt sich das Katzenkonstruktionsteam eine brillante Alternative aus: Die rasiermesserscharfen Krallen liegen gut geschützt in einer Scheide. Dort nutzen sie sich beim Laufen nicht ab und werden nur bei Bedarf ausgefahren. Wenn eine Katze ihre Zehenglieder mit Muskeln und Bändern gerade nach vorn streckt, klappen die Krallen aus den Scheiden. Da die Krallenspitzen etwas nach hinten gebogen sind, kann die Beute nicht mehr entkommen. Die Katze muss ihre Krallen auch bei nicht gestreckten Beinen ausfahren können. Dabei hilft ihr ein bewegliches Gelenk, mit dem sie nicht nur ihre Beute zum Mund führt, sondern das auch hilfreich beim Klettern oder der Fellpflege ist. Mit den »Krallen-Steigeisen« können Katzen senkrechte Flächen hochklettern und ihren Beutetieren praktisch überallhin folgen. Sind die Krallen eingeklappt, läuft die Katze lautlos auf den weichen Ballen.
Nun hat die »künstliche Katze« also sehr bewegliche Vorderbeine und Krallen; sie kann ihre Beute packen und zum Mund bewegen. Die kräftigen Kiefer mit den langen, spitzen Zähnen halten das Opfer endgültig fest. Die scharfen Reißzähne gleiten zwischen die Halswirbel und durchschneiden mit fast chirurgischer Präzision das Rückgrat.
Bis dahin hätte das Konstruktionsteam also optimale Arbeit geleistet. Der Katzenkörper wäre kräftig, geschmeidig und biegsam; er könnte sich leise bewegen, kraftvoll abspringen und die Beute mit Krallen und Zähnen packen. Die Katze wäre nicht für lange Hetzjagden, sondern für Anschleichen mit Überraschungsmoment gebaut. So weit, so gut. Jetzt müsste die Katze ihre Beute nur noch aufspüren.
Eine Art inneres Radarsystem, das auf passende Beute reagiert, wäre nicht schlecht. Worauf müsste es ansprechen? Wenn kleine Tiere durch das Unterholz schleichen, machen sie raschelnde Bewegungen, außerdem stoßen sie hörbare Töne und Töne im Ultraschallbereich aus. Ein »Katzenradar« müsste also speziell auf diese Tonlagen reagieren. Das Team würde sich daher dem Gehör der Katze zuwenden und es auf Ultraschall und die Laute der Beutetiere abstimmen. Tatsächlich hören Katzen im Frequenzbereich zwischen 30 bis 50 000 Hz, und verfügen damit über eines der besten Gehöre im Tierreich. Nur Delfine und Pferde hören noch besser. Da die Beutetiere im Verhältnis zu der Umgebung winzig ausfallen, sich sehr schnell bewegen und die Katze nicht lange rennen kann, wird das Konstruktionsteam die Katze mit wirkungsvollen Empfangsantennen ausstatten – den Ohren. Sie sitzen mit sehr großen Ohrmuscheln auf dem Kopf und werden von 12 Muskeln in einem Radius von 180° bewegt. Verdächtige Geräusche werden durch Rinnen und Kanäle verstärkt und bis ins Innenohr geleitet. Das Gehirn verarbeitet die minimalen Zeitunterschiede, mit denen die Geräusche das linke und rechte Ohr erreichen und berechnet daraus sehr präzise die Position der Schallquelle. In einer Entfernung von 2 Metern kann eine Katze eine Schallquelle auf 8 cm genau, in 20 m Entfernung immer noch auf 40 cm genau bestimmen. Das ist völlig ausreichend, um eine Beute zu orten und sich anzuschleichen.
Eine wichtige Vorgabe für die Katzenkonstruktion wäre die Berücksichtigung des Dämmerungslichts, in dem sich die Beutetiere bewegen. Eine Katze muss ihre Beute bei schwachem Licht erkennen – eine weitere Aufgabe für das Team. Im Zwielicht verschwinden die Farben und die Konturen werden undeutlich. Für uns wäre eine braune Maus zwischen den Blättern am Boden unsichtbar. Die Augen einer Katze müssen in den kleinen Kopf passen und selbst bei extrem schwachem Licht noch etwas erkennen. Also sind Katzenaugen relativ zum Kopf ungewöhnlich groß und brauchen eine Pupille, die sich dreimal so weit öffnen kann wie die des Menschen. Damit fallen sehr große Lichtmengen auf die Netzhaut, die als Nervensignale ins Gehirn geleitet werden. In der Netzhaut stehen sehr viel mehr lichtempfindliche Stäbchen – für das Sehen in Schwarzweiß – als Zapfen – für das Sehen von Farben – zur Verfügung. Also kann eine Katze zwar in der Dämmerung noch recht gut sehen, erkennt aber bis auf Blau und Grün keine Farben mehr, insbesondere kein Rot.
Damit ist das Dämmerungsauge aber noch nicht fertig. Eine zusätzliche Lage von Zellen hinter der Netzhaut, das Tapeptum lucidum, reflektiert das Licht und leitet es ein zweites Mal durch die lichtempfindlichen Zellen. Diese Schicht wird sichtbar, wenn das Katzenauge von einer Lampe oder einem Blitzlicht getroffen wird; dann schimmern ihre Augen silbrig grün. Nicht ohne Grund heißen die selbst reflektierenden Leuchten an Fahrzeugen und Straßenbegrenzungen »Katzenaugen«. Mit diesen Augen sieht eine Katze nicht nur um vieles besser als der Mensch, sie hat auch spezielle, auf Bewegung reagierende Nervenzellen, mit denen sie jedes Zucken einer Maus erkennt.
Ohne zusätzlichen Schutz bekäme die Katze mit einem derart sensiblen System große Probleme, wenn sie sich bei Tageslicht bewegt – das Licht wäre einfach zu hell. Andere nachtaktive Säugetiere, z.B. die Buschbabys, haben zwar noch viel größere Augen, schlafen aber am hellen Tag. Das Spezialistenteam würde das Problem anders lösen. Katzen können ihre hübsch gefärbte Iris, das schützende Häutchen über dem Auge, bis auf einen schmalen Spalt zusammenziehen. Zusätzlich zieht sich das Augenlid bei grellem Sonnenlicht über die Augenöffnung. Und, als wäre das noch nicht genug, gibt es noch eine dritte Schutzfolie, die Nickhaut, die nur bei Gefahr über das Auge gezogen wird. Sie bleibt meist geöffnet und ist nur selten zu sehen. Nur Katzen, die sich nicht wohlfühlen, ziehen die Nickhaut nicht mehr vollständig zurück.
Da die Augen vorn am Kopf angeordnet sind, sieht eine Katze dreidimensional und hat ein breites Sichtfeld. Damit erkennt sie Beutetiere und Feinde, falls sie selbst gejagt wird. Die beste Sicht hat eine Katze aus einer Entfernung von zwei bis sechs Metern. Das ist die Entfernung für ihren tödlichen Schlag, in der eine Beute kaum noch eine Chance hat.
Katzen sehen also gut bei Tag und im Dämmerlicht, das wir schon als dunkel empfinden. In völliger Dunkelheit fällt kein Licht mehr in das Katzenauge. Dann sieht auch eine Katze nichts mehr. Doch warum stößt eine Katze, wenn sie eine Maus nach Gehör jagt, auch im Dunkeln nicht an Hindernisse? Was könnte sich das Konstruktionsteam noch ausdenken? Die Katze hat einfache, aber sehr effektiv arbeitende Sensoren: Lange, bewegliche Tasthaare am Kopf, den Ellbogen und kürzere Tasthaare überall am Körper spüren jede Bewegung und jeden Luftzug auf. Die langen Schnurrhaare beiderseits der Nase sind besonders empfindlich. Sie reagieren noch auf eine 5 Nanometer lange Bewegung. Das sind zwei Tausendstel der Haardicke eines Menschen. Dicht gepackte Nerven an der Basis der Haare senden die Information an das Gehirn und an andere Sinnesorgane, damit die Katze rechtzeitig ausweichen kann. Die Tasthaare sind so empfindlich, dass Katzen bei der Annäherung an ein Hindernis bereits die winzigen Luftströmungen bemerken, bevor sie es berühren.
Das nächste Problem wäre der Haltebiss. Ließe die Katze ihre Beute kurz los, um sie mit einem Biss zu töten, würde das Tier auf Nimmerwiedersehen verschwinden, und die Katze eine gute Mahlzeit verlieren. Wenn sich eine Katze an ihr Opfer anschleicht, muss sie sich in direkter Nähe anders orientieren als aus der Entfernung. Sie kann daher ihre Schnurrhaare frei bewegen, von fast gerade nach vorn bis flach angelegt an den Kopf. Sobald sie mit den Krallen zuschlägt und ihr Opfer zum Mund führt, stellt sie die Schnurrhaare nach vorn. Sie liefern der Katze zusätzliche Informationen, in welcher Position sich die Maus gerade befindet. Mit einer Reihe von Tasthaaren auf der Oberlippe – damit registriert sie die Lage der Haare oder Federn – spürt sie, wie die Beute im Mund sitzt, findet den Nacken und beißt präzise zu.
Auch diese Schwierigkeiten hätte das Konstruktionsteam also bestens gelöst und einen Körper und Sinnesorgane mit vielen innovativen Ideen konstruiert. Ihr Raubtier vom Reißbrett funktioniert wundervoll und ist von großer Schönheit – ein Ferrari unter den Raubtieren. Alle diese einzelnen raffinierten Bauteile werden von einem faszinierenden Gehirn gesteuert. Es registriert jede von den Sinnesorganen gesendete Information und berechnet daraus den nächsten Schritt. Ein zu großes Gehirn hätte nicht in den schmalen Kopf gepasst, also haben Katzen ein normales Säugetiergehirn, das aber unglaublich gut organisiert ist. Immerhin muss es mit einer riesigen Menge von Sinneseindrücken fertigwerden, die Augen, Ohren und Tasthaare liefern. Die kontinuierlich fließenden Informationen werden im Kleinhirn verarbeitet.
Für eine erfolgreiche Jagd muss die Katze ihren Kopf – und damit die Augen – ruhig und auf gleicher Höhe halten. Während sie sich vorsichtig anschleicht, darf sie die Beute niemals aus den Augen verlieren, sonst würde sie den idealen Augenblick zum Zuschlagen verpassen. Um die komplizierten Bewegungsabläufe zu koordinieren, benutzt die Katze ein Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Es besteht aus drei U-förmigen, mit Flüssigkeit gefüllten Röhren. Millionen winziger Haare, die mit Nerven verbunden sind, bewegen sich mit der Flüssigkeit, wenn die Katze den Kopf bewegt. Obwohl alle Säugetiere dieses Organ besitzen, ist es bei der Katze perfekt ausgebildet. Auf jede Veränderung der Lage ihres Kopfes reagiert das Gehirn mit einer Nachricht an die Muskeln, die den Körper wieder in die richtige Position bringen.
Aber das ist immer noch nicht alles. Da Katzen als Jäger sehr präzise und schnell reagieren müssen, werden viele ihrer Körperfunktionen von automatisch zusammenarbeitenden Systemen gesteuert. Eine fallende Katze dreht zuerst ihren Kopf, dann den Körper im freien Fall in die richtige Position, sodass sie auf jeden Fall auf allen vier Füßen landet. Diese automatische Drehbewegung wird vom Gleichgewichtsorgan gesteuert. Natürlich wird sich auch eine Katze verletzen, wenn sie aus großer Höhe herunterfällt. Aber einen Sturz vom Baum steckt sie locker weg. Bei den meisten Reaktionen fließen alle Informationen der Sinnesorgane zum Gehirn, werden verarbeitet und als Befehle an die Muskeln weitergeleitet. Obwohl diese Vorgänge blitzschnell ablaufen, vergeht doch etwas Zeit fürs »Nachdenken«. Für eine fallende Katze wäre das fatal. Sie würde auf den Boden prallen und sich verletzen. Bei ihr fließen alle Informationen der Sinnesorgane direkt zu den Muskeln. Dabei läuft ein vorprogrammiertes Bewegungsmuster ab, das die Katze sicher auf allen vier Pfoten landen lässt. Diese Schnelligkeit verschafft der Katze den Vorteil, den sie braucht, um Beute zu fangen und Feinden zu entgehen.
Das Konstruktionsteam hat fantastische Arbeit geleistet. Es hat das ultimative Raubtier geschaffen – wir können nur darüber staunen. Zudem ist dieses perfekte Raubtier anpassungsfähig und anschmiegsam und damit sehr viel liebenswerter als andere Raubtiere!
Die Evolution hat Millionen von Jahren gebraucht, um diesen Ferrari unter den Raubtieren zu erschaffen. Wäre es dem Spezialistenteam nur darum gegangen, ein Kuscheltier zu konstruieren, das schnurrend auf unserem Schoß schläft und ein paar Mal am Tag zum Futternapf schleicht, wäre ganz sicher keine Katze dabei herausgekommen. Das sollten wir niemals vergessen, wenn wir unsere Katzen zwingen möchten, Vegetarier zu werden oder die Jagd aufzugeben. Unsere Katzen sind, wie sie sind, und sehen so aus, weil die Evolution sie als perfektes Raubtier mit wunderbaren Eigenschaften erschaffen hat.