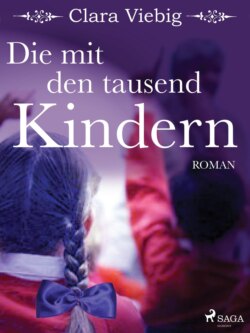Читать книгу Die mit den tausend Kindern - Clara Viebig - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel
ОглавлениеDer Abschied von Althaide war insofern nicht ungelegen gekommen, als Frau Professor Büchner dringend wünschte, ihre Tochter wieder bei sich zu haben. Ihr Kind, das einzige Kind, das ihr geblieben war! Als fielen ihr jetzt auf einmal all ihre Verluste ein, und als trüge sie doppelt schwer an ihnen, so war es. Nein, sie konnte nicht allein bleiben und nicht hier in der kleinen Stadt mit dem engbegrenzten Horizont, nicht bei diesen Menschen, deren Verhältnisse alle, alle glücklicher waren als ihre eigenen!
So war es zur Übersiedelung nach Berlin gekommen. Mathilde Büchner hatte die sorglosesten Tage ihres Lebens und die ihr auch am meisten ‚konformen‘, wie sie sagte, in Berlin gehabt, damals, als sie bei einer Tante und einer gleichaltrigen Cousine dort zu Besuch gewesen war. Nun hoffte sie wieder auf solche Tage. Aber sie vergass, dass die Tante tot war, die Cousine verheiratet und gleich ihr alt geworden, und auch, dass Leute, die einstmals Vermögen hatten, jetzt keines mehr haben. Die Cousine nahm sie trotzdem freundlich auf; sie besass von alledem, was sie einst besessen hatte, nur noch ein Haus in einem westlichen Vorort, ziemlich weit ab, und darin trat sie den Büchners nun eine kleine Wohnung ab.
Die beiden Zimmer waren angenehm, auch geräumig, und schauten aus hellen Fenstern hinab in lauter Gärten. Die Küche teilten sie mit den Glässners, das war weniger angenehm, denn Herr Glässner war abgebaut und stand immer bei seiner Frau in der Küche herum. »Aber, Mutter, du brauchst doch nicht so oft in die Küche, was haben wir denn gross zu kochen,« sagte Marie-Luise. Sie war damit zufrieden, dass für sie ein Schlafsofa im Esszimmer stand, überliess der Mutter gern das andere Zimmer ganz allein. Auch die Entfernung von Berlin kam für sie weiter nicht in Betracht. Vorerst konnte sie sich ja die Stunden, in denen sie hospitierte — bald an einer Schule in Tempelhof, bald in Charlottenburg, bald in Schöneberg, auch am Wedding, oder im äussersten Osten — so wählen, dass sie nicht schon vor sieben Uhr morgens von Hause fort musste. Auch als sie Vorleserin bei einer erblindeten alten Dame geworden war, der sie täglich zwei Zeitungen von der ersten Zeile bis zur letzten — Politik, Roman, Feuilleton, Kunst- und Börsenberichte, Boxkämpfe, Heiratsanzeigen, Todesnachrichten und Ausverkäufe — vorlesen musste, störte ihr weiter Weg sie nicht. Auch dann nicht, als sie zwei Jahre lang bei einem Schriftsteller nach Diktat in die Maschine schrieb.
Jetzt freilich musste sie sehr früh am Morgen zur Fahrt nach Berlin aufbrechen. Aber es war Frühling, wurde dann Sommer — was störte sie in diesem ersten Halbjahr der weite Schulweg? Oh, wie die Vögel anstimmten! Es piepte, es zirpte, es flatterte ohne Scheu dicht vor ihr her; die Amsel bohrte den gelben Schnabel ins Rasenbankett, der Fink schwang sich auf den untersten Zweig der Baumreihe — ein Fliegen, ein Wiegen, ein Hin- und Herwippen. Marie-Luise kannte all diese Vögel kaum, sie hätte auch nicht zu sagen vermocht, wer von ihnen jetzt sang, so vielstimmig war das Konzert. Trillern, Flöten, Locken. Wenn sie nicht gedacht hätte, es könnten jetzt doch Menschen kommen, so hätte sie auch gesungen, oder auch nur einen Ruf ausgestossen, einen einzigen kurzen, hellen Schrei. In ihr war Jubel, noch nie hatte sie sich so jung gefühlt. Ihre Jahre, ah, die drückten sie nicht, sie fühlte sich so frisch, so jung, als hätte sie erst gestern das Examen bestanden. Die Jahre, die danach gekommen waren, die waren jetzt weggewischt, sie stand wieder am Anfang, voller Hoffnungen, voller Pläne, voller Eifer, voller Hingabe an ihren Beruf. Herrgott, was stellte der für Aufgaben! Aber sie fühlte sich jedem Anspruch gewachsen. Und die Kinder hingen an ihr, das fühlte sie auch, und das machte sie glücklich. Ein Gefühl, ein Wunsch, das Herz herauszutun, ihr Innerstes, ihr Bestes ihnen zu geben, überwallte sie. Es waren nicht ihre Kinder, und doch war es einem so natürlich, dass man immer sprach: meine Kinder.
Wie konnte der Rektor nur sagen: »Recht gut, Fräulein Büchner, aber ruhig, ein bisschen ruhiger. Sie treiben sonst Raubbau mit Ihren Kräften« –? Und wie komisch von Fräulein Ebertz, der Kollegin, die nebenan die Parallelklasse hatte, zu ihr zu sagen: » So ein Unterrichten, wie Sie es tun, das hält keine aus. Die Ernst, die Sie jetzt vertreten, die machte es auch so wie Sie — und was hat sie davon? Kinder sind ja undankbar, die haben sie gleich vergessen. Nun ist sie erst mal für ein Jahr beurlaubt — nein, nein, Fräulein Büchner, erschrecken Sie nicht« — Marie-Luise musste eine unwillkürliche Bewegung gemacht haben — »die werden Sie noch lange vertreten können, die kann nicht mehr!«
»Was fehlt ihr denn eigentlich?« hatte Marie-Luise kleinlaut gefragt; sie kam sich sehr egoistisch, ganz schlecht vor, dass ihr bei dem Gedanken, dass Fräulein Ernst bald wiederkommen könnte, alles Blut vom Herzen wich und zu Kopf stieg.
»Was ihr fehlt? Na, was uns allen mehr oder weniger fehlt: die guten Nerven. Bei ihr kam’s nur etwas früh. Ich bin schon fünfunddreissig Jahre im Amt, und, Gott sei Dank, bei mir geht’s noch immer, weil ich’s ruhiger nehme. Ich unterrichte noch so ziemlich nach der alten Methode. Wenn ich ein Gedicht aufsagen lasse, sagt es erst eine auf, und dann die andere — alle der Reihe nach — ich verteile keine Rollen wie auf dem Theater. Dann gibt’s auch kein Hallo und keine Unruhe. Sie sind auch so neumodisch — Gedicht aufsagen mit Gesten, mit Hüpfen und Herumtanzen womöglich, Gott bewahr mich! Da zieht man nur schlechte Schauspieler heran. Na, Sie werden ja auch schon noch klug werden. Und wie die Ernst sich aufregte, wenn mal ein Kind einem andern ein Bildchen wegnahm oder ein Zopfband! Lieber Gott, so was kommt eben vor, es sind doch noch unvernünftige Kinder. Und wenn ein unverschämter Kerl von Vater oder eine dämliche Mutter kam und sich beklagte, ihrer Ilse, Hilde oder Annemarie wäre Unrecht geschehen, denn die lögen niemals, was meinen Sie wohl, was die Ernst sich dann auf lange Auseinandersetzungen einliess! Zuletzt war sie so fertig, dass sie mitten in der Stunde anfing zu weinen. Bei mir kommt keiner ran, ich schliesse einfach meine Klassentür zu, bin nicht zu sprechen.«
Diese Kollegin war Marie-Luise nicht sehr sympathisch. Aber das schien nicht gegenseitig der Fall zu sein. Fräulein Ebertz legte der jungen Kollegin die Hand auf die Schulter, in ihr ältliches, sehr alltägliches Gesicht mit der straff zurückgekämmten unkleidsamen Frisur kam ein freundliches, es plötzlich viel angenehmer machendes Lächeln: »Sie müssen es mir nicht übelnehmen, Fräulein Büchner, nicht denken: was geht die das an? Fünfunddreissig Jahre sind lang, ich habe schon manch eine kommen sehen, aber auch manch eine gehen. Es tut mir direkt leid um Sie, wenn ich Sie morgens so anhetzen sehe in der letzten Minute, oder wenn Sie mittags bei der Hitze sich in die Elektrische quetschen und die weite Fahrt — mein Gott, was für ’n Ende! — bis nach Hause fahren. Ziehen Sie nach Berlin, näher zur Schule, ich meine es gut mit Ihnen.«
Was, in die Stadt ziehen, dazu noch näher zur Schule?! In eine dieser Strassen des Ostens, die nur zu ertragen war, wenn man nicht in ihr wohnte! Marie-Luise lachte fast, wenn sie am Morgen ihren Weg zur Bahn machte und zufällig ein Gedanke sich zu Fräulein Ebertz verirrte. Was wusste die von Vogelgesang, von Frühlingsgrün, von der Natur überhaupt und von Frische?! Eine gutmütige Seele und auch gar nicht dumm, aber doch schon recht verschrumpft, eingetrocknet in ihrem Beruf, mechanisch darin geworden, eine Maschine.
Fräulein Ebertz hatte die Aufnahmeklasse, die Kleinen im ersten Jahr. Die gab sie dann weiter und bekam wiederum die Kleinen im ersten Jahr. Und so immer dasselbe, immer die ersten Anfänge, immer wieder diese kleinen Geschöpfe, die noch vor dem Abc erst einmal lernen mussten, dass man nicht aus der Bank herauslaufen und nach Hause gehn darf, wenn man keine Lust mehr hat, in der Schule zu bleiben, dass man aufpassen muss, wenn die Lehrerin spricht, dass man die Nachbarin nicht heimlich zwicken darf und sich auch nicht in der Nase bohren.
Marie-Luise lächelte in sich hinein: ja, es war manches recht komisch. Diese Anfänge hatte sie ja auch durchgemacht, hatte sich auf die Lippen beissen müssen, um nicht laut herauszulachen, wenn die kleine Irma mit den Rattenschwänzchen erzählte: »Mein Vati is Frisör, der ondoliert mir an ’n Sonntag.« Lieber Gott, die paar Härchen! Verlegenes kam im Anfang auch genug vor, da hatte manchmal eine Kleine zu spät angesagt: »Fräulein, ich muss mal austreten.« Nun, so etwas hatte sie ja jetzt bereits hinter sich; sie würde die Aufnahmeklasse auch nicht lange behalten, nächsten Ostern ging sie mit ihren Kindern weiter, stieg mit ihnen in die folgende Klasse hinauf, das hatte ihr der Rektor zugesagt. Aber Fräulein Ebertz — o Gott, wenn sie denken sollte, immer und immer nur die ersten Anfänge! Aber die wollte nichts anderes; es war deren Spezialität, die ganz Kleinen — eine Domäne, die sie gepachtet hatte. Fünfunddreissig Jahre nur Aufnahmeklasse –?!
War es die feuchte Kühle eines Sommermorgens nach einer Eewitternacht, die schon an den Herbst gemahnte und die Marie-Luise heute leicht erschauern machte? Sie nahm die Kühle mit sich fort in die Stadt und behielt sie selbst während des Unterrichts, obgleich die Bänke alle vollbesetzt waren und die Luft, die die Klasse vom eingebauten Hof her empfing, durchaus nicht frisch war. Es steckte Schwüle in dieser Luft. Marie-Luise hatte heute keinen guten Tag, das fühlte sie bald, ohne zu wissen warum, und es ärgerte sie. Sie konnte und konnte ihre gewöhnliche herzhafte Munterkeit heute nicht finden, obgleich sie sich bemühte. Und es war, als ob die Klasse dies spürte. Die kleinen blonden, braunen und schwarzen Köpfe hingen schläfrig, bald gähnte dieses Kind, bald jenes, die Antworten kamen langsam; kein Durcheinanderrufen, kein lebhaftes Fingerheben, lahmgelegt schien das Interesse. Wie, war die Klasse denn so sehr der Spiegel des Lehrers? Marie-Luise entdeckte fast mit Erschrecken, wie sehr selbst schon diese kleinen Kinder hier die Verfassung des Lehrenden abspiegelten. Sie riss sich zusammen und gab sich einen Ruck. Und siehe, es gelang. Jetzt hatte sie die kleinen Geister wieder gefesselt und hielt sie fest in der Hand.
Beim Naheliegenden hatte sie angeknüpft: »Wisst ihr denn, Kinder, warum wir heute alle ein bisschen müde sind?«
»Weil gestern Sonntag war,« sagte die Schindler.
»Wieso? Das verstehe ich nicht, da müssten wir doch gerade recht ausgeruht sein.«
»Wir haben schön ausgeschlafen,« riefen ein paar.
»Na, siehst du, Trude, deine Antwort ist falsch.«
»Nee, Fräulein,« Trude Schindler blieb dabei, »die is nich falsch. Sonnabends is Auszahlung, denn macht Vater ooch an’n Sonntag noch blau, und denn gibt’s immer Krach. Ich hab garnich schlafen können.«
Ach Gott, dieses Kind! Marie-Luise erschrak. Was die schon miterlebte! Für dieses naseweise Ding mit der grossen nickenden Haarschleife, thronend auf einem Strubelkopf, das ihr unsympathisch gewesen, fühlte sie jetzt plötzlich Mitleid. »Na, Trudchen, dann leg dich ein bisschen hin und schlaf dich aus. Kind, du kannst nach Hause gehen, jetzt schon.« Sie erwartete, dass die Schindler froh aufspringen würde, aber die schüttelte verneinend den Kopf, im ganzen Körper Abwehr: »Nee, ich will nich nach Haus!« Und blieb.
Fürchtete sich das Kind, nach Hause zu gehen? In die Klasse senkte sich plötzlich ein Schatten. Vom Hof stieg er herauf, von jenen hohen Hauswänden herab, die den umdüsterten, und kam durch die Fenster hereingekrochen. Nicht nur auf der kleinen Schindler blasses, übermüdetes Gesicht schien sich der Schatten zu legen, er breitete sich auch auf die anderen Kindermit aus, auf die blonden, braunen und schwarzen Köpfchen, auf das Lenchen, die Irma, die Gerda und Senta, auf Hilde, Ilse und Erika, auf Hete und Magda und Lieschen auf all die kleinen Gestalten. Ach, Kinder der Riesenstadt, Kinder in deren übervölkertem Osten! Kinder des Proletariats, die keine behütende Hand zur Schule geleiten kann — Vater muss in die Fabrik, Mutter auf ihre Waschstelle — Kinder, die allein über die Strasse müssen, aus deren Pflaster etwas heraufsteigt, von deren Anschlagsäulen etwas herabsteigt, was verhüllt oder nicht verhüllt, Neugier und Begierden erweckt, die besser nicht erweckt werden würden! Kinder, nach denen aus Eckdestillen, aus dunklen Kellerhöhlen, aus finstern Torfluren eine schmutzige Hand sich reckt! Und schwer die Luft von Gerüchen; es ist nichts zu Bestimmendes, nach was es hier riecht, nicht nach Blut aus Schlächterläden, nicht nach Fauligem von Obstkarren, nicht nach den Müllkästen der engen Höfe. Nach all dem dünstet es nicht hier. Und doch nach was so schwer, so unangenehm?!
Marie-Luise hatte sich nie klar gemacht, warum die Luft hier so drückte. Oh, wieviel leichter war es für die Kinder, unschuldige Kinder zu bleiben, die in anderen, lichteren Strassen wohnten! ‚Arme Trude Schindler‘, dachte die junge Lehrerin, ‚erst sieben Jahr und schon so bewusst dessen, was um sie ist!‘ Sie ging hin und legte der müde in ihrer Bank Kauernden die Hand auf den Strubelkopf. Sie zupfte die grosse Haarschleife zurecht, die nur gross tat, die aber so verfleckt war und so zerknüllt, als sei sie seit Tagen nicht frisch gebunden worden. Und wie sah das Haar aus! Natürlich ein Bubenkopf, aber, schlecht geschnitten, zur verwilderten Mähne geworden. ‚Kämmt dich deine Mutter nie — kannst du dich denn selber noch nicht kämmen?‘ Das hätte Marie-Luise fragen mögen, aber sie fürchtete das Kind dadurch zu demütigen. Sie hatte den Wunsch, dieses Kind, ja gerade dieses, vertraulich an sich heranzuziehen. Es würde nicht leicht sein. Trude Schindler sass verdrossen, und so, als fühle sie die über ihr Haar und dann über ihr Gesicht streichende Hand nicht.
Marie-Luise hatte geglaubt das Bewusstsein einer grossen Aufgabe schon längst zu haben, ihre Pflichten, ihre Verantwortlichkeiten ganz genau zu kennen und den Ansprüchen, die ihr Beruf stellt, gerecht werden zu können mit Leichtigkeit — aber wirklich gerecht werden, oh, konnte man das überhaupt?
‚Der Lehrer soll den Schüler zu einem konkreten Idealismus erziehen,‘ das hatte sie in einem pädagogischen Buch gelesen, ‚soll ihn erziehen zu allem Guten, Wahren, Schönen und Heiligen‘ — oh, du lieber Gott, wie macht man denn das?!