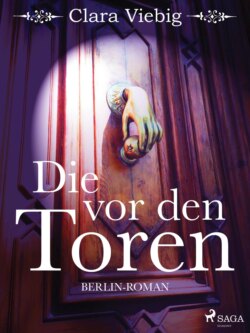Читать книгу Die vor den Toren - Clara Viebig - Страница 4
II.
ОглавлениеDu mußt heute mal bei die Badekown jehn“, sagte Rieke Längnick an einem der ersten Tage zu ihrem Sohn.
„Och“, sagte Paul, der in der Ecke des alten niedergedrückten Roßhaarsofas saß, und streckte seine Beine bequem von sich.
„Du jehst!“ Der Ton war scharf.
Unwillkürlich duckte der junge Mann den Kopf.
Die Mutter fuhr fort: „Wat is det überhaupt for ’ne Sache, kaum en paar Dage biste zurück aus ’m Krieg, un schon rennste immer weg. Ick bitte mir aus, det de dir um mir kümmerst!“
„Ich kümmere mich ja. Aber was soll ich bei der alten Badekown?“
„Du sollst ihr von ihrem Willem erzählen!“
„Ich weiß doch nichts. Und denn wird se weinen, und ich kann niemand weinen sehn!“ Er sagte es kläglich, ein Unbehagen zog dabei über sein Gesicht, und er rutschte unruhig auf seinem bequemen Sitz.
„Nich weinen sehen?! “Wenn se weint, laß se weinen; wat jeht et dir an? Aber wie ich die Hanne kenne, weint se jar nich. Erzähl ihr man allens!“
„Ich sag’ dir doch, Mutter, ich weiß gar nichts!“
„Jotte, denn denkste dir eben wat aus!“
Mit einem ganz dummen Gesicht sah der Sohn seine Mutter an.
„Na ja“, sagte sie, „kuck nich drein wie ’n Schafbock! Du machst der Badekown en Verjnüjen damit. Du hast doch sicher mehr Leute in der Schlacht dodjeschossen werden sehen – na, denn beschreibste ihr det eben!“
„Ich kann nich!“ Der Sohn war wie verwirrt; von einer nervösen Unruhe befallen, schlang er die Finger ineinander und riß sie dann wieder auseinander, daß die Gelenke knackten.
„Wat, kannste dir denn jar nischt ausdenken? Na so dumm! Ick sage dir, du jehst. Sofort. Die Badekown is ’ne jute alte Freundin von uns. Dein Vater hat schonst immer wat von die Badekows jehalten. Wat jloobste woll, wat die Marianne zum Beispiel für Partien könnte machen? Die hat Millionen. Jrafen un Prinzen kriegte die!“
Verwundert hob der junge Mann den Kopf: was ging ihn die Millionenwitwe an? Aber wenn die Mutter es denn durchaus wollte, mußte er wohl hinübergehen! Gehorsam stand er auf, ein großer und breitschultriger Mensch, mit einem Knabenkopf auf einem Stiernacken.
Die Mutter strich ihm über die Wangen: „Na, denn jeh man, Paule, jeh man!“ Und dann faßte sie ihn stark bei beiden Schultern und schob ihn vor sich her zur Tür. –
Nun saß Paul bei der Badekow. In seiner Schüchternheit, mit der er heute mehr denn je zu kämpfen hatte, war er an der Stubentür stehen geblieben: was sollte er denn der Frau von ihrem Sohne sagen?! Sie mußte ihn mehr als einmal auffordern, bis er sich weiter hinein und zu ihr hin auf einen Stuhl ans Fenster getraute.
Wäre er nur erst wieder draußen! Er sprach, als hätte er etwas auswendig gelernt. Leider, der Wilhelm war gefallen, das war ein großes Unglück, das war gewiß sehr traurig, er war auch traurig darüber, aber es war nun mal so. Und es gab ja keinen schöneren Tod als den Tod fürs Vaterland! Das letzte hatte er so oft gehört, es war ihnen so förmlich eingeimpft worden, daß er es hersagen konnte, ohne irgend etwas dabei zu denken. Er dachte nur: ob er es denn so seiner Mutter wohl recht machte?
Noch lange hätte Paul so fortgeschwatzt, hätte ihm nicht die alte Frau die Hand aufs Knie gelegt und ihm von unten her tief in die Augen gesehen. „Laß man sein Paule. Sag mir nur, wie sah mein Willem denn aus, hatte er noch sein altes, liebes Jesicht? Habt ihr ’n ooch ordentlich hinjelegt? Ihm die Hände jefaltet, wie et sich jehört?“
Das wußte Paul alles nicht. In ein Massengrab war der Wilhelm wohl hineingekommen, er hatte sich gar nicht darum gekümmert. Er hatte sich ja nur darum gekümmert, daß er selber noch lebte, daß er noch alles heil beisammen hatte nach der mörderischen Attacke. Und nur gefühlt, daß er todmüde war. Schlafen, nur schlafen! Es war ihm ganz gleichgültig gewesen, ob gesiegt war fürs Vaterland oder ob die Schlacht verloren war – nur schlafen, schlafen. Und er sollte nun der Frau hier, die ihn so ansah, was anderes vorerzählen?! Verlegen drehte er den Kopf zur Seite, ihr Blick genierte ihn.
„Erzähls man, Paule!“ Die Mutter drängte. „Erzähle man allens, wie et jekommen is, un wo“ – ihre Stimme wollte beben, aber sie bezwang das Zittern – „wo liegt er denn?“
Der junge Mann sagte nichts.
„Jott, wie habe ick auf dir jewartet! Du bist der einzige, der wat von ihm weiß – sonst kann mir ja keen Mensch wat von Wilhelmen sagen!“
„Ich weiß auch nichts, gar nichts!“ Er gab sich einen Ruck, er stieß es heraus.
Sie sah ihn starr an. „Nichts – ?!“ Wie ein Wehlaut kam es über ihre Lippen.
Dem jungen Menschen schossen die Tränen in die Augen, er wurde glühend rot. War das nicht fast schlimmer, als wenn sie geweint hätte?! Hastig sprang er auf, drehte ihr den Rücken und rang die Finger ineinander. „Was weiß ich, wo der Wilhelm liegt? Das kann man gar nicht wissen. Zu viele sind eingebuddelt worden!“ Es klang fast roh. „Was Sie sich überhaupt denken! Ich habe den Wilhelm überhaupt nich zu sehen gekriegt. Nichts als Uniformen und Pferde, und rund rum Staub und Pulverdampf. Und als das Trompetensignal zur Attacke blies, und als unser Rittmeister den Säbel schwang, – na, da schwangen wir eben unsere Säbel auch – na, und dann – dann sind wir eben losgeritten!“
„Seid ihr eben losjeritten!“ Die Hände im Schoß gefaltet, saß die Badekow ganz ruhig. Ihre Lippen bewegten sich, aber man hörte sie nicht sprechen.
Einen scheuen Blick warf der Heimgekehrte nach ihr: betete sie? Es sah fast so aus. Wäre er doch nur erst weg von hier! Sehnsüchtig sah der junge Mensch nach der Stubentür, aber er traute sich nicht, jetzt zu gehen. Verlegen stand er, kaum zu atmen wagend.
Da lächelte ihn die alte Frau ein wenig an; ihm die Hand hinstreckend, sagte sie wehmütig: „Dank dir ooch schön, Paule. Nu kannste jehen!“
Er schüttelte ihr kräftig die Hand. Dann war er glückselig, draußen zu sein. Ha, wie dufteten die Linden! Die Sonne schien. Und heute nachmittag würde er den Engländer wieder treffen; oben auf der Bockbrauerei hatten sie sich verabredet, da konnte man das Feld weit übersehen.
Und seine Tochter würde der Mr. Brown mitbringen!
Ein belebender Glanz kam in Pauls wasserblaue Augen, sein Mund breitete sich zu einem frohen Lachen. Das war ja noch ziemlich gnädig abgelaufen, geweint hatte sie nicht!
Aber jetzt weinte Hanne Badekow. Tränen strömten ihr übers Gesicht; sie war allein; nun weinte sie sich aus. Ein tief-innerliches Schluchzen stieß sie: ihr Junge, eines ansässigen Geschlechtes ehrenwerter Sohn, ein Badekow, der lag nun in fremder Erde, wie ein Hergelaufener! Irgendwo; kein Mensch wußte den Platz. Und wenn sie auch hinreiste auf ihre alten Tage, auch sie würde ihn nicht finden. Eingebuddelt hatten sie ihn in fremde Erde; er lag nicht bei seinem Vater, bei seinen Großeltern, bei seinen Urgroßeltern vor der alten Kirche zu Tempelhof. Da lagen sie alle, die Badekows, seit 1500 schon. Auch sie würde dort liegen – nur ihr Wilhelm nicht! Und das war ihr das Bitterste. Wenn sie jetzt nach dem Kirchhof ging, die Gräber zu begießen – es war stets ihr liebster Spaziergang gewesen –, so würde es ihr immer einen Stich durchs Herz geben. Nein, darüber kam sie gar nicht weg!
Sie weinte, wie sonst nur ein junger Mensch weint, laut, heftig, wie gar nicht zu trösten; weinte, bis das Gebimmel vom Turm Mittag anzeigte. Dann wischte sie sich hastig das Gesicht ab: Gott im Himmel, was fingen die Mädchen denn an? Man hörte kein Gerappel in der Küche, man roch auch noch nichts! Kochte Mieke denn nicht? Und wo Auguste steckte? Die klimperte nicht nebenan in der guten Stube auf dem Klavier.
Flink stand Hanne Badekow auf, nahm sich nur noch die Zeit, mit den befeuchteten Handflächen den ein wenig in Unordnung geratenen glatten Scheitel wieder fest anzustreichen, dann lief sie nach hinten in die kleine Küche.
Diese war leer. Das Feuer brannte wohl im Herd, aber kein Essen war aufgesetzt. Da standen noch die Kartoffeln, die sie selber heute in der Frühe geschält hatte, in der Wasserschüssel auf der Eimerbank, und auf dem Tisch lagen die Mohrrüben noch genau so, wie sie sie heute morgen im Garten gezogen und der Mieke in die Küche gebracht hatte.
„Mieke, Mieke!“ Keine Antwort.
„Juste!“ Ah so, die war ja wohl mal wieder in ihrer Klavierstunde. Aber die Mieke mußte doch da sein?!
Die Küchentür führte auf den Hof, die Mutter rannte hinaus. „Mieke! Mieke!“ Das mußte sie hören, wenn sie in der Nähe war. Ob sie vielleicht drüben bei Grete in der Küche saß und über Lachen und Schwatzen die Zeit vergaß? Nein, das konnte nicht sein, Grete war viel zu pünktlich, die würde sie schon herüberschicken, wenn’s an der Zeit war. Wo war Mieke?
Die Mutter spähte umher. Der große Hof lag ganz einsam im stillen Sonnenglanz. Lautlos nur trippelten rotfüßige weiße Tauben und suchten sich Körner. Die Pforte zum Garten stand offen, aber so weit man den langen berasten Gang zwischen den Stachelbeerbüschen hinuntersehen konnte, nirgends war Mieke.
Mit einem Seufzer ging die Badekow in ihre Küche zurück, sie kochte nun selber. Sie tat das gern, es war ihr ein Genuß – nut um Mieke zu beschäftigen, hatte sie darauf verzichtet –, aber heute seufzte sie dabei. Es war ein rechtes Kreuz mit der Mieke, bei nichts, aber auch bei gar nichts hatte die Bestand! Und kein Geschick zu irgend etwas. Die Ferse am Strumpf konnte sie noch immer nicht machen, nur Waschlappen und Staublappen verstand sie zu stricken. Man hatte ja immer gehofft, es würde später mit ihr noch anders werden – als sie vierzehn Jahre alt war, hatte sie den Veitstanz gehabt –, aber war es eigentlich besser mit ihr geworden?!
Die Mutter trat wieder hinaus auf den Hof und rief wie vorhin, noch lauter, noch unruhiger: „Mieke! Mieke!“ – – –
Mieke Badekow konnte das Rufen nicht hören, sie war auf den Acker gefahren; sie dachte gar nicht mehr daran, daß sie kochen sollte. Vor ein paar Stunden, als sie im Garten schlenderte – eigentlich wollte sie nur Suppengrün holen, aber sie verweilte sich –, hatte sie hinten über den Zaun, der an den Feldweg grenzte, den Bauern Brenneke gesehen. Er saß auf seiner Karre vorn auf dem Brett, wollte auf seinen Acker fahren, gen Rixdorf zu. War das ein hübscher Mann!
Miekes schwachsichtige Augen zwinkerten, sie holte ihre Brille aus der Tasche, um ihn besser sehen zu können. Glückstrahlend stand sie dann am Zaun, er hatte sie angelacht. Sie lachte wieder.
Branneke hielt an. Er amüsierte sich: die dachte wohl, sie gefiele ihm so gut?! „Na, wollen Se mitfahren?“ Er sagte es nur zum Spaß, er hatte gar nicht dran gedacht, daß sie seine lachende Frage ernst nehmen könnte.
Aber sie nahm sie ernst. Der hübsche Mann wollte mit ihr in die Felder fahren, der Klee blühte, Kornblumen gab’s auch schon, sie würde sich einen Kranz winden, einen Strauß pflükken! „Ja, ja“, sagte sie hastig. Ihre Wangen glühten vor Eifer, sie machte Anstalt, über den Zaun zu klettern, denn das wußte sie doch noch, die Mutter würde es ihr nicht erlauben, so durfte sie sich nicht vorn herum durchs Haus trauen.
Er half ihr. So was war ja noch gar nicht dagewesen, das Mädel, eine Badekow, stieg zu ihm über den Zaun?!
Sie genierte sich gar nicht. Harmlos ließ sie ihre dicken Waden sehen in den weißen Strümpfen. Ein Zipfel ihres Unterrocks war an einem Nagel der Lattenplanke hängen geblieben, der ganze Rock strupfte sich in die Höhe; Bauer Brenneke mußte sie losmachen, sonst hätte sie zappelnd gehangen wie ein Fisch an der Angel.
Lachend saß sie nun neben dem Mann auf dem Karrenbrett; er hieb auf die Gäule, daß sie wie rasend ausgriffen. Ihm war doch nicht ganz wohl bei der Sache. War es auch recht, die dämliche Mieke mitzunehmen? Ach was, sie selber hatte es ja gewollt! Was konnte er denn dafür?! Der Karren rumpelte mächtig auf dem schlechten Weg; bei jedem Stoß, der die auf dem Brett Sitzenden in die Höhe warf, jauchzte das Mädchen laut auf, und wenn es gegen den Mann geschleudert wurde, lachte es noch viel mehr. Mieke war wie ein Gummiball, weich, rund und elastisch. Da machte Bauer Brenneke sich ein Vergnügen daraus, sie recht tüchtig zu schubsen: die konnte schon einen Puff vertragen. Zuletzt kniff er sie in Arm und Hüfte, und sie lachte auch dazu.
Als Mieke lange nach Mittag erhitzt und zerzaust zu Hause wieder ankam, trug sie auf dem Kopf einen Kornblumenkranz und in der Hand einen großen Strauß: Mohn, Winden, weiße Sternblumen und allerlei Gräser. „Da“, sagte sie, „für Vaterns Jrab“, und schleuderte der Mutter Kranz und Strauß in den Schoß.
Wer konnte ihr böse sein? Es war ihr eben in den Sinn gekommen, Blumen zu pflücken; in die Felder war sie gelaufen, sie war nun einmal ein Kind und blieb ein Kind. Die Badekow, die tüchtig hatte schelten wollen, schwieg: auszanken hatte ja doch keinen Zweck, Mieke würde nie und nimmer begreifen, daß sie unrecht getan hatte. So sagte sie denn nur: „Du darfst nich fortlaufen, Mieke, ohne det de mir fragst, hörste?“
Und die Mutter nahm den Strauß, den die Tochter ihr in den Schoß geworfen hatte, roch daran und stellte ihn ins Wasser: „Danke schön, Kind!“
*
Es war ein Jammer mit Mieke, sie trieben alle ihren Spaß mit ihr, aber sie merkte es nicht. Im Gegenteil, sie war sehr stolz darauf: seit sie im Frühsommer mit Bauer Brenneke auf den Acker gefahren war, waren ja alle wie toll auf sie. Das machte sie glückselig. Wenn die jungen Burschen sich nach ihr umsahen, wenn die Männer sogar ihr zublinkten, oder ihr beim Vorübergehen ein Wort, das nicht gerade fein war, zugeraunt wurde, dann drehte sie sich und schwänzelte. Der Mutter lag sie jetzt in den Ohren, sie wollte zum Geburtstag ein rosa Kleid haben – was sollte sie noch länger in Trauer gehen um den toten Bruder?!
Auch Auguste putzte sich, besonders wenn sie in die Klavierstunde nach Berlin fuhr. Und sie fuhr häufig. Die Lehrerin hatte gesagt, sie solle jetzt lieber dreimal als einmal die Woche kommen. Wollte sie denn ein Klavierfräulein werden, so eine, die sich damit ihr Brot verdiente, daß sie ihre Finger wie Ratten im Schafstall auf dem Klimperkasten herumrennen ließ?! Mutter Badekow schüttelte den Kopf: „Det hast du doch nich nötig, Juste!“
Aber Auguste war gekränkt, ihre Augen füllten sich mit Tränen: also auch dieses Einzige wollte man ihr nehmen? Was hatte sie denn sonst? Die anderen Mädchen im Dorf, mit denen sie in der Schule gesessen hatte, waren längst verheiratet. Mit achtzehn Jahren schon hatte Miene Kiekebusch den Bierbrauer gekriegt, und Trudchen Hahnemann heiratete mit neunzehn; keine war viel über zwanzig gewesen! Auguste wurde ordentlich grob; sie, die sich sonst nie ein Wort gegen die Mutter getraut hatte, stieß jetzt unter zornigen Tränen heraus: „Was weißt du, wie mir zumute is! Ach, ich bin so unglücklich!“ Sie weinte herzbrechend.
„Mutter, das kannste mir jlauben“, sagte Johann, dem die Badekow klagte, „sie is nur so verrückt, weil sie den Windhund, den Paschke, immer noch im Kopf hat. Mit mir mault se auch. Einmal habe ich den Kerl schon rausjeschmissen – er kann sich noch ’n zweites Mal die Türe von außen besehen!“ Der sonst so ruhige Mann redete sich ordentlich in Wut.
„Jawoll“, sagte Hanne Badekow und legte ihrem Ältesten die Hand auf den Joppenärmel, „recht haste, et is ’ne Ausverschämtheit von son’n Menschen, um Aujusten anzuhalten. Aber det se nu tück’sch is, det versteh ick ooch; un et jrämt mir. Die Jrete, deine Frau, hat schonst Zwillinge, un is noch zwei Jahre jünger wie Juste. Kuck dir mal det Mächen jenau an: janz jrau un kritzig sieht se aus!“ Die Mutter seufzte: „Man will doch weiter nischt, als seine Kinder jlücklich machen, aber et scheint, wie man’t macht, macht man’t verkehrt. Seit ich Justen die vielen Klavierstunden jeben lasse, is et jar nich mehr mit sie auszukommen!“
„Mit ihr auszukommen“, verbesserte der Sohn.
„Na ja, mit ihr auszukommen!“ Die Badekow wurde ärgerlich. „Fängste ooch so an? Der Jakob, seit der den jroßen Laden in Berlin hat, verbessert er mir ooch immer; un ick sage“ – sie schlug sich auf die Brust –, „wenn man hier det olle Herz richtig spricht, uf det andere kommt et nich an!“
„Da haste recht!“ Johann war ganz beschämt; herzlich faßte er die Mutter um: „Sei man nich böse, Mutterken!“
„I wo!“ Sie war nicht empfindlich. „Aber um wieder auf Aujusten zu kommen – die janze Nacht habe ick destowegen nich schlafen können –, sie wird ’n doch nich treffen, wenn se nach Klavierstunde jeht? Sie bleibt immer so lange!“
„Donnerwetter!“ Johann sah betroffen aus, aber dann schüttelte er den Kopf: „Nee, Mutter, das redste dir ein, so runter jibt sich Aujuste nich. Was wohl Jrete zu meint?“ Er wollte zur Tür.
Aber die Mutter hielt ihn fest. „Nee, nee, laß man! Wenn se ooch deine Frau is – – ’ne jute Frau, – se is aber doch ’ne Schellnack. Wat ick so mit dir spreche über Aujusten, und – und – na, überhaupt so über unsere Familie, det bleibt unter uns Badekows!“
Johann nickte zustimmend; er verstand das vollkommen.
„Und denn, Johann“ – die Mutter sprach mit gedämpfter Stimme –, „denn muß ick dir ersuchen, mir zum Ersten fünfdausend Daler flüssig zu machen. Ick habe ja keen Jeld bar zu liegen.“
„Wozu brauchste se denn?“
„Ick – ick brauche se.“ Sie zögerte, aber dann sagte sie entschlossen: „Ick will se Jakob’n jeben!“
„Jakob jeben – schon wieder? Kommt der schon wieder und bettelt dich an?!“
„Jestern war er da“, sagte sie. Und dann leise, wie bittend: „Wat kann er dafür, wenn ihm ’ne Hypothek jekündigt is? Er find’t so rasch keene andre nich!“
„Ach was, das red’t er dir vor. So ’ne lumpige Hypothek. Wenn er nich faul stände, kriegte er sofort überall die paar Tausend. Ein Badekow! Und bei dem Geld, was wir noch mal von dir erben! Aber er is eben ’n fauler Kopp!“ Johann kochte innerlich. Natürlich, so war die Mutter immer; wenn Jakob kam und Geld verlangte, dann gab sie. Wo sollte das noch hin? Was hatte der Jakob schon alles geschluckt! Zehn Berufe hatte er gewechselt, zuletzt war er auf dem Kaufmann hängen geblieben. Die Mutter mußte man zurückhalten ihm gegenüber. „Wenn wir nu alle so sein wollten!“ Er sagte es vorwurfsvoll. „Wir haben doch alle jleiches Recht!“
„Wartet man ab!“ Sie sagte es ohne jede Ärgerlichkeit; es war ja ganz selbstverständlich, daß Johann auf ihr Erbe rechnete. Die Kinder hatten nur jedes dreißigtausend Taler, den ganzen großen Rest aber sie. Uneingeschränkt. „Vor der Hand biste noch nicht in Verlejenheit, du hast jut jeheirat’t, du kannst et abwarten. Un wenn de vielleicht meinst, ick schenke Jakob’n wat, denn irrste dir. Et wird ihm abjezogen bei Heller un Pfennig. Ick habe euch alle jleich lieb. Wat Jakob jetzt verbraucht, kann er später nich erben, aber – laß mir die Freude, ihm schon jetzt wat zu jeben. Nachher sehe ick ja doch nischt mehr von!“
Da konnte Johann ihr wiederum nicht unrecht geben, wenigstens nicht ganz. Sie einigten sich immer. Sie wußten beide das Geld zu schätzen und hielten es fest, – Johann war noch mit seiner Mutter auf den Wochenmarkt gefahren und schätzte den Wert des Sechsers – aber er war auch ein Badekow und sah es ein, daß die Mutter den Jakob nicht im Stich lassen konnte.