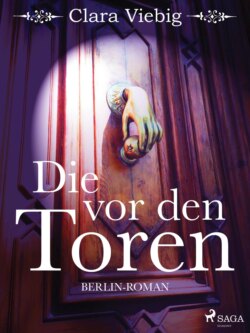Читать книгу Die vor den Toren - Clara Viebig - Страница 5
III.
ОглавлениеEs ging das Gerücht um, eine englische Terraingesellschaft würde das Rittergut Tempelhof, den früheren Besitz der Templer, den Templer Hof, käuflich erwerben. Überall im Dorfe wurde diese Neuigkeit besprochen. Oho, die waren mehr als schlau, diese Engländer, diese Pfeffersäcke! Kauften guten märkischen Boden, um ihn dann in Stücke und Stückchen auseinanderzureißen, je nach Bedarf, und ihn zu „verkloppen“ an Gott weiß wen und zu Gott weiß was für Zwecken!
Man war aufgeregt, fast empört über den jetzigen Besitzer, der solch einen Schacher trieb!
In Kiekebuschs Gastwirtschaft wurde die Sache lebhaft besprochen. Bis unter die Dorflinden schallte, trotz der geschlossenen Fenster, der hitzige Diskurs: wieviel zahlten die Kerls? Für viermalhunderttausend Taler hatte seinerzeit der Graf den Templer Hof an den Bankier verkauft, aber der würde jetzt erheblich mehr herausschinden. Das Gut war auch mehr wert – überhaupt jetzt nach dem Krieg! Jetzt war Geld ins Land gekommen; das rollte. Donnerwetter, fünf Milliarden! Überall Millionenregen. Davon konnte, wollte und mußte jeder profitieren. Tempelhof hatte lange genug schlechte Zeiten gehabt. Wie hatte es noch vor fünfzig Jahren hier ausgesehen! Erst nach den großen Bränden der zwanziger Jahre waren die Strohdächer verschwunden, und es war anständig gedeckt worden; nur die alte Badekowsche Scheune hatte noch Stroh. Aber wenn die alte Badekow erst das Zeitliche gesegnet hatte, dann würde der Johann auch gleich neu bauen.
Warum sollte die alte Scheune weg? Die hatte zwar nur Lehmwände, aber sie stand noch lange fest; früher baute man solider. Großvater Schellnack, ein Mann in den Achtzigern, redete für die Scheune. Nicht nur, weil seine Enkelin Grete den Johann Badekow geheiratet, und weil schon seit ein paar Jahrhunderten Badekowsches und Schellnacksches Blut sich vermengt hatten: er hielt was darauf, daß man einem Dorf anmerkte, daß es eine Vergangenheit hatte. Oho, Tempelhof konnte noch lange mit Berlin konkurrieren!
Der alte Schellnack ereiferte sich; er war schwer zu verstehen mit seinem zahnlosen Mund, und je mehr er sich ereiferte, desto mehr mummelte er und seiberte dabei. Als man ihm nicht recht zuhörte, reckte er sich. Der kräftige Schnapstrunk seiner Jugend war ihm besser bekommen, als der auf ihn folgenden Generation das aufschwemmende Bier. Er war noch immer mager und sehnig, und wenn er auch einmal betrunken war, er verlor selbst im Rausch nicht die Haltung. Die Tempelhofer sahen auf ihn: alle Achtung, das war ein Pichler!
Jetzt legte der Alte die magere Hand, an der die Adern wie blaue Stricke heraustraten, zur Faust geballt vor sich auf den Tisch: warum hieß es immer: Berlin, Berlin – warum nicht: Tempelhof, Tempelhof! In der alten Chronik, die im Amtshause lag, konnte man’s lesen: Tempelhof hatte sich frei gemacht von den Städten Cölln und Berlin, schon um das Jahr 1438. Es hatte sich nicht gescheut, mit der größeren Macht zu kriegen. Den Kottbuser Damm entlang, durch Urban- und Pionierstraße, vom Planufer zur Linden- und vom Belle-Alliance-Platz zur Wilhelmstraße, von da bis zur Königgrätzer Straße und bis dahin, wo jetzt die Potsdamer Bahn den Schiffahrtskanal durchschneidet, war die Tempelhofer Grenze gegangen. Von all den Straßen war noch kein Baustein dagewesen, aber Tempelhof hatte schon einen Namen gehabt, der stand fest.
Und kein anderes Feld in der ganzen Welt konnte sich gleichen Rufes rühmen, wie das Tempelhofer! Von alten Zeiten gar nicht einmal zu reden. Aber es war noch nicht viel mehr als hundert Jahre her, da hatte der Russengeneral, der Totleben, von den Tempelhofer Bergen aus die Stadt Berlin beschießen wollen; da kam der Major Kleist von Steglitz her und fiel dem General in den Rücken. Mit „Marsch! Marsch!“ jagten preußische Jungen die Russen wie Karnickel übers Tempelhofer Feld, daß sie flohen nach Rixdorf hin.
Und auf dem Tempelhofer Feld hatte Schill um 1809 gehalten. O, er selber, der alte Schellnack, war damals noch jung gewesen und hatte dabei gestanden und gehört, wie der Schill die Freiwilligen aufrief. Vom Tempelhofer Feld weg ging’s gleich mit „Hurra!“ auf den Siegesmarsch.
Und auf dem Tempelhofer Feld hinter Kriegersfelde hatte man siebzig das große Barackenlazarett aufgeschlagen für die Verwundeten – kein besserer Platz in der ganzen Mark war da – und vom Tempelhofer Feld her waren die Sieger jetzt auch eingezogen in Berlin. War das nicht genug, das Feld hochzuhalten?
Hie gut Tempelhof allewege!
„Und nu wollt ihr euch mit dem Berlin bemengen? Schafsköppe seid ihr, wenn ihr dat dut. Bleibt für euch. Wenn et euch in die Finger juckt, det ihr dat Bauen nich lassen könnt, denn baut. Aber Tempelhofer Häuser, Dorfhäuser! Laßt euch nicht so’ne hohe Kästen vor die Neese setzen. Die Badekow hat ja so recht, det se de olle Scheune nich niederreißt! –De Dorfstraße plastern se ja nu ooch“, schloß er. Es klang wie eine Klage.
„Bravo!“ brüllte Gottfried Lietzow durch das jetzt entstehende allgemeine Stimmengewirr. „Der Olle red’t wie’n Paster. Aber warum sollen wir eijentlich nich an Berlin verkaufen? Jroß-vater!“ Er legte dem unzufrieden vor sich hin Murrenden beschwichtigend die Hand auf die Schulter. „Regen Se sich man nich auf! Wenn wir ooch an die Berliner Land verkaufen – werden wir dadrum Berliner? I wo! Wir bleiben doch Tempelhofer!“
„Na!“ Der Greis wiegte zweifelnd den Kopf.
„Selbstverständlich!“ Gottfried lachte. „Hab ick nich ’ne Tempelhoferin zur Frau? Un Jott weeß, ick könnte mir anderswo nich jlücklich fühlen!“
„Aber die Kinder, die Kinder!“ Großvater Schellnack murmelte etwas in sich hinein; man mußte feine Ohren haben, um es zu verstehen, „Berlin kommt zu nahe, dat frißt uns auf!“
Keiner hörte mehr auf ihn, auch Gottfried, der neben dem Alten gesessen hatte, rückte jetzt von ihm ab. Besitzer Hahnemann wollte wissen, daß der Bankier fünfmalhunderttausend Taler gefordert und auch anstandslos erhalten hatte – über hunderttausend bar verdient! Eine unverschämte Forderung für das bißchen Land. Aber na, wenn er es kriegte! Der wäre ja dumm, der sich die Zeit nicht zunutze machte!
Man schrie durcheinander. Und still bei sich erwog jeder die Frage: ob die Engländer wohl noch mehr Land kaufen würden? Vielleicht auch bäuerlichen Besitz? Man hoffte es.
Natürlich, die Längnick hatte schon wieder Witterung gehabt! Ihren Paul konnte man alle Tage mit dem Sekretär der englischen Gesellschaft zusammensehen, mit dem Mister Braun; er hieß Braun, aber er schrieb sich Brown. Am Belle-Alliance-Platz wohnte er möbliert, dort konnte man die Visitenkarte an der Türe lesen. – – –
Durch einen Zufall hatte Paul Längnick Miß Ethel Brown kennen gelernt. Am Abend der Illumination war es gewesen. Im Begriff, nach Hause zu gehen, denn müde war er nun doch endlich geworden von dem Umherziehen durch Straßen und Wirtschaften, hatte er geholfen, ein junges Mädchen, das im Gedränge ohnmächtig geworden war, aus dem Gewühl herauszuschaffen. In das erste beste Haus war er hineingegangen und hatte einen Stuhl und ein Glas Wasser herausgeholt, so gut hatte ihm das erblaßte Gesicht und die Fülle des braun-goldigen Haares, das die junge Dame offen herunterhängend trug, gefallen. Und er hatte sie dann auch mit ihrem Vater zusammen nach Hause geführt. So war die Bekanntschaft zustande gekommen. –
Was bei Paul Längnick Sache des Herzens geworden war, war bei Rieke Längnick etwas anderes. Paul hatte ihr von dem hübschen englischen Mädchen erzählen wollen, doch das interessierte sie wenig – was gingen sie englische Mädchen an? Aber als sie erfuhr, daß der Vater der Engländerin zu der Gesellschaft gehörte, von der jetzt überall so viel die Rede war, schickte sie ihren Paul nach dem Belle-Alliance-Platz: „Erkundige dir, wat dat Fräuleinchen macht. Bedanke dir, det er dir noch mit ’n Jlas Wein traktiert hat – hat er dir nich ooch ’n Trinkjeld jejeben? Un denn jibste ihm zu verstehen – nich durch de Blume, nee, du sagst et jradezu –, dat du ’n reicher Tempelhofer Besitzerssohn bist, und dat deine Mutter sich freuen würde, den Herrn mal bei sich zu sehen uf ’ne Butterstulle, wenn er nach Tempelhof kommt. Verstehste?“
Er sah sie verdutzt an, er begriff die Gastlichkeit nicht. Aber er war froh darüber. Er würde das hübsche Mädchen, das ihn so sanft und dankbar angelächelt hatte, wiedersehen!
Der Sohn merkte es nicht, daß die Mutter spekulierte. Er wußte nicht, was spekulieren heißt, er hatte ja auch nie empfunden, was es heißt, nach etwas gieren. Als er noch ein kleiner Junge gewesen war, hatte ihn die Mutter hinausgeführt und mit einer umfassenden Armbewegung hatte sie in die Runde gezeigt: „Det is allens Längnickscher Besitz!“ Er hatte das als selbstverständlich hingenommen; er trug gar kein Verlangen nach irgend etwas, er hatte ja genug. Jetzt, vielleicht zum ersten Mal, fing es ihn an zu freuen, daß er so viel besaß. Was Mister Brown wohl dazu sagte? Ob er solch einem Schwiegersohn abgeneigt sein würde?!
Der Engländer sah sich alles genau an, was der junge Tempelhofer ihm zeigte. Mister Brown horchte ihn aus, aber Paul merkte es ebensowenig, daß der Fremde spekulierte, wie er darüber nachdachte, warum seine Mutter so entgegenkommend war. Bereitwillig führte er den Herrn überall herum, und als Mister Brown den Wunsch äußerte, auch mit den übrigen Besitzern Tempelhofs bekannt zu werden, führte er ihn zu Kiekebusch. Da saßen sie ja immer alle zusammen, am Vormittag eine Stunde – Frühschoppen – am Nachmittag eine Stunde – Dämmerschoppen – und abends nach dem Nachtessen wieder; da wurde im Winter Domino gespielt, im Sommer Kegel geschoben.
Die Schellnacks, die Lüdeckes, die Hahnemanns zogen die Brauen hoch, als Paul Längnick mit dem Engländer eintrat: aha! Hatte man nicht richtig vermutet? Die Längnick, die verstand’s. Da kam ihr Sohn und hatte schon den gefangenen Fisch am Köder!
Murrend rückte Großvater Schellnack nur um ein Weniges, kaum so viel, daß Paul mit Mühe seinen Stuhl an den Stammtisch quetschen konnte. Neben Lietzow fand der Engländer Platz; gegen ihn war man höflicher.
Hahnemann vom Hahnenhof, ein schwerer Bauer, der sich sonst nicht um Tod und Teufel scherte, unterließ das auf die Diele Spucken und paffte weniger qualmende Wolken aus seiner stinkenden Tabakspfeife. Es konnte doch immerhin möglich sein, daß der Engländer noch mehr Land aufkaufte. Wer weiß, was seine Gesellschaft noch vor hatte: vielleicht Fabrikanlagen? Oder Rennbahnen großen Stils? Es waren früher immer die Rennen hier auf dem Felde geritten worden, nach Lankwitz zu, bis sie verlegt worden waren nach Hoppegarten.
Hahnemann stieß mit dem Fremden an. Eigentlich wäre das zuerst dem Amtmann Schellnack zugekommen, aber der hielt sich noch zurück. Sein frisches, rundes Bauerngesicht, dem das Grete Badekows sprechend ähnlich sah, hatte etwas Verlegenes. Wenn sein Vater zugegen war, hielt er sich stets zurück. Der alte Schellnack führte noch immer das Regiment im eigenen Hause – der Amtmann wohnte bei ihm zur Miete – und ebenso im Wirtshaus; da führte er für die Familie das Wort, der Sohn brauchte nur beipflichtend zu nicken. Und er hielt streng darauf, sein Sohn mußte „Sie“ zu ihm sagen, die Schwiegertochter, eine Kiekebusch, auch; er selber sprach, wenn er ungnädig war: „Will Er wohl!“ oder „Sie hat gar nichts zu sagen!“
Großvater Schellnack schoß aus seinen, hinter der knochigen Stirn ganz versunkenen Augen einen scharfen Blick auf die Neuangekommenen: der Paul war ein dummer Junge, aber der Engländer hörte das Gras wachsen! „Wat will Er hier?“ knurrte er diesen an.
Mister Brown sprach geläufig Deutsch, und er sprach viel.
„’n jewandter Mensch“, flüsterte Gottfried seinem Schwager Johann zu.
Sie waren alle eingenommen von dem Fremden. Mister Brown sagte Angenehmes: Tempelhof gefiele ihm außerordentlich, die Lage zur Großstadt glänzend, dabei eine ungeheure Entwicklungsmöglichkeit! Diese Felder! Soviel Platz! Bis zu den Sandbergen vorm Stadttor hin eine einzige Fläche, ideales Bauland!
Sie horchten alle hoch auf: würde er nun etwas sagen?! Jeder von ihnen hatte da irgendwo sein Schmerzenskind, einen oder mehrere Äcker, die nicht viel einbrachten; der Boden war gering, eigentlich nur zu gebrauchen, um die Schafherden darauf zu weiden. Aber das brauchte man ja nicht zu sagen. Schon als der Fiskus damals angekauft hatte fürs Militärgelände, hatte man sich vorgesehen: Acker war Acker und mußte auch danach bezahlt werden.
Aber der Engländer sprang ab. Er lobte nur noch die Luft Tempelhofs, seine schönen Bäume, und dann erzählte er von England. Das interessierte keinen Menschen. Um das Gähnen zu verbergen, sagte man einmal über das andere „Prost!“ Aus Langeweile trank man ein Seidel nach dem andern. Wie eine vor dem Mauseloch vergeblich lauernde Katze zuletzt müde blinzelt und nicht mehr recht aufpaßt, so druselten die Besitzer über ihren Gläsern. Sie wurden erst wieder aufmerksam, als der Engländer die große Zahlungsfähigkeit seiner Gesellschaft rühmte. Jetzt, würde er jetzt etwas sagen? I was, man mußte ihn kommen lassen, dann war man in der Hinterhand und folglich im Vorteil!
„Warum erzählt Er uns det allens?“ fragte plötzlich der alte Schellnack, stemmte beide Ellbogen auf den Tisch, den Kopf zwischen die Hände und sah den Fremden mit seinen versunkenen Augen starr an. „Hat Er denn ieberhaupt ’nen Ton zu sagen dabei? Wenn ’n jroßet Haus wat holen will, kommt et ooch nich selber, et schickt den Hausknecht. Un zu sagen hat der jar nischt!“
Gottfried prustete laut heraus: der Alte war unbezahlbar! Er kniff seinen Schwager vor heimlichem Vergnügen.
Aber Johann Badekow hielt sich ernst, er hatte nicht den Sinn fürs Komische.
Amtmann Schellnack war peinlich berührt. Er sagte leise zu seinem Vater etwas; dieser hielt ihm auch das Ohr hin, aber als er gehört hatte, was sein Sohn tuschelte, sagte er: „Ick verstehe Ihn nicht. Red Er doch laut!“ Da schwieg der-Amtmann verlegen.
Der Engländer aber wurde gar nicht verlegen. Lächelnd drehte er den Kopf nach der Seite, wo Paul Längnick saß: sein junger Freund da konnte ja am besten sagen, was für eine Stellung er hatte. Auf ihn – er rieb sich die Hände –, ganz allein auf ihn kam es an! Was die Gesellschaft ankaufte, brachte er in Vorschlag. Darum sah er sich ja hier so um. „Herr Längnick weiß es!“ Er nickte Paul aufmunternd zu. „Nicht wahr, so ist es?“
Paul hatte mit ganz verlorenem Ausdruck dagesessen und starr in sein Glas gesehen. Jetzt fuhr er auf. „So ist es“, sprach er nach. Ganz willenlos. Was ging ihn das Gerede hier an?! Er dachte an das, Mädchen, das er liebte.
Also der Paul wußte es?! Eine Bewegung ging um den Stammtisch. Weiß Kuckuck, die Längnick hatte am Ende schon verkauft! Wieviel? Und zu welchem Preis?!
Der grobe Hahnemann räusperte sich und spuckte dann auf die Diele: „So’n Aas!“
Amtmann Schellnack erbleichte, er hätte auch gern verkauft.
Johann Badekow wurde dunkelrot: ein solches Geschäft wäre auch für ihn zu machen!
Sie ärgerten sich alle, nur Gottfried Lietzow lachte. Gutmütig klopfte er den jungen Längnick auf die Schulter: „Na, Paule, mein Sohn, deine Mutter hat wohl mal wieder ihr Schäfchen jeschoren?“ Und dann lachte er hell, die verblüfften Gesichter waren zu komisch.
Es war dann ein paar Augenblicke ganz still, bis Großvater Schellnack ingrimmig murmelte – aber jetzt verstand man ihn doch ganz gut: „Se is nich umsonst ’ne Längnick. Wat ihre Schwiegermutter war, det war ooch ’ne Längnick. Vier Hufen hatten se zu Anfang man bloß – un nu? Die Olle, det war erst eene!“
„Na, erzähl man schon, Schellnack“, sagte Hahnemann und lachte breit, „det der Paule die Jeschichte von Jroßmuttern ooch zu hören kriegt!“ Ein allgemeines Gelächter dröhnte, Paul lachte mit. Er hatte das, was früher in den Spinnstuben herumgemunkelt wurde und sich lebendig erhalten hatte bis auf den heutigen Tag, oft gehört, aber er hatte es nie geglaubt; er glaubte es auch jetzt nicht.
Der alte Schellnack lächelte grimmig. Er schluckte ein paar Mal; wenn er diese Geschichte erzählen konnte, lief ihm das Wasser im Munde zusammen. Eifersüchtig wachte er darüber, daß nicht etwa Hahnemann oder Kiekebusch, die ums Jahr 1823 doch auch schon in Hosen gelaufen waren, sie ihm wegschnappten. Er war damals hier Schulze gewesen, er wußte alles am allerbesten.
Es war ein warmer Tag, ein recht schöner Frühlingstag, da war wieder einmal in Tempelhof Feuer ausgekommen. Auf dem Ende der Dorfstraße nach Rixdorf zu. Ob es angelegt worden war? „Na, man will ja nischt sagen“, murmelte, der Alte und schluckte wieder. Als ob er etwas Köstliches äße, bewegte sich sein zahnloser Mund; er genoß seine fette Geschichte.
„Bei Längnicks fing dat mit’m Feuer an, als allens schlief. Die olle Mine Längnick muß aber noch ufjewesen sind – wie hätte se sich denn sonst so schnell retten können? Sie rannte nu immer unter den Linden rum, schmiß die Hände übern Kopp und schrie: ‚Wir sind rujeniert!‘ Un dem Kossäten Tunichtgut sein fette Sau rannte ooch unter den Linden rum; an der einen Seite brannte der Schmer ihr lichterloh, und die Ferkels wuselten quietschend hinter ihr drein. Man hätte et der Mine fast jlooben können, so hatte se sich. Et war en fürchterlicher Brand, keener von allen war je so schlimm. Unter die Linden war’t hell von die Flammen, der Himmel war brandig rot; bis in Berlin konnten se’t sehen. Un en Rauch und en Dampf war, un en Stunk, man kriegte keenen Mund voll richtje Luft mehr. Von Turm läuteten se in einem fort, un der Nachtwächter tutete – ja woll, so rasch jing det damals noch nicht mit die Feuerwehr! ‚Wasser! Eimer von Hand zu Hand!‘ Wir stellten uns alle Mann mang die Reihen, ich vorneweg–wat konnten wir schaffen bei so’n Feuer!“
„Ja“, grunzte Hahnemann zwischen seinem Paffen, „det war kolossal. Ick weeß ’t noch wie heute, wie Mutter mir aus ’s Bett holte: ‚Junge, steh man uf, janz Tempelhof brennt!’ Ick freute mir sehr. Det war mal ’n Fez! Ick rannte los mit die anderen Jungens, wir schrieen immerzu: ‚Feurio!‘ Un von Rixdorf kam die Feuerspritze anjerasselt –“
„Falsch!“ Schellnack fiel ihm wütend in die Rede. „Wat du weest! Von Alt-Schöneberg kam die erste Spritze, un denn erst die von Rixdorf. Aber helfen konnten se alle nich. Als et Morjen war, krähten die Hähne über lauter Schutt. Da lagen acht Jehöfte die Reihe lang, janz schwarz in Asche. Andere jlimmten immer noch, un wo eener stökerte, und wollte sich noch wat rausholen aus seinem Hause, da schlug noch die Flamme auf. Viel Vieh war verbrannt; dem einen die janzen Schafe, dem andern sechs Kühe. Aber die janze Hinterpartie von Längnicks, die stand unversehrt; det kam von den Störchen, die der Storchen-Paule anjezahmt hatte uf der jroßen Scheune. Det sind Jlücksvögel. Kein Stück Vieh war verbrannt, nur der Längnick.
„Et kamen nu die Berliner an in hellen Haufe. Wat Beene hatte, spazierte vor die Tore. Kremser, janz voll bepackt, fuhren raus, un Kutschen, un Schlächterkarren, alle Sorten Jefährte; bei dem schönen Wetter machte det Verjnüjen. Die Felder waren ganz pickevoll von Menschen. Und die jaben alle den Abjebrannten.
„Det machte sich Längnicks Mine denn nu ooch zunutze, und die hätte et doch am wenigsten nötig jehabt, denn sie waren ja hoch versichert. Sie hockte uf ’ner Hutsche vor ihrem Hof, hatte sich in ’n schwarzes Tuch injewickelt, det nur de Nasenspitze rauskuckte und die jlubschen Oogen. Sie streckte die Hand aus. Und in’n Schoß hatte se in ’ner Molle ihren seligen Längnick. Nur ’n paar Knöchelchen waren iebrig von dem.
Det machte böses Blut. Et kamen welche zu mir jelaufen und beklagten sich: Mine Längnick hätte den meisten Ankratz. Da jing ich hin. Aber wie se mir kommen sah und det Schimpfen hörte, da schnitt se mir ’ne Fratze wie dem Teufel seine Leibhaftige, sprang in ihr Hinterjebäude und schlug mir die Tür vor der Neese zu!“
Der Alte griente boshaft: „Det war deine Jrößmutter, Paule!“
Die Zuhörer lachten laut.
Paul Längnick war nun doch verlegen; er wußte nicht, was er sagen sollte.
Aber Mister Brown half ihm gewandt aus der Situation: „Well, eine tüchtige Dame! Sie würde bei uns sehr bewundert werden!“ Er lächelte ein wenig malitiös.
Da waren sie wie aufs Maul geschlagen.
Und dann nickte der Engländer Paul zu: „Kommen Sie, Mister Längnick, wir wollen jetzt gehen!“