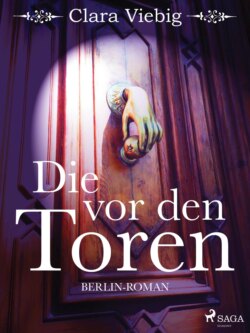Читать книгу Die vor den Toren - Clara Viebig - Страница 7
V.
ОглавлениеZwei Hochzeiten sollten demnächst stattfinden, von denen sich kein Tempelhofer hätte etwas träumen lassen. Was, die Längnick gab zu, daß ihr Paul ein Mädchen aus der Fremde heiratete? Eine, die mit offenen Haaren herumlief wie eine Kunstreiterin? Eine, deren Familie man nicht von A bis Z kannte?! Es war ein großes Verwundern im Dorf. Aber freilich, der Vater der Engländerin war doch immerhin ein Mann, der auf etwas stand; die Rieke würde das schon wissen, die machte nie ein schlechtes Geschäft. Aber was fiel der Badekow ein?! Die gab zu, daß ihre Guste den Zigarrenfritzen heiratete?! Na, da hätte sich, wenn man sich Mühe gab, doch noch für die etwas Reelleres finden lassen, am Ende ein Witwer oder sonst ein ältlicher Mann! – – –
Auguste Badekow war glücklich. So glücklich, daß sie ordentlich hübsch wurde. Der verdrießliche Zug um ihren Mund war geschwunden, ihre verblühten Wangen wurden rosig, ihre matten Augen bekamen Glanz. Alle Tage kam der Bräutigam.
„Das is ’n Jelabbere und Jetue“, sagte Johann zu seiner Grete, „nich mehr zum Ansehen!“ Er war verdrießlich. Ungern nur sah er seine Schwester Julius Paschke heiraten. Das war doch keine Partie, ein Reisender für ein Zigarrengeschäft! Aber das war es noch weniger – Paschke würde sich ja selbständig machen mit Augustens Geld – ihm mißfiel dessen Art. Vertraulich sprach er mit seinem Schwager Lietzow darüber: „Jottfried, du hast ’nen juten Riecher, was hältste von dem Menschen?!“
„Windhund“, sagte Gottfried nur und stieß einen kurzen Pfiff aus.
Auch Frau Lene war wenig entzückt: „Wenn das man jut jeht!“ Sie verhehlte ihr Mißfallen der Mutter nicht.
„Als ob er mir jefiele“, sagte Hanne Badekow. „Aber ick sage mir: ’n Mann, der alle Sonntag in die Kirche läuft, is vom Übel! ’n Mann, der alle Dage in’t Wirtshaus läuft, is ooch vom Übel – der Paschke jeht nich in de Kirche, aber er läuft ooch nich in’t Wirtshaus. Und wo soll ick denn ’nen andern vor Justen herkriejen? ’n bißken schief is se ooch. Und hat se sich nu mal so weit mit ihm injelassen, nu och immer rin. Zähne zusammenjebissen. Et hilft nu ja doch allens nischt mehr!“
Sie hatte recht. Was half das Dagegensein?! Das hatte sich Hanne Badekow gesagt gleich in derselben Stunde, da Johann zu ihr auf die Stube gekommen war, ganz rot und in einer Hast, die seinem sonstigen Wesen gänzlich fremd war.
Er hatte sich vorgenommen gehabt, Auguste zu beobachten; sie fuhr zu oft in die Klavierstunde nach Berlin und blieb zu lange. Johann hatte sich mit Lietzow verbündet; Gottfried war ja nicht bloß sein Schwager, seine Mutter war auch eine Badekow gewesen, vor ihm brauchte man also kein Hehl zu haben. Um drei fuhr der Omnibus, Auguste war zur Stunde aufgebrochen, sie ging mit ihrer Musikmappe ab.
„Haste jesehn?“ flüsterte Gottfried lachend, als sie hinter ihr drein schlichen, „wie’n Schild hält se sich de ‚Musik‘ vor’n Bauch. In Joldbuchstaben, janz jroß, det et ooch jeder sehen kann!“
Aber Johann lachte nicht, er schämte sich seiner Rolle; es war nicht angenehm, daß sie hier wie die Spürhunde nachschnuppern mußten.
Auguste stieg in den Omnibus. Als sie glücklich darin saß, kletterten die beiden Späher am Seitentreppchen hinauf aufs Dach. Nun konnten sie gut beobachten. „Die sieht ja nich nach uns, die is jetzt janz in’n Tran“, sagte Gottfried.
Sie fuhren im schwankenden Gefährt eine lange halbe Stunde über die Chaussee. Johann schalt über das langsame Zotteln, aber Gottfried tröstete: „Na, man Jeduld, du kriegst noch früh jenug dein Wunder zu sehen!“
Das war nicht schön, daß der Schwager noch uzte! Johann wurde immer grimmiger.
Am Belle-Alliance-Platz stieg Auguste aus und ging nach rechts. Wo wollte sie denn hin? Die Lehrerin wohnte doch links herum, Wilhelmstraße.
„Sie trifft ihn wo“, flüsterte Gottfried.
Hastig kletterten sie vom Deck herunter. Johann wäre beinahe fehlgetreten, er kam sich selber nicht sicher mehr vor; seine Beine zitterten. Das kam bloß von dem verfluchten Geratter, der Omnibus stieß auf dem harten Pflaster! Aber die Beine zitterten ihm auch noch, als sie nun gingen, immer hinter Auguste drein. Vorsicht war kaum nötig, sie sah sich nicht um. „Sie rennt ja wie besessen“, ächzte Gottfried. Sie kamen ganz außer Atem.
Nun bog sie in die Lindenstraße ein.
„Donnerwetter!“ Johann faßte nach Gottfrieds Arm: da wohnte der Kerl ja – Lindenstraße 104! Da war die Nummer! Auguste hielt an. Sie huschte ins Haus. Sie lief die Treppen hinan – drei Treppen.
Auf dem zweiten Absatz blieben die Verfolger zurück. Sie stiegen erst hinauf, als oben die heisere Klingel ausgeschrillt und eine Tür geklappt hatte. Auguste war drinnen.
„Also hier spielt se Klavier?!“ sagte Gottfried.
„Sei man bloß stille!“ Johann war ganz blaß. Sie studierten die Schilder. Links wohnte „Prim, Herrenschneider“ – aber hier rechts: „Amanda Schulze“ – und eine Visitenkarte war darüber, mit Reißzwecken angepiekt:
Julius Paschke.
Sie hatten dann auch geklingelt und sie herausgeholt. Es war eine schreckliche Situation gewesen. Gottfried hatte dem Kerl ein paar gehörige Grobheiten an den Kopf geworfen, die dieser mit einer Ruhe, die Gottfried noch mehr in Rage brachte, einsteckte. Gewiß, er konnte es begreifen, daß es den Herren nicht angenehm war, das Fräulein hier bei ihm zu finden, aber er konnte sie versichern – er gab sein Ehrenwort – es war nichts passiert. Gar nichts. Dafür stand ihm seine Braut, Fräulein Auguste Badekow, viel zu hoch.
Ein unverschämter Fatzke! Lietzow schrie ihm ein: „Halten Sie Ihre Schnauze!“ entgegen. Aber dann wußte er auch nichts weiter zu sagen: wahrhaftig, sie waren die Blamierten. Was nun?!
Auf Johann war nicht zu rechnen, er brachte kein Wort vor. Wie begossen stand er; es kränkte ihn doch zu tief: seine Schwester, eine Badekow aus Tempelhof, rannte zu einem Kerl hin?! Stumm führte er die weinende Auguste fort. Er hätte auch weinen mögen. Den ganzen weiten Weg hielt er sie fest ums Handgelenk.
Gottfried trug die Musikmappe hinterher. Sie hatte am Boden gelegen, er hatte sie aufgerafft, man konnte sie doch nicht dalassen. –
Aber nun war das alles vergessen, oder schien doch vergessen. Auguste triumphierte: sie hatte es durchgesetzt, sie hatte ihren Julius erobert. Und so romantisch war das alles. Romantischer konnte es nicht zugegangen sein damals, als der Tempelhofer, der stolze Ritter, die Tempelhofer Bauerntochter am Klarensee getroffen und geliebt hatte. Träumend zog sie Vergleiche: ach, ihr Julius, war er nicht auch wie ein vornehmer Herr?! Ganz geblendet war sie von ihm; sie hatte kaum einen eigenen Willen mehr, demütig ordnete sie sich ihm unter.
Die Mutter sprach ernst mit ihr, sie hörte nicht zu. Wenn Hanne Badekow auch nichts Böses von Paschke dachte – er war im Grunde seines Herzens ein ganz guter Mensch und, lieber Gott, einer, der sich gern hatte selbständig machen wollen – sie hatte doch Sorge: er war sicherlich etwas leicht. Beweise hatte man zwar nicht; so sehr Johann und Gottfried nachstöberten, auch den Jakob in Berlin auf die Spur hetzten, sie hörten überall nur das gleiche: „Ein netter Kerl!“ –
Hanne Badekow betete nicht viel, aber als sie nun heute in der alten Dorfkirche, in der sie selber vorm Altar gestanden hatte und in der schon zwei ihrer Töchter getraut worden waren, die dritte Tochter stehen sah im Myrtenkranz, fing sie an zu beten in einem unbestimmten Herzensdrang.
Sie hob den Blick: da hing rechts vom Altar der Gedächtnisschrein mit dem Lorbeerzweig, der das Kreuz umschlingt:
Den Heldentod für König und Vaterland starb
Wilhelm Karl Badekow,
geboren am 14. Mai 1850,
gefallen bei Mars-la-Tour am 18. August 1870.
Ach ja, der Wilhelm! Und es war ihr, als spräche eine Stimme in ihr: um die Kinder, die gestorben sind, trägt man nicht den meisten Kummer – wie hatte die Auguste ihr das nur antun können und zu dem fremden Menschen hinlaufen?! Wenn das jemand wüßte?!
Förmlich verängstigt ließ die Badekow ihre Blicke umhergehen. Die Kirche war gedrängt voll, alle Frauen und Mädchen von Tempelhof wollten Badekows Guste im Brautstaat sehen. Die Mutter sah viel Neugier, aber – Gott sei Dank! – Schadenfreude sah sie nicht.
Jetzt steckte der Geistliche ihnen die Ringe an – Gott sei Dank, jetzt war die Auguste Frau!
Ganz befriedigt faltete Mutter Badekow ihre derben Hände über der Rundlichkeit ihres starren, brokatseidenen Kleides. Veilchenblau war das, mit eingewirkten gleichfarbigen Blumen. Die Kinder hatten es nicht anders getan, heute durfte die Mutter nicht mehr in schwarz gehen. Und an der Haube hatte sie eine Goldspitze.
Es war eine stattliche Hochzeitsgesellschaft. Die Millionenwitwe, nach der die meisten Hälse sich reckten, trug ein Kleid, so kornblumenblau, so leuchtend von Farbe, daß es die Augen fast blendete. Es war an der Taille und an den Ärmeln mit Rosa passepoiliert. Über dem Rock, den acht spitzenbesetzte Volants garnierten, bauschte sich hinten mächtig der Überwurf; im Ausschnitt en coeur zwischen weißen Spitzen hing an dickgoldener Kette ein goldenes Medaillon, wohl ein viertel Pfund schwer.
Lene Lietzow war auch nicht wenig fein in Smaragdgrün, und Johanns Frau, die rotwangige Grete, trug ein Rubinrot, das die lebhaften Farben ihrer Wangen noch erhöhte.
Alle in Seide. Auch die Braut; schwer und lang hing ihre Schleppe über die ausgetretenen Steinstufen des Altars. Auguste stand der Brautstaat nicht vorteilhaft, das Milchweiß des starren Kleides machte sie grau. Zudem hatte die Schneiderin aus Berlin, die alles konnte, sie unkleidsam frisiert; sie sah alt aus, wie eine Haube war ihr der Brautschleier über den Kopf gezogen.
Paschke in Frack und weißer Krawatte machte sich dagegen sehr gut. Das Murmeln der Bewunderung galt ihm: wie ein Leutnant in Zivil! Was die Auguste für einen Dusel hatte! Sie schien aber auch ihr Glück zu schätzen. Sonst weinen doch immer die Bräute, schon anstandshalber, die aber strahlte übers ganze Gesicht.
Und hinter ihr als erste Brautjungfer strahlte Mieke. Nun trug sie das rosa Kleid, das sie sich gewünscht hatte, sogar rosa Seide. Es war hinten mächtig gebauscht.
Da hätte sich ihr ja einer drauf setzen können! Die jungen Burschen, die von der Empore herunter zuschauten, hatten ihren Spaß.
Als ob Mieke es fühlte, daß sie beobachtet wurde, hob sie die Augen. Sie zeigte die breiten Zähne: ja, sie war mächtig fein! Von dem, was der Prediger gesprochen hatte in einer langen und wohlgesetzten Rede, wie sie sich ziemt, wenn eine Tochter aus solchem Hause freit, hatte sie kein Wort verstanden. Was wußte sie davon, ob sich zwei Herzen finden, zwei Seelen sich vereinen?! Sie lachte die Männergesichter an, die auf sie herunterschauten, und freute sich ihres prächtigen Staates. Auf den aus dem Gesicht straff nach oben gekämmten Haaren trug sie einen künstlichen Rosenkranz.
Die einzige, der die Tränen kamen, war Marianne. Die Millionenwitwe fühlte etwas wie einen Stich durchs Herz. Da stand nun Auguste, die blasse, unscheinbare Schwester – jung war sie auch nicht mehr – und bekam nun doch einen Mann, wie sie ihn haben wollte. Warum gerade die?! Leise schluchzte Marianne auf: gewiß, sie gönnte der Guste alles Glück, aber, aber – es würgte sie etwas in der Kehle, sie konnte es nicht glatt herunterschlucken.
Die Trauung war vorbei, die Orgel spielte das Nachspiel. Draußen schien nach regenschweren Novembertagen heute zum ersten Mal blanke, fast lachende Sonne. Die Zuschauer konnten im Trockenen stehen und mit Muße gaffen. Zuerst kamen die Kinder heraus. Aha, das waren die zwei von Gottfried Lietzow, der sommersprossige Fritz und die kleine Johanna! Ungezogen, wie immer, griff der Junge in das Blumenkörbchen, das sie zwischen sich trugen und schmiß rechts und links eine Handvoll hin. Dann kamen Badekows Zwillinge: reizende Kerlchen, einander zum Verwechseln ähnlich, mit flachsblonden Härchen und frischroten Bäckchen. Dann noch ein paar kleine Schellnacks aus Gretes Verwandtschaft, Kinder, die aussahen, wie immer Kinder aussehen: in neuen Kleidern, die Jungen in Samtkitteln und pomadisiert, die Mädchen mit gewellten Haaren. Sie streuten alle Blumen. Und dann kam das Brautpaar. Hinter ihnen immer ein Herr und eine Dame. Feierlich schritten die Paare von der Kirchenpforte bis hin zum Ausgangsgatter.
Rechts Gräber, links Gräber. Hier vor der Kirche lagen sie, die Schellnacks, die Lietzows, die Lüdeckes, die Längnicks, die Badekows – alle die alten Geschlechter. Die langhängenden Schleppen der seidenen Staatskleider fegten Kiessteinchen und Sand gegen die efeuumsponnenen Hügel.
Das Wetter war gut, der Weg ins Hochzeitshaus war nicht weit. Man hätte ihn zu Fuß gehen können, aber sie stiegen alle an der Straße in die vorgefahrenen Kutschen. Beim Einsteigen half der junge Ehemann seiner Frau, sie konnte mit ihrer Schleppe nicht zurechtkommen. Er sah nicht hin nach Ida Lietzow, die unter den Zuschauern ganz vorne am Kirchhofsgatter stand und ihn mit ihren begehrlichen Augen starr anblickte. Sie war auch drinnen in der Kirche gewesen. Zur Hochzeit geladen war sie nicht – was gingen sie auch die Auguste und ihre Sippe an?! –, aber ansehen hatte sie sich die Geschichte doch mal wollen. Sie kritisierte die Braut scharf. Wenn Blicke hätten Kleider durchbrennen können, so hätten es Idas Blicke getan. Über lauter Knochen war ja die schwere Seide gezogen – na, ein großes Vergnügen würde der Bräutigam da nicht finden! Wie konnte man nur heiraten bloß wegen des Geldes? Er hatte sich verkauft! Ein herbes Lächeln zog den Mund Idas herab. Das hätte sie doch wirklich von dem Paschke nicht gedacht. Ja, er mußte es wohl gefühlt haben, daß er einer Entschuldigung bedurfte. Neulich war er dagewesen zwischen Hell und Dunkel, als sie allein im Laden war. Sie hatte ihn nicht wiedergesehen gehabt seit dem Abend des Einzugs – seitdem waren so viel Monate vergangen – ein Wunder, daß er sie überhaupt noch kannte!
Herausfordernd hatte sie die Arme über der wogenden Brust gekreuzt und sich mit dem Rücken gegen das Ladenregal gelehnt. Was wollte er denn eigentlich hier?! Zigarren brauchte ihr Mann nicht; hier wurden nur welche verkauft, zwei Stück für’n Sechser. Das war doch jetzt nichts mehr für den Herrn Paschke!
Wie bitter sie sprach! Und doch atmete ihr ganzes Wesen Verlangen. Durch den halbdunklen Raum lockten ihre Augen wie Flammen. Ihre Abweisung reizte den Mann. Sie war ihm ja gar nicht böse, sie war nur verletzt, daß er sich nicht mehr um sie gekümmert hatte. Diese üppige Frau, für die der winzige Laden zu eng schien, war wirklich pikant! Er lehnte sich über den Ladentisch, auf dem Petroleum vergossen war und Heringslake, und sah sie vorwurfsvoll an: warum hatte sie denn auch gar nichts von sich hören lassen? Seine Adresse wußte sie doch. Nicht einmal zur Verlobung hatte sie ihm gratuliert – er seufzte dabei – und sie hatte doch gewiß davon gehört? In Tempelhof hörte man ja alles. Sie hätte ihm doch wenigstens ein einziges Mal ein Zeichen der Freundschaft geben können!
„Ich?!“ fuhr sie auf. Ihre Augen blitzten: „Ich Ihnen ein Zeichen geben? Na, da wäre ich wohl schön dumm! Ich bin ’ne anständige Frau – was fällt Ihnen ein?!“
Lächelnd hatte er nach ihrer Hand gegriffen – sie ließ sie ihm – da war an der kleinen Glastür mit den rotgepunkteten Gardinchen, die nebenan in die Wohnstube führte, behutsam geklinkt worden. Man hörte ein Kratzen, ein Winseln, nur spaltbreit schob sich die Tür auf. Ein kleines Mädchen hatte den dunklen, glatthaarigen Kopf hereingesteckt; zwei schwarze Augen, scheu und hurtig wie die einer neugierigen Maus, huschten über den Fremden hin.
„Was willst du?“ rief die Frau streng.
Das Kind antwortete nicht. Es zog sich zurück, aber zögernd, als wollte es gerne noch mehr sehen.
„So geh doch!“ schrie die Frau. Da verschwand der dunkle, glatthaarige Kopf. Aber der Spalt blieb offen. Ida zog die Tür unsanft zu.
„War das Ihr Töchterchen?“ fragte Paschke. „Ein hübsches Kind!“ Er fand das zwar nicht, aber er wollte der Mutter etwas Angenehmes sagen.
„ Meins ?! “ Ida lachte schrill. „I wo. Ich kann doch nich schon so’n großes Mädel haben. Sie is von der ersten Frau!“ Ein zorniger Ausdruck entstellte ihr hübsches Gesicht. „Was sie nu wieder hier herumzuspionieren hat!“
„Ja, sie sieht schlau aus“, beeiferte sich Paschke zu versichern.
Die Frau sagte nichts darauf, sie stand und nagte an ihrer Unterlippe. Ihre Laune war noch schlechter geworden. Zudem war aus der Schenkstube, die dem Laden gegenüber auf der anderen Seite des dunklen Flurs lag, der Mann gekommen. Er sah rot und gedunsen aus. Den Besuch kaum beachtend, fragte er aufgeregt nach dem Kellerschlüssel: wo ließ sie den nun wieder herumfahren?!
Sie zuckte die Achseln. Einer anderen Antwort würdigte sie den Fragenden nicht. Da empfahl sich Paschke: er würde ein andermal wieder vorsprechen, wenn er gelegener käme. Hinter dem Rücken Karl Lietzows wechselten sie noch einen raschen Blick; Paschke nahm die Erinnerung mit an ein bedeutungsvolles Zuwinken ihrer Augen.
Draußen in dem Vorgärtchen, in dem jetzt ein entblätterter Fliederbusch stand und ein einziger kahler Baum, stand die Kleine. Sie schien da auf ihn gewartet zu haben. Und wie auf der Lauer stand rechts von ihr ein krummbeiniger, schwarzer Teckel, und links einer. Sie sah Paschke stumm und groß an; ihr Blick genierte ihn. Er hatte das unbewußte Gefühl, sich freundlich mit ihr stellen zu müssen, obgleich ihn die Teckel anknurrten.
„Wie heißt du?“ fragte er.
„Hulda!“
„Na, Huldchen, und wie alt bist du denn?“
Er tätschelte ihre Wange.
Sie ließ sich ruhig tätscheln, aber kein Lächeln erhellte ihr Gesichtchen, es blieb sehr ernsthaft. „Neun Jahre“, sagte sie mit ihrem feinen Stimmchen.
Auch das klang wie das Piepen einer Maus; das Kind war entschieden nicht angenehm, fast unheimlich mit seinem alten Gesicht. Paschke machte, daß er fortkam, die Teckel fuhren ihm an die Hosen. – – –
Und dann hatte er und Ida Lietzow sich nicht wiedergesehen bis zum heutigen Tage. Er hatte sie wohl bemerkt, als er seiner Angetrauten draußen vorm Kirchhofsgatter in den Wagen half. Und auch das heiße Brennen ihrer Augen gespürt. Donnerwetter ja, wenn er die heute abend in seinen Armen halten könnte, das wäre etwas anderes als die Auguste Badekow!
Mit einem leisen Seufzer fügte Julius Paschke sich in sein Schicksal.
*
Zwei Tage nach Auguste Badekow heiratete Paul Längnick. Zwei bedeutsame Hochzeiten in so kurzer Zeit, das war ein Ereignis für Tempelhof. Die erste Hochzeit war die größere; die Längnicks hatten nicht so viel Verwandtschaft, aber bei dieser zweiten Hochzeit war die Braut schöner.
In der dunklen, niedrigen Wohnstube von Rieke Längnick wurde die Braut geschmückt. Da sollte die junge Frau nun auch wohnen, bis die Villa fertig war, die Paul ihr bauen wollte, auf dem Hofgrundstück dicht nebenan. Im Sommer vielleicht schon konnte das neue Heim fertig sein, bis dahin mußte sie sich gedulden im alten Längnickschen Haus. Die Mutter hatte es ihnen eingeräumt, sie selber zog sich zurück in das Hofgebäude, wo unten die Waschküche war und allerlei Vorratskammern. Der jungen Braut, die keine Mutter hatte, keine Schwester und keine Freundin, setzte Rieke Längnick den Brautkranz auf. Wie es hergebracht war, sollte die Schneiderin, die für ganz Tempelhof arbeitete, die Braut frisieren, aber Ethel war förmlich davor zurückgeschaudert. Sie wußte es, die Zeit war vorüber, in der sie ihr schönes Haar offen tragen durfte – wie eine goldige Mähne hing es ihr um die Schultern – aber sie wollte sich nun selber die Zöpfe flechten, sie zur glatten Krone aufstecken. Die Krone war so schwer! Sie senkte den Kopf. Und nun kam noch der Kranz oben darauf. Er war nicht von frischem Grün, in Tempelhof hob man die Brautkränze auf hinter Glas und Rahmen über dem Sofa der guten Stube. Künstliches Grün, künstliche Blüten und schwere, dicke Knospen aus überwachstem Stoff drückte die Längnick fest auf den gesenkten Kopf. Sie hatte keine leichte Hand. Aber hübsch sah die Braut aus, das sah heute selbst Rieke.
Gestern war es endlich perfekt geworden: die englische Terraingesellschaft hatte ihre anliegenden Äcker noch zugekauft. Die neunzigtausend Taler, die sie gefordert hatte, hatte sie bekommen. Das war ein Geschäft! Die ganze Nacht hatte sie im Fieber gelegen; vor ihren Augen rollten die Talerstücke, in ihren Ohren rauschten die Papierscheine. So glänzend hatte noch keiner in Tempelhof Land verkauft – und würde auch keiner je mehr verkaufen! Dafür mußte sie sich denn auch schon die Schwiegertochter gefallen lassen. Die war ja auch ein ganz gutes, sanftes Ding, die zudem von gar nichts etwas verstand. Sie, Rieke Längnick, würde nach wie vor diejenige bleiben, die befahl, wenn sie von nun ab auch hinten wohnte und die Junge nach vorn heraus.
Mitleidige Geringschätzung war in dem Lächeln, mit dem die Schwiegermutter auf die Tochter heruntersah: um der Äcker willen wollte sie der denn auch verzeihen, daß sie gar keine, aber auch gar keine Aussteuer hatte.
Mister Brown war sehr verwundert gewesen, als Rieke gefragt hatte: „Nanu, was jeben Sie denn mit?“ Es war in England Sitte, daß der Bräutigam für alles Sorge trug. Na, das mochte am Ende ja sein, aber daß der Paul auch das Leinenzeug anschaffen mußte, Bettwäsche, Hemden und Hosen für seine Braut, das war doch stark. Wenn der Schmuck nicht gewesen wäre, die Brillantknöpfe, die Ethel Brown in den Ohren trug, ihre goldene Kette, ihr Perlenhalsband und die vielen Armringe, man hätte wirklich denken können, ihr Vater hätte gar nichts.
Rieke Längnick verschloß ihre Enttäuschung in sich. Nur nichts davon sagen, sie würden ja alle schadenfroh sein! Das Gefühl, von vielen im Dorfe mit unfreundlichen Augen angesehen zu werden, gab ihr stets die Kraft, den Kopf hoch zu tragen. So war sie damals auch hinter dem Sarge ihres Mannes hergegangen, den kleinen Paul an der Hand. Der Junge hatte geweint aus Angst vor dem schwarzen Wagen, aus Angst vor den schwarzen Männern, die den Vater aus dem Hause holten; die Witwe hatte die kalte, zitternde Kinderhand fest mit der ihren gepreßt, das war das einzige Zeichen von Erregung gewesen. Der selige Längnick hatte getrunken, er war zum Futterboden hinaufgekrochen, um droben seinen Rausch auszuschlafen, da war er heruntergefallen, das Genick hatte er sich gebrochen; aber das hatte sie niemandem gesagt. Der arme Längnick, ein Schlaganfall hatte ihn getroffen auf der Leiter, gerade als er Heu herunterholen wollte fürs Vieh! Er war ja immer so fleißig gewesen! Der Längnick Augen zwinkerten auch heute nicht. Sie beobachtete ganz genau jeden einzelnen in der Kirche, und keines der gaffenden Gesichter entging ihr. Nun freute sie sich doch: sie sah, die Braut wurde sehr bewundert. Ihr scharfes Ohr fing jedes entzückte „Ah!“ auf. Ja, das war nun ihre Schwiegertochter, die Frau von ihrem Paul! – – –
Das Hochzeitsmahl fand nicht wie bei den Badekows im eigenen Hause statt; es war da Paul nicht hübsch genug. Mister Brown hatte Hiller Unter den Linden in Berlin vorgeschlagen, aber dagegen wehrte sich Rieke energisch, und auch der Bräutigam wollte nicht außerhalb von Tempelhof feiern. Man einigte sich auf Kiekebusch. Dort war ein Saal, und der war nun hergerichtet worden von einem Dekorateur. Man hatte die angeräucherten Wände mit rotem Stoff drapiert, Girlanden gewunden und an der Decke bunte Lampions aufgehängt. Die Tafel war mit künstlichen Blumensträußen geziert, und es gab viel zu essen und zu trinken.
Aber es war doch ein etwas einsames Fest. In dem großen Saal verloren sich die Teilnehmer. Die Längnickschen Verwandten aus Britz und Mariendorf waren gekommen; auch wie bei Badekows die Schellnacks, die Lüdeckes und die Hahnemanns. Von der Badekowschen Sippe aber war nur Gottfried Lietzow geladen. „Er ist immer so lustig!“ sagte Paul. Nicht, daß sich Hanne und Rieke böse gewesen wären – man schickte vom Hochzeitskuchen hinüber und herüber – aber man empfand es doch wie eine Erleichterung, daß man dadurch, daß die beiden Hochzeiten so nahe zusammenlagen, von vornherein sagen konnte: „Ich lade dich nicht ein, weil du ja selber Hochzeit gibst.“
Lene Lietzow hatte auch nicht zusagen wollen, aber Gottfried stimmte dafür, hinzugehen: „Weißte, ick denke mir, dem Paule ist mies vor seine eigene Verwandtschaft; wir wollen man zusagen!“ So trug denn Lene ihr Smaragdgrünes auch bei dieser Hochzeit. Sie hatte noch ein ekliges Kopfweh von der vorgestrigen her, und nun ging die Trinkerei schon wieder los. Aber das war man in Tempelhof gewöhnt, das wäre ja auch gar keine richtige Hochzeit gewesen, die man nicht noch ein paar Tage gespürt hätte.
Die Längnicks, langsam und steif, waren nicht Leute von vielen Worten, aber von vielen Gläsern. Gottfried sagte heimlich zu seiner Frau: „Leneken, halte mir man bei’m Nachhausejehen. Ick habe schonst jetzt mehr wie jenug!“
Und das Fest war noch lange nicht an seinem Ende. Die Längnick wachte mit strengen Augen darüber, daß zu jedem Gang ein anderer Wein geschenkt wurde; zum Schluß gab’s Likör, dann Bowle und Bier.
Der Brautvater war sehr vergnügt, mit Lietzow hatte er sich angefreundet; je betrunkener er wurde, desto vertraulicher wurde er. Die beiden saßen zusammen in einer Ecke, Arm in Arm, dicht Wange an Wange.
„Sehen Se, wissen Se – du mußt nämlich wissen, mein Sohn“ – der Engländer sprach auf einmal Berlinisch –, „ick bin ja man bloß Sekretär bei Mister Henry Daniel Davis. Der is der Macher von’s Janze. Aber der kann nich jut Deutsch, darum bin ick hier. Merkste was?!“ Das Lachen und der Schlucken stießen ihn. „Ick bin ja vom Spittelmarcht. Ick war auch schon früher mal hier“ – er zwinkerte mit den Augen –, „ja, hier auf ’m Feld bin ich geritten – neunzig Pfund schwer. Rot mit Blau und Weiß – englischer Jockei, hahahaha! Ja, ich habe Karriere gemacht. Nu bin ich fein raus mit dem reichen Schwiegersohn, was?!“
Mit schwankenden Schritten ging Mister Brown zu dem Bräutigam. Er ließ sein Glas an dessen Glas klingen: „Es lebe Tempelhof! Nanu, Pauleken, was sagste nu zu dem Schwiegerpappappa?“
Paul sagte nichts. Der Schwiegervater kam ihm heute wohl etwas merkwürdig vor, aber er hatte nicht weiter darauf acht. Während des ganzen, stundenlang währenden Hochzeitsmahles hielt seine Rechte die Hand Ethels fest; er aß mit der Linken. Das war nun seine Frau, seine Frau, die er liebte, wie er noch niemals geliebt hatte! Als Knabe hatte er ein schneeweißes Kaninchen gehabt, als Dragoner sein Pferd – was war das, was er für diese beiden gefühlt hatte, gegen das, was er jetzt fühlte?! Immer wieder faßte seine Linke nach dem Glas, er leerte es immer wieder in seligem Rausch.
„Paul, Paul“, flüsterte die Braut leise, „ach ich bitte dich, trinke nicht so viel. Es macht mir sehr Angst!“
Er drückte ihre Hand, daß er sie fast zerquetschte, und sah sie dabei an mit Augen, die vor Zärtlichkeit schwammen. „Wenn du nicht willst, daß ich trinke, trinke ich nich. Da!“ Er warf sein Glas hin und lachte laut.
Alle sahen nach ihm: das war mal ein verliebter Bräutigam! Er fraß sie ja mit den Augen auf. Er konnte es kaum abwarten. Schon schmiß er das Glas hin vor Ungeduld! Es kamen die üblichen Scherze. Man war nicht sehr zartfühlend in Tempelhof.
Ethel wurde blaß und rot und wieder blaß; nicht alles verstand sie, aber daß sie nun diejenige war, der diese Blicke galten – Blicke, die sich weideten an ihrer Verlegenheit –, diese Scherze, über die die Frauen kicherten, die Männer laut herauslachten mit dröhnendem „Hoho“, das fühlte sie. Wie um Hilfe bittend, hingen ihre Augen sich an die Schwiegermutter.
Aber die alte Frau verstand die Blicke der jungen Frau nicht. Sie lachte zwar nicht mit – für solche Scherze hatte Rieke Längnick nie Ohren gehabt –, aber gleichgültig sah sie an der Schwiegertochter vorbei: hinten im Saal stand der Engländer und schwatzte laut mit Gottfried Lietzow.
Durch den ganzen Saal tutete Mister Browns durchdringende Stimme: „Neunzigtausend Taler – neunzigtausend Taler!“
Rieke horchte auf, ihr scharfes Gesicht wurde wie das eines Habichts. Waren das ihre neunzigtausend Taler, von denen da die Rede war? Was der Lietzow wohl dazu für ein Gesicht machte, daß sie neunzigtausend Taler für die Äcker bekommen hatte?! Sie stand auf: das mußte sie sich doch mit ansehen! Raschen Schrittes ging sie auf die beiden los.
Mister Brown hatte eben mit einem ganz verschmitzten Lachen gesagt: „Ei weh, wenn die alles wüßte! Wenn se wüßte, daß –“ rasch schlug er sich auf den Mund, als er sie vor sich sah: „St!“ So betrunken war er doch noch nicht. „Well“, sagte er bloß noch und zwinkerte Gottfried vergnügt zu.
„Wat sagten Sie eben?“ fuhr sie ihn an. Sie hatte es gemerkt, da sollte ihr etwas verheimlicht werden.
„Ich?!“ Mister Brown nahm sich zusammen, ihr scharfer Ton ernüchterte ihn plötzlich. Er spielte den Harmlosen. „Ich habe gar nichts gesagt!“ Und als sie beharrte: „Ick habe et ja eben deutlich jehört: neunzigtausend Taler, neunzigtausend Taler! Un warum haben Se denn jesagt: ei weh, wenn die alles wüßte?!“ – wurde er auf einmal wieder betrunken. Er faßte sie um die Taille und drehte sie herum, ihr Widerstreben bändigend mit, so nerviger Faust, daß sie nicht anders konnte, sie mußte mit ihm durch den Saal tanzen.
Und er sang dazu mit krähender Stimme:
„Denkste denn, denkste denn,
Tempelhofer Flanze,
Denkste denn, ick liebe dir,
Weil ick mit dir danze?“
Das war das Signal. Nun war die Hochzeit wie alle Hochzeiten. Die Längnicks hatten sich warm getrunken, nun konnten sie auch reden. Das war ein Geschnatter, ein Gelächter, ein Gegröhle; der vordem zu große Saal in seiner leeren Weite schien jetzt zu eng. Es war, als hätte sich jeder verdoppelt und schrie für zwei.
Da war es die Braut, die zum Bräutigam ganz leise sagte: „Komm!“ Ethels zitternde Hand schmiegte sich in die Pauls.
Er kam nicht gleich in die Höhe. Er hatte es ja nicht ändern können, denen, die ihm zutranken, hatte er doch wieder zutrinken müssen, wenn auch in ganz kleinen Schlucken. Aber er wollte ja so gerne tun, wie sie wollte – immer wie sie, immer, immer! Mühsam strebte er auf. Da war es ihre zitternde Hand, die ihn stützte und ihn aus dem Saale führte.
Sie kamen heraus, unbemerkt. Und dann gingen sie draußen Hand in Hand unter den entblätterten Linden ihrem künftigen Leben zu.