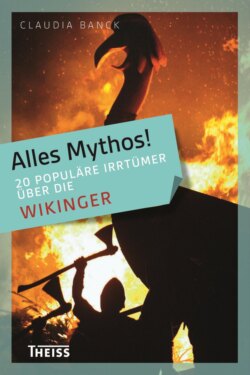Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Wikinger - Claudia Banck - Страница 10
IRRTUM 4: Die Wikinger taten sich nur durch Kämpfen und Beutemachen hervor
ОглавлениеAlfred der Große von Wessex hatte sein Leben lang gegen plündernde und brandschatzende Wikinger zu kämpfen. Doch trotz des Unglücks, das sie über ihn und sein Land brachten, unterschied er zwischen Räubern und Händlern. Zu Händlern, die an seinen Hof kamen, hielt der vielseitig interessierte König freundschaftlichen Kontakt.
Auf seine Veranlassung wurde die im 5. Jahrhundert von dem Spanier Orosius verfasste Weltgeschichte übersetzt und um zwei kurze Reisebeschreibungen aus Nordeuropa erweitert: In der einen berichtet der angelsächsische Kaufmann Wulfstan über seine Fahrt von Hedeby (Haithabu) nach Truso (im heutigen Polen). In der anderen erzählt Ottar (Othere) von Hålogaland von seinen Reise- und Handelsaktivitäten im hohen Norden sowie einer Fahrt ins dänische Haithabu.
Ottar kam um 890 an den Hof König Alfreds des Großen und stellte sich ihm als reicher Mann vor, der am nördlichsten von allen Nordmännern an der Küste des Atlantiks wohne (vermutlich im südlichen Bereich von Troms). Er besaß 20 Kühe, 20 Schafe und 20 Schweine, außerdem gehörte ihm eine Her de von 600 Rentieren mit sechs zahmen Locktieren, die besonders wertvoll waren, da man sie zum Einfangen von wilden Rentieren brauchte. Seine wichtigste Einnahmequelle aber war die sogenannte „Finnsteuer“, die das Volk der Samen an ihn wie auch an andere Land besitzende nordnorwegische Häuptlinge entrichten musste. Die Samen bezahlten den Tribut „wie es ihrem Rang entsprach“, mit Pelzen, Häuten und Daunen – im Ausland hoch begehrte und gut bezahlte Waren.
Das Land erstrecke sich noch weiter gen Norden. 15 Tage lang, so erzählte Ottar, sei er der Küste bis nach Bjarmeland am Weißen Meer gefolgt, wo große Walrossherden lebten. Die dicke Walrosshaut eignete sich gut als Material für Schiffstaue. Wie bedeutend die Walrosszähne als Handelsware und Zahlungsmittel waren, zeigen die zahlrei chen, in ganz Europa gemachten Funde von Perlen aus Walrosselfenbein. Ottar beschrieb dem König auch eine Handelsreise entlang der norwegischen Küste zu dem Handelsort Skiringssal in Südnorwegen. Für diese Reise brauchte man mit gutem Wind und ohne Nachtfahrten länger als einen Monat. Von dort segelte man innerhalb von fünf Tagen nach Hedeby. Wie wichtig diese Handelsroute entlang der norwegischen Küste war, geht aus dem Namen „Norwegen“ – der „Nordweg“ – hervor.
Ottar betrieb Handel, mit Raubfahrten hatte er nichts zu tun. Die von ihm geschilderten Naturreichtümer bildeten die Grundlage für einen florierenden Handel und die Ausbildung einer einflussreichen Oberschicht, die ihren Reichtum nicht Raub und Krieg im Westen, sondern wirtschaftlich-landwirtschaftlichen Erfolgen verdankte. Archäologische Ausgrabungen auf den Lofoten bestätigten das Bild der historischen Quellen. In Borg auf der Lofotinsel Vestvågøy entdeckte man 1981 ein sogenanntes „Reichtumszentrum“. Die Siedlung, die in der Wikingerzeit mindestens 115 Höfe umfasste, bestand vom 2. Jahrhundert bis ins 15. Jahrhundert. Das Haupthaus war 83 Meter lang, Scherben feiner vom Kontinent oder England importierter Trinkgläser und (Wein-) Kannen zeugen von internationalen Handelskontakten und großem Wohlstand.
Schon viele Jahrhunderte vor Beginn der Wikingerzeit unterhielten die Skandinavier Handelsbeziehungen bis in die fernsten Länder der damals bekannten Welt. Von herausragender Bedeutung war Helgö, eine Insel im schwedischen Mälarsee mit direktem Zugang zur Ostsee. Wie weitreichend die Kontakte und Fernbeziehungen dieses vom 3. bis zum 9. Jahrhundert existierenden Handels- und Handwerkerzentrums waren, wurde klar, als man im Juli 1956 bei Ausgrabungen auf die kleine (nur 8,4 Zentimeter große), mit hoher Wahrscheinlichkeit in Nordindien/Pakistan hergestellte Bronzefigur eines Buddhas stieß, die im ausgehenden 8. oder im 9. Jahrhundert nach Skandinavien gelangt war. Die wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte zwischen Skandinavien und Asien blieben erhalten, auch nachdem Helgö im 8. Jahrhundert seine Bedeutung verloren hatte und von dem ebenfalls im Mälarsee gelegenen Birka abgelöst worden war.
Zu dieser Zeit entwickelten sich in Skandinavien weitere bedeutende Handelszentren an Knotenpunkten von Verkehrsadern, die sich sowohl von See aus wie auch über Land gut erreichen ließen. Der regelmäßige Grundriss mit schnurgeraden Straßen spricht für die planmäßige Anlage der meisten Handelsplätze. Sie dienten als Umschlagplatz für Pelze, Daunen, Wachs, Honig, Walrosszähne und Sklaven, den begehrtesten Exportgütern aus dem Norden. Die Skandinavier selber waren vor allem an der Einfuhr von Luxuswaren interessiert. Dazu zählten Brokate aus Byzanz, feine Wollstoffe aus Friesland, Weißwein aus dem Rheingebiet, feines fränkisches Glas sowie Edelmetalle. Textilfunde aus persischen Seidenstoffen, die sich im Schiffsgrab von Oseberg (um 834) fanden, sprechen für regelmäßige Handelskontakte bis in den Orient. Neueren Untersuchungen zufolge könnten Seidentextilien aus dem Schiffsgrab in Gokstad (spätes 9. Jahrhundert) aus dem fernen China stammen.
Die Reichen und Mächtigen begehrten Gold, das der äußeren Prachtentfaltung diente. Leichter zugänglich war allerdings Silber. Im 9. und 10. Jahrhundert gelangten riesige Mengen Silber aus den Silberminen Zentralasiens nach Skandinavien. Meist kam das Silber in Form von Münzen, aber auch als Brosche, Armring, Schale oder Kruzifix in den Norden. Der Wertmaßstab war das Gewicht. Wenn ein Wikinger Wechselgeld brauchte, zerhackte er kurzerhand Münzen oder Schmuckstücke. Hatte man genug sogenanntes „Hacksilber“ gesammelt, konnte man es zu Barren einschmelzen, die ein einheitliches Gewicht hatten. Zum Wiegen der Edelmetalle benutzte man eine kleine Klappwaage mit einem zusammenfaltbaren Balkenarm und zwei Waagschalen aus Bronze. So eine Waage ließ sich in einem Lederbeutel oder einer Bronzedose verstauen und leicht auf Reisen mitnehmen. Waagen gehören zum typischen Fundort der wikingerzeitlichen Handelsplätze. Im Hafen von Haithabu hat man mehrere Exemplare gefunden. Funde von Waaghalbfabrikaten des 10. Jahrhunderts belegen, dass diese auch vor Ort gefertigt wurden.
Haithabu gehörte zu den bedeutendsten Handelsplätzen der Wikingerzeit. Bereits zu Beginn des 8. Jahrhunderts hatten sich zunächst friesische Kaufleute am Haddebyer Noor, einer Bucht am Südufer der Schlei niedergelassen, um Handel zu treiben. Die Lage war ideal für den Schiffsverkehr wie auch für den Warentransport über Land: Der Handelsplatz lag geschützt im Landesinnern, war aber über die Schlei direkt mit der Ostsee verbunden. Von der Nordsee gelangte man auf den schiffbaren Flüssen Eider und Treene bis nach Hollingstedt, 16 Kilometer westlich von Haithabu. Für das Stück über Land mussten die Waren auf Fuhrwerke oder Packtiere umgeladen werden. Damit ersparte man sich den gefährlichen und zeitraubenden Weg um den Skagerak, die Nordspitze Jütlands.
Haithabu, das fast die gesamte Dauer seines Bestehens zum dänischen Reich gehörte, findet in arabischen Berichten Erwähnung ebenso wie in isländischen Sagas oder in dänischen, fränkischen und angelsächsischen Chroniken. In skandinavischen Quellen wird der Handelsplatz meist Hedeby/Heithabyr (Ort an der Heide) genannt. In fränkischen und sächsischen Quellen liest man Sliasthorp und später Sliaswich (Ort an der Schlei).
Zu seinem Schutz wurde der blühende Handelsplatz Mitte des 10. Jahrhunderts mit einem halbkreisförmigen, zum Haddebyer Noor hin offenen Wall umgeben, der ein Siedlungsareal von fast 25 Hektar umschloss. Im Schutze des Walls lebten im 10. Jahrhundert etwa 1000, möglicherweise auch mehr Menschen – in jedem Fall eine für nordische Verhältnisse sehr große Einwohnerzahl. „Die Stadt ist sehr groß und liegt am äußersten Ende des Weltmeeres“, berichtet der arabische Kaufmann und Diplomat At-Tartûschi (aus Tortosa in Spanien), als er in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts nach Haithabu reist. Die Bevölkerung war ein buntes Gemisch vielfältiger Kulturen: Friesen, Dänen, Schweden, Norweger, Sachsen, Franken und Slawen wohnten zeitweise in der Stadt und betrieben ihre Geschäfte. Auch Handwerker arbeiteten hier. Nachgewiesen werden konnten Schmiede, Bronzegießer, Schuster, Töpfer, Kammhersteller, Bernsteinschleifer, Glasperlenmacher und Schiffszimmerleute.
Den Befestigungsanlagen zum Trotz hielt Haithabu den feindlichen Angriffen nicht stand. 1050 ging das Wirtschaftszentrum nach der Eroberung durch den norwegischen König Harald den Harten in Flammen auf. Die Zerstörung durch slawische Truppen im Jahre 1066 leitete den endgültigen Untergang Haithabus ein. Haithabu wurde abgelöst – die am Nordufer der Schlei gelegene Nachfolgesiedlung ist die Keimzelle des heutigen Schleswig.
„… viele vermögende Händler, Überfluß an Waren aller Art und viel Gold und Schätze“ gab es auch im schwedischen Birka, das Bischof Rimbert in der um 876 verfassten „Vita Anskarii“ beschreibt. Der auf der Insel Björkö (Birkeninsel) im Mälarsee gelegene Handelsort gewann mit dem Niedergang Helgös ab Mitte des 8. Jahrhunderts an Bedeutung. Zu jener Zeit war der Mälarsee noch eine Bucht der Ostsee, der Wasserspiegel lag im Verhältnis zum Niveau des Landes etwa fünf Meter höher als heute. Dank der günstigen und zugleich geschützten Lage (rund 30 Kilometer westlich des heutigen Stockholm) nahm der Handel einen raschen Aufschwung: Über verschiedene Seen und Flüsse gelangte man mit dem Boot, zu Pferd und zu Fuß in die pelzreichen Jagdgründe im Norden. Richtung Süden segelte man über den Mälarsee in die Ostsee nach Gotland und Haithabu, von hier aus ging es weiter nach England und Friesland. Richtung Osten erreichte man den Finnischen Meerbusen und fuhr weiter bis zur Wolga.
Eng waren die Verbindungen nach Dorestad (über Haithabu). Rimbert berichtet von einer vermutlich durch den Handel ihres Mannes wohlhabenden Frau in Birka, die ihre Tochter Catla beim Herannahen des Todes bittet, sie möge ihren ganzen Besitz verkaufen und – da es in Birka nur wenige Bedürftige gäbe – mit dem Geld nach Dorestad fahren, um es dort an Kirchen, Geistliche und Arme zu verteilen.
Seinen Wohlstand verdankte Birka möglicherweise dem Eisenexport, vor allem aber dem Pelzhandel. Der Adel, die hohen Geistlichen und reichen Kaufleute Europas waren begierig nach nordischen Pelzen, mit denen sich Macht und Reichtum so prunkvoll zur Schau stellen ließen.
Ein Ringwall und eine Höhenburg schützten den auf einer Landzunge gelegenen Handelsplatz, der in seiner Blütezeit etwa 900 Einwohner zählte. Die Erdwälle, die die Festung (Borg) umgaben, sind noch heute auf der felsigen Anhöhe über der heute verschwundenen Siedlung zu erkennen. Die Befestigung der Handelsplätze war notwendig, denn dort, wo Handelswaren und Reichtümer gehortet wurden, drohten Überfälle von Räubern. Zeuge eines solchen Überfalles wurde Ansgar, der 829 als Missionar nach Birka kam. Als dänische Wikinger mit 21 Schiffen vor der Stadt auftauchten, flohen die ansässigen Händler und Einwohner „voller Entsetzen in die benachbarte Burg“, deren Reste heute noch zu sehen sind.
Jenseits des Siedlungsplatzes erstreckten sich mehrere große Gräberfelder. Einige der Grabstätten waren mit reichen Beigaben ausgestattet, darunter Seide- und Brokatstoffe aus Byzanz und China, gläserne Spielsteine und Kelchgläser aus dem Frankenreich oder feine, blaue Wollstoffe aus Friesland. Über das Gräberfeld verstreut fand man Münzen aus arabischen Ländern. Der Silberstrom versiegte jedoch zu Beginn des 11. Jahrhunderts. In dieser Zeit verlor Birka an Bedeutung. Der Grund hierfür wird auch in der Verlandung der Schifffahrtswege zu suchen sein. Infolge der Anhebung des Landniveaus war der südliche Verbindungsweg zum Meer seit Ende des 10. Jahrhunderts nicht mehr befahrbar. Sigtuna, das ebenfalls am Mälarsee liegt, trat die Nachfolge Birkas an, erlangte aber nie dessen Bedeutung als Handelsplatz.
Die herausragende Stellung im Ostseehandel übernahm die vor Schwedens Ostküste gelegene Insel Gotland. „Schatzkammer des Nordens“ wird die (nach Seeland) zweitgrößte Ostseeinsel auch genannt, mehr als 500 der rund 800 schwedischen Schatzfunde wurden hier registriert. Die archäologischen Funde belegen Handelsverbindungen von Britannien bis nach Bagdad.
Ein kleiner Wetzstein, der im Kirchspiel Roma auf Gotland gefunden wurde, trägt eine kurze Runeninschrift: „Ormiga, Ulfar: Griechenland, Jerusalem, Island, Serkland“ und bedeutet etwas ausführlicher ausgedrückt: Ormiga und Ulfar waren in Griechenland (das heißt im Byzantinischen Reich), in Jerusalem, auf Island und im Land der Sarazenen (vermutlich das Kalifat von Bagdad). Die Inschrift zeigt die enorme Bandbreite wikingerzeitlicher, in diesem Fall gotländischer Handelsaktivitäten.
Von Birka oder Gotland segelten die (schwedischen) Nordmänner, die in altslawischen, griechischen (byzantinischen) und arabischen Schriften „Rus“ oder „Waräger“ genannt werden, gen Osten – quer durch die Ostsee zum Finnischen Meerbusen. Wer sich die Wikinger bisher nur als stolze Segler auf dem offenen Meer vorgestellt hat, wird umdenken müssen. Die Wege gen Osten waren streckenweise extrem mühselig: Vom Finnischen Meerbusen ging es auf der Newa weiter zum Ladogasee. Über die großen russischen Flüsse Wolchow und Lowat gelangte man bis zu einer Stelle, an der man die Schiffe ans Ufer ziehen musste und zu Fuß von dort aus über mehrere, zum Teil kilometerlange Schleppstrecken entweder an die Quelle des Dnjeprs oder der Wolga gelangte. Über den 2200 Kilometer langen Verlauf des Dnjepr erreichten die Waräger das Schwarze Meer. Hier folgten die Schiffe immer der Küste bis nach Konstantinopel, der Metropole des Byzantinischen Reiches. Die Wolga führte auf einer Länge von 3800 Kilometern ins Kaspische Meer. Dort konnte man sich Kamelkarawanen anschließen, die nach Bagdad zogen, der Hauptstadt des Abbasidenkalifats, dessen geradezu märchenhafter Reichtum auf gewaltigen Silbervorkommen basierte. Spätestens seit dem 9. Jahrhundert waren skandinavische Kaufleute am Silberhandel beteiligt.
Von Kiew aus führte der Dnjepr auf direktem Weg zum Schwarzen Meer. In seinem zwischen 948 und 952 verfassten Werk „De administrando Imperio“ beschrieb der byzantinische Kaiser Konstantin Porphyrogennetos die überaus gefahrenvolle und mühsame Reise, zu der man zeitig im Frühjahr, wenn das Eis schmolz, aufbrach. Zeitraubend und gefährlich waren die zahlreichen Stromschnellen. Die vierte Stromschnelle Aeiphor hieß nach Porphyrogennetos so, weil „an den Steinen der Stromschnelle Pelikane hausen“. An anderer Stelle findet sich die Übersetzung „Immerlaut“, „der immer Heftige“ und „Nimmersatt“. Dieser berüchtigte Flussabschnitt wird auf einem gotländischen, in die Zeit um 1000 datierten Runenstein erwähnt. Die Inschrift lautet: „Hell bemalt stellten diesen Stein auf Hegbjœrn und seine Brüder Rodvisl, Austain [und] Emund, die Steine aufgestellt haben zur Erinnerung an Rafn südlich vor Rufstain. Sie kamen weit hinein in [den] Aifor.“ Die Brüder scheinen die gefährlichen Stromschnellen überwunden zu haben – bis auf Rafn, der offenbar auf dieser Fahrt den Tod fand, sei es in den Wildwassern des Dnjepr oder durch einen Angriff der dort ansässigen Petscheneggen. (Diese überfielen im 10. Jahrhundert Fürst Svyatoslav I. von Kiew und machten aus seinem Schädel einen Trinkkelch). Nach Überwindung aller Gefahren gelangten die „rusischen“ Kaufleute schließlich nach Berezany am Schwarzen Meer, das sie in Richtung Byzanz (Konstantinopel) überquerten. „So endet hier ihre mit viel Schmerz und Angst verbundene, schwierige und beschwerliche Fahrt“, schließt Konstantin Porphyrogennetos seinen Bericht. Noch im selben Herbst kehrten sie zurück, um im folgenden Frühjahr mit der Eisschmelze wieder aufzubrechen.
Auf dem „Austvegr“, den Wegen gen Osten, waren keine Äxte schwingenden Räuber oder große Armeen unterwegs, sondern überschaubare Gruppen von skandinavischen Männern, die froh waren, wenn sie selbst nicht überfallen wurden. Die Strapazen müssen sich gelohnt haben, sonst hätte man sich nicht den (Lebens-) Gefahren ausgesetzt. Sklaven gehörten im Osten wie im Westen zum Haupthandelsgut der Nordmänner. Die Handelsplätze Haithabu und Birka dienten als Drehscheibe eines groß angelegten Menschenhandels, der in schriftlichen Quellen Erwähnung findet und auch archäologisch nachgewiesen ist: An beiden Orten entdeckten Archäologen eiserne Handschellen.
Von den Teilnehmern einer Ende der 1030er Jahre von einem gewissen Ingvar angeführten Asien-Expedition kehrten nur einige wenige, möglicherweise auch keiner, nach Hause zurück. Rund zwei Dutzend Runensteine (vor allem im Gebiet des Mälarsees) belegen die Geschichtlichkeit dieses Unternehmens. Die Inschrift eines für Harald, den Bruder Ingvars (in Gripsholm, Södermanland) gesetzten Steines lautet:
„Sie fuhren mannhaft
fern nach Gold,
gaben im Osten
dem Adler (Speise);
sie starben südwärts in Serkland.“
Serkland ist mit Sarazenenland und Seidenland übersetzt worden. Der Begriff bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Land, sondern verweist wohl auf die Länder südlich des Kaspischen Meeres. „Dem Adler Speise geben“ bedeutet „Feinde töten“ und ist eine häufige Wendung in eddischer und skaldischer Dichtung. Daraus könnte man schließen, dass es sich bei Ingvars Expedition möglicherweise um eine Kriegsund weniger um eine Handelsfahrt handelte. Zu rauben gab es im Osten aber vor allem Sklaven, die wieder verkauft werden konnten.
Bei Veda in Uppland gibt es einen Stein für Arnmund, der „dieses Gut kaufte, und er machte sein Geld ostwärts in Rußland“, vermutlich war er dort als (Sklaven-) Händler unterwegs, zu Hause war er Bauer.