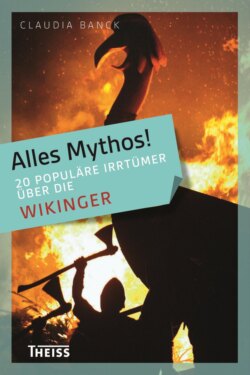Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Wikinger - Claudia Banck - Страница 6
Einleitung
ОглавлениеUnbesiegbar, bärenstark, todesmutig und tapfer – so stellt man sich die Wikinger vor, die gegen Ende des 8. Jahrhunderts aus dem Norden Europas aufbrachen, um wie „wilde Hornissen“ über die Britischen Inseln und das Frankenreich herzufallen. „A furore Normannorum libera nos, domine!“, beteten die Menschen an den Küsten, „Befreie uns, Herr, von der Raserei der Nordmänner!“ Die kümmerte ihr schlechter Ruf herzlich wenig, sie wollten Beute, egal in welcher Form – Geld, Gold, Vieh oder Menschen, und dafür gingen sie im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Auch ihre christlichen Zeitgenossen handelten nicht besonders gottgefällig – die mitteleuropäischen Fürsten und Könige plünderten und brandschatzten Städte und ganze Landstriche, sie überfielen das eine oder andere Kloster, das am Weg lag – doch insgesamt agierten sie dezenter und versteckten ihre Absichten hinter einem Konstrukt von Gründen wie Religionseifer (Missionierung der Ungläubigen), Thronansprüche, Machtkämpfe. Die Wikinger hingegen verfolgten ihre Ziele ohne Verklausulierungen und Umschweife. Sie wollten ein besseres Leben als das, was ihnen die heimische Scholle bot.
Dafür reisten sie mutig bis an die Grenzen der bekannten Welt. Fast drei Jahrhunderte lang beherrschten sie die nördlichen Meere. Sie waren die besten Bootsbauer und kühnsten Seefahrer ihrer Zeit. Als Piraten, Eroberer, Händler und Entdecker steuerten sie ihre Schiffe durch die Nord- und Ostsee und über den nördlichen Atlantik. Sie plünderten die Küsten Westeuropas bis hinunter nach Gibraltar, griffen Nordafrika an und drangen ins Mittelmeer vor. Als Siedler ließen sie sich in England, in der Normandie, auf den Färöern, den Orkney- und Shetlandinseln, auf Island und Grönland nieder und erreichten fast fünfhundert Jahre vor Columbus die nordamerikanische Küste. Als Händler waren sie auf Handelsrouten zwischen Grönland und dem Schwarzen Meer unterwegs. Sie gründeten Städte in Irland und Staaten in Süditalien und Kiew. In Konstantinopel dienten sie als Söldner in der berühmten Warägergarde des byzantinischen Kaisers. Kurz: Sie waren in der ganzen damals bekannten Welt zu Hause.
Währenddessen erwirtschafteten die Daheimgebliebenen in Skandinavien als Bauern, Fischer, Jäger und Fallensteller die ökonomischen Grundlagen, die diese Seefahrten ermöglichten. Ihr Leben spielte sich im Umfeld der Siedlung und des Hofes ab, das viele ein ganzes Leben lang nicht verließen. Über sie ist nicht viel geschrieben worden. Doch in den vergangenen Jahrzehnten konnten viele archäologische Funde durch moderne Untersuchungsmethoden neu oder überhaupt ausgewertet werden. So legten norwegische Archäologen von 1980 bis 1983 in Flakstad auf den Lofoten einen rätselhaften Friedhof frei. Von den zehn Toten, die dort zwischen 550 und 1030 in drei Einzel-, zwei Doppel- und einem Dreier-Grab abgelegt worden waren, war jeweils nur eine Person pro Grab mit Kopf bestattet worden. Bei den restlichen Toten fehlte der Schädel. Mithilfe von DNA- und Isotopenanalysen fanden die Wissenschaftler (dreißig Jahre später) heraus, dass die sieben ohne Kopf Bestatteten zu Lebzeiten überwiegend Fisch gegessen hatten. Die, die ihren Kopf behalten hatten, waren offensichtlich höher gestellt, denn die Untersuchung ergab, dass sie in ihrem Leben viel Fleisch konsumiert hatten – ein Zeichen für Wohlstand. Man kann daraus schließen, dass die Bewohner eines Hofes oder einer kleineren Siedlung nicht alle aus einem Topf aßen, ihrem gesellschaftlichen Rang entsprechend lebten und auch so starben. So ergänzen ständig neue Erkenntnisse das bisherige Wissen über die Wikinger.
Der Begriff „Wikinger“, mit dem man heute großzügig die gesamte Bevölkerung Skandinaviens und ihre vielseitigen Aktivitäten vom Ende des 8. bis Mitte des 11. Jahrhunderts bezeichnet, ist älter als die Wikingerzeit selbst. Der früheste Beleg stammt aus einem altenglischen Text aus dem 7. Jahrhundert. Er bezieht sich auf Seeräuberei im Mittelmeer und hat mit den Skandinaviern nichts zu tun. Erst im Verlauf des 10. Jahrhunderts wurde der Begriff zunehmend mit den Piraten aus dem Norden in Verbindung gebracht. Im Altnordischen steht víkingr für Seeräuber, seine ursprüngliche Bedeutung ist trotz vieler Deutungsversuche nicht geklärt. Abgeleitet sein könnte es von vik (Bucht), in der die Wikinger auf der Lauer lagen. Oder von dem lateinischen vicus für Lager oder Handelsplatz. Der Name könnte aber auch mit einem konkreten Landschaftsnamen zusammenhängen und Männer aus der südnorwegischen Landschaft Vik, der Region um den Oslofjord, bezeichnen.
Es gibt nur wenige zeitgenössische Belege dafür, dass sich die Skandinavier selbst als Wikinger bezeichneten. In mehreren Runeninschriften werden Männer genannt, die auf Wikingfahrt (í víkingu) fuhren. Welchen Charakter eine solche Fahrt hatte – ob Raub oder Handel –, lässt sich nicht sagen, das altnordische Wort víking steht lediglich für eine „weite Schiffsreise“.
Vikingr bezeichnete denjenigen, der auf Wikingfahrt fuhr. Der Begriff „Wikinger“ erhielt im Laufe der Jahrhunderte einen zunehmend negativen Beigeschmack, wenn er im Sinne von „Pirat“ verwendet wurde, der auch in heimatlichen Gefilden eine Plage war. Auf der anderen Seite galt es auch für Könige noch lange als ehrenwert und das Ansehen fördernd, auf Viking zu fahren. Häufig dienten die Fahrten der Geldbeschaffung, um die eigene (Königs-) Macht zu Hause durchsetzen zu können.
Im Verlauf der Wikingerzeit entwickelten sich die drei Königreiche Norwegen, Schweden und Dänemark; die Skandinavier wurden zu Christen. Die privat geführten Raubzüge lohnten am Ende nicht mehr, die Gegenwehr war zu stark geworden. Ab Ende des 11. Jahrhunderts boten Kreuzzüge und Pilgerfahrten eine gute Gelegenheit, dem Alltag zu Hause den Rücken zu kehren. Nach der Christianisierung gehörten die großen Heiligtümer der Christenheit in Rom und dem Heiligen Land zu den begehrten Reisezielen. Viele bezahlten die Fahrten in die Ferne nicht anders als während der klassischen Wikingerzeit mit dem Leben. Snorri Sturluson erzählt in der „Heimskringla“ von einem Norweger namens Skopti, der im Jahre 1102 mit seinen Söhnen Ogmund, Finn und Thord in insgesamt fünf Langschiffen nach Rom aufbrach, wo sie im Herbst des folgendes Jahres ankamen: „Da starb Skopti. Alle, Vater wie Söhne, starben auf dieser Fahrt. Thord lebte am längsten von ihnen. Er starb auf Sizilien.“ Was sie in Rom wollten, ist nicht sicher – man kann aber davon ausgehen, dass die Reise nicht zu ihrem Nachteil ausfallen sollte.
Die Wikinger, so wie sie in den „Isländersagas“ des 13. Jahrhunderts geschildert werden, waren Realisten, die den Tod nicht selten mit einem recht trockenen Humor kommentierten. In der „Brennu-Njáls saga“ wird ein Kampf mit tödlichem Ausgang beschrieben:
„Kolskegg reagiert schnell, macht einen Schritt auf ihn zu, schlägt ihm den Sax in den Schenkel und trennt das ganze Bein ab.
‚Hab ich dich jetzt getroffen oder nicht?‘, sagt Kolskegg.
, Ich bin selbst schuld, weil ich ohne Schild angegriffen habe‘, antwortet Kol und steht eine ganze Weile auf einem Bein da und betrachtet den Stumpf.
‚Du brauchst gar nicht so zu gucken‘, sagt Kolskegg, ‚es ist genau das, was du siehst: Das Bein ist ab.‘
Da fällt Kol tot zu Boden.“
Um den Tod wurde kein Gewese gemacht. Man nahm hin, was nicht zu ändern war – so war die Zeit, so waren die Wikinger. Sie liebten Ruhm und Reichtum. Reisen in ferne Länder und stolzen Schiffen gehörte ihre Leidenschaft. Ihre Lebensbasis aber war die Familie. Sie waren aufmerksame Gastgeber und legten großen Wert auf zwischenmenschliche Kontakte.
„Jung war ich einst,
ging allein meines Weges,
ging in die Irre –
glücklich schätzt’ ich mich,
als ich den andern fand:
Der Mensch ist die Freude des Menschen“,
heißt es in der „Lieder-Edda“. Dort findet man auch viele praktische Ratschläge für das tägliche Leben: Wer etwas zu erledigen habe, solle zeitig aufstehen. Es sei keine Schande, sich früh schlafen zu legen. Man solle seine Freundschaften pflegen, Reisende willkommen heißen, ihnen ein wärmendes Feuer, Nahrung und trockene Kleider ebenso wie Wasser zum Waschen und ein Handtuch bieten. Man solle das Leben anpacken und auf keinen Fall zu viel grübeln.
Die Wikinger trugen keine Helme mit Hörnern, und ihre Waffen waren nicht gewaltiger als die ihrer europäischen Zeitgenossen. Doch bemerkenswert unberührt vom steten Strom neuer, wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse bleibt der Mythos Wikinger bestehen. Das Faszinierende an der Welt der Wikinger ist aber beides: die reale, nachgewiesene Welt ebenso wie der Mythos.