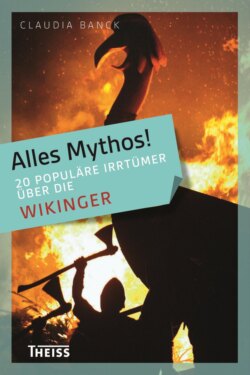Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Wikinger - Claudia Banck - Страница 8
IRRTUM 2: Die Wikinger waren ein Volk ohne König
ОглавлениеWikingerzeit, Wikingerschiff, Wikingersiedlung – auch wenn der Sprachgebrauch darauf hinzudeuten scheint: Ein Volk waren die Wikinger nie. Sie kamen aus dem Norden Europas – von dort, wo heute die Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden liegen. Die Chronisten außerhalb Skandinaviens haben sich nicht die Mühe gemacht, einzelne Regionen und Bewohner auseinanderzuhalten. Adam von Bremen notiert in der um 1075 verfassten Geschichte des Erzbistums Hamburg: „Die Dänen und alle übrigen Völkerschaften hinter Dänemark heißen bei den fränkischen Geschichtsschreibern Normannen.“ Angelsächsische Quellen sprechen nur ganz allgemein von Dänen oder Barbaren. Thietmar von Merseburg nennt in seiner Chronik (1012–18) die Männer aus dem Norden einfach nur Piratenbande oder Piraten (piratarum turba; pirati).
Norwegen, Schweden und Dänemark im heutigen Sinne gab es zu Beginn der Wikingerzeit noch nicht. Die Sammlung vieler kleiner, weitverstreuter Herrschaftsbezirke zu einem großen stabilen Königreich mit festen Grenzen und einem einzigen Herrscher war ein langwieriger Prozess. In den einzelnen skandinavischen Ländern nahm er einen ganz unterschiedlichen Verlauf und war eng mit der Christianisierung des Nordens verbunden. Erst gegen Ende der Wikingerzeit war diese Phase einigermaßen abgeschlossen. Bis dahin prägten Machtkämpfe zwischen Kleinkönigen, Häuptlingsaufstände und Königskriege das Leben im Norden. Zeitweise wurden zuvor vereinte Reiche wieder aufgeteilt und fielen ganz oder teilweise unter die Herrschaft eines anderen skandinavischen (häufig des dänischen) Königs. Es gab eine Vielzahl von heidnischen Häuptlingen und Kleinkönigen. Teilweise waren sie nur Herr über ein einziges Tal, einen Fjord oder eine Gebirgsregion, deren Grenzen nur vage bestimmt werden konnten. Mehr als über ein Gebiet herrschte ein König über Menschen. Das galt umso mehr für die Seekönige, die Snorri Sturluson in der „Ynglinga saga“ (um 1230) charakterisiert: „Zu jener Zeit [als Eystein über das Schwedenreich herrschte] heerten Könige viel in Schweden, Dänen wie Norweger. Da gab es viele Seekönige, die über große Heere geboten, aber kein Land besaßen. Den allein erkannte man mit Fug als einen richtigen Seekönig an, der nie unter rußigem Hausdach schlief und nie im Herdwinkel beim Trunke saß.“ Über den zwölfjährigen Ólaf (den späteren Heiligen) schreibt Snorri: „Als er Heer und Schiffe bekam, gaben ihm seine Leute den Namen, König‘, wie dies damals Brauch war. Heerkönige nämlich, die Wikinger wurden, führten ohne weiteres den Königsnamen, wenn sie aus königlichem Blute waren, auch wenn sie noch kein Land zur Herrschaft besaßen.“
Der König – oder ein Jarl (Fürst) – stand an der Spitze der Gesellschaft. Als Grundvoraussetzung für seine Herrschaft galt die Abstammung von einem Geschlecht, das seinen Ursprung auf die Götter zurückführte. Harald Schönhaar (Hårfagre), der Norwegen – oder zumindest Teile des Landes – als erster einte, stammte von den Ynglingen ab, die sich auf den Gott Frey zurückführten. Ahnherr des mächtigen in Mittelnorwegen bei Trondheim ansässigen Geschlechts der Ladejarle war Odin.
An Nachkommen herrschte kein Mangel, allerdings reichte es nicht aus, sich auf die göttliche Herkunft zu berufen. Ein König musste vom Landesthing akzeptiert werden, das ihm die Macht aber jederzeit auch wieder nehmen konnte, wenn ihm die Politik des Königs nicht gefiel oder das Wohlergehen des Volkes nicht gewährleistet war. Wohlstand in Friedenszeiten und Siege im Krieg waren ein Zeichen dafür, dass die Götter auf der Seite des Königs standen.
Der König war umgeben von seinen Gefolgsleuten, „hirð“ genannt. Zu Beginn der Wikingerzeit waren die meisten seiner Gefolgsleute noch Bauern, erst später bildeten sich Berufskrieger aus. Im mittelalterlichen Upplands-Gesetz heißt es: „Und nun bietet der König die Gefolgschaft und das Bauernheer auf, er verlangt die Ruder- und Kriegermannschaft und die Ausrüstung.“ Demnach gab es eine stehende Kriegertruppe, doch auch die Bauern mussten bereit sein, Kriegsdienste zu leisten. Auf einem Runenstein aus Uppland wird ein Mann des Königs gelobt: „Gunni und Kári setzten den Stein nach … Er war der beste Bauer im Aufgebot Hákons.“
Dass Kriegszüge nicht jedermanns Sache waren, geht indirekt aus den Bestimmungen des norwegischen Frostathing-Gesetzes hervor, das nicht unerhebliche Bußen für diejenigen festsetzte, die dem königlichen Aufgebot nicht Folge leisteten. Doch egal, ob Bauer oder Berufskrieger – ein König musste seine Leute motivieren und mitreißen können. War er dazu nicht in der Lage, fielen die Männer von ihm ab. In der „Heimskringla“ erzählt Snorri Sturluson, dass König Erik Norwegen verlassen musste, als sein Rivale Hákon (der Gute) ein mächtiges Heer gegen ihn aufstellte, während er selber nicht genügend Männer sammeln konnte, „… da manche der Vornehmen ihn verließen und sich zu Hákon begaben“. Auf Stärke, Glück und Tüchtigkeit kam es an. Doch nicht zuletzt brauchte ein König immer auch Geld und Landbesitz, um seine Gefolgschaft mit großzügigen Geschenken an sich zu binden. Die nötigen Mittel erlangte er durch Raubfahrten, Einzug von Steuern und Enteignungen.
In Dänemark, dem kleinsten, aber am dichtest besiedelten der nordischen Königreiche, gewannen schon früh einzelne Familien an Einfluss. Zugute kam ihnen dabei die geografische Lage an den Handelswegen gen Süden. Rolf Krake und weitere Könige aus dem völkerwanderungszeitlichen Königsgeschlecht der Skjöldungen sollen Überlieferungen zufolge in Lejre auf der dänischen Hauptinsel Seeland ihren Sitz gehabt haben. Der mächtige Grabhügel eines Häuptlings bestätigt, dass Lejre bereits im 6. und 7. Jahrhundert eine bedeutende Rolle gespielt hat. Imponierende wikingerzeitliche Langhäuser belegen die wirtschaftliche Bedeutung dieses Machtzentrums. Von hier aus wurden weite Teile des Landes kontrolliert und sogar eine überschaubare Infrastruktur aufgebaut, indem man Wege für Ochsenkarren zwischen den verstreut liegenden Gehöften und Siedlungen anlegte. Der im Jahr 726 gegrabene Kanhave-Kanal teilte Samsø, eine zwischen den wichtigsten dänischen Wasserwegen Storebelt und Lillebelt gelegene Insel, in zwei Teile. Er verband den geschützten Hafen im Osten der Insel mit der offenen Westküste und ermöglichte es, den Verkehr durch beide Wasserstraßen zu kontrollieren und abzukassieren. Eine solche Baumaßnahme erforderte Geld, Männer und die entsprechenden Machtstrukturen.
Auch Abschnitte der Befestigungsanlage Danewerk sind in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts entstanden. Das insgesamt etwa 30 Kilometer lange, in verschiedenen Phasen gebaute, Verteidigungssystem sollte die Landenge zwischen Schlei und Treene nach Süden hin absichern. Es war das größte Verteidigungswerk im Norden Europas und zeugt auch heute noch von einer ehemals starken dänischen Königsmacht. Allein für den ersten Bauabschnitt mussten 30.000 Eichen gefällt und bearbeitet werden. Um das zu bewerkstelligen, war eine gut geplante und organisierte Führung erforderlich. In dem kleinen Dorf Dannewerk östlich von Haithabu entdeckten Archäologen erst im Jahr 2010 das „einzige Tor“ im Verteidigungswall – das Wieglesdor – durch das der „Ochsenweg“ führte. Durch dieses Nadelöhr musste jeder hindurch, der gen Norden oder Süden unterwegs war. Hier wurde zur Kasse gebeten, die Zölle und Abgaben flossen dem jeweiligen Herrscher zu.
In vielen Quellen wird der dänische König Godfred (auch Götrik) genannt, der zu Beginn des 9. Jahrhunderts den slawischen Handelsplatz Reric zerstörte und die Kaufleute nach Haithabu umsiedelte. Mit einer 200 Schiffe starken Flotte rückte er gegen Friesland vor, forderte von den Bewohnern Steuern in Form von 100 Pfund Silber und nur seine Ermordung (810) verhinderte, dass er Karl dem Großen persönlich die Stirn bieten konnte.
Von seinen Nachfolgern ist wenig bekannt. Erst im 10. Jahrhundert entwickelte sich unter Gorm dem Alten (Gorm den Gamle) erneut eine energische, gut organisierte Königsherrschaft, deren Zentrum in Jelling in Jütland lag. Gorms Sohn, Harald I. „Blauzahn“ (dän. Harald Blåtand, um 910–987), wird die Ehre für die Reichssammlung und Christianisierung des Landes zugesprochen, ab 970 wird er auch als König von Norwegen genannt. In seine Regierungszeit fallen Großprojekte wie das Aufwerfen des mächtigen Grabhügels in Jelling, der Bau einer 700 Meter langen Brücke bei Ravning Enge an der Straße nach Jelling sowie die Errichtung der vier großen, dänischen Ringfestungen: in Aggersborg am Limfjord im Norden Jütlands, in Fyrkat bei Hobro in Nordostjütland, Nonnebakken im Norden Fünens und Trelleborg im Westen Seelands.
Die beeindruckenden Anlagen, die um 980/81 entstanden, geben bis heute Rätsel auf. Alle haben den gleichen, streng geometrischen, Grundriss: Sie sind von einem kreisrunden, aus Holz und Grassoden errichteten Wall mit vier Toren umgeben. Die Tore bilden die Endpunkte von zwei mit Holzbohlen befestigten Hauptstraßen, die sich im Zentrum des umwallten Areals kreuzen und es in vier gleiche Teile teilen. Die vier symmetrisch angeordneten Gebäude jedes Viertels sind so angelegt, dass sie einen quadratischen Innenhof bilden. Aufgrund der erstaunlichen Regelmäßigkeit der Grundrisse geht man davon aus, dass die Festungen militärischen Zwecken dienten, möglicherweise wurden hier dänische Truppen für die Eroberung Englands trainiert. In einigen Gebäuden fand man Hinweise auf Werkstätten unterschiedlicher Handwerkszweige. Häuser, die nur wenige Funde preisgaben und in denen keine Feuerstellen nachgewiesen werden konnten, werden als königliche Verwaltungsgebäude interpretiert, in denen Steuern eingezogen und registriert wurden. Andere könnten Lagerhäuser oder Scheunen gewesen sein. Die Errichtung der Ringburgen fällt zeitlich gesehen in die letzten Regierungsjahre Harald Blauzahns, die von Auseinandersetzungen mit seinem Sohn geprägt waren.
Sven I. „Gabelbart“ (dän. Svend Tveskæg, um 965–1014) folgte seinem Vater auf den Thron. Mit seinem auf Raub- und Kriegszügen in England erbeuteten Vermögen baute er die Königsmacht aus. Ab 986 war er König von Dänemark, beteiligte sich weiterhin an Raubzügen, schmiedete Allianzen, taktierte und erpresste, und wurde 1013 schließlich zum König von England erklärt. Auch sein Sohn Knút der Große wurde König von England (1016). Die politisch hoch ambitionierte Eroberungspolitik gegen England hatte mit den „traditionellen“ privaten Raubzügen des 9. und 10. Jahrhunderts nicht mehr viel gemein. 1020 errang Knút die dänische Krone, mit der Rückeroberung Norwegens im Jahr 1028 stieg er schließlich zum mächtigsten Herrscher der skandinavischen Geschichte auf – in zeitgenössischen Schriften wird er rex totius Angliae et Dennemarchiae et Norregiae et partis Suavorum genannt. Dass er auch in (Süd-) Schweden als Herrscher anerkannt war, belegen Münzen aus Sigtuna mit der Inschrift Cnut rex Sv[erorum]. Knút starb 1035 in Shaftesbury, seinem nordischen Großreich war keine Dauer beschieden. Gegen Ende der Wikingerzeit verkleinerte sich das dänische Herrschaftsgebiet, die Herrschaft über Norwegen ging vermutlich bereits zu Knúts Lebzeiten verloren und in England errang die englische Königslinie 1042 wieder die Kontrolle über den Thron.
Mühselig verlief der Prozess der Staatenbildung in Norwegen. Angesichts seiner Topografie mit einer langen, von tiefen Fjorden zerfurchten Küstenlinie und einem in weiten Teilen unwegsamen Landesinneren – dessen schneereiche Gebirge nur auf wenigen Pässen im Sommerhalbjahr überquert werden konnten – war das Land nur schwer unter Kontrolle zu bringen. Bis ins 13. Jahrhundert waren alle Söhne früherer Könige erbberechtigt. Diese Regelung führte dazu, dass zeitweise mehrere Könige gleichzeitig regierten. Grob gesehen gab es zu Beginn des 10. Jahrhunderts drei große Machtbereiche: Der Osten des Landes befand sich unter dänischer Herrschaft, Nordnorwegen wurde von den Ladejarlen beherrscht, im Südwesten und Westen regierte das Geschlecht Harald Schönhaars.
Harald I. „Schönhaar“ (Harald Hårfagri, ca. 852-ca. 933/40) wird in der Skaldendichtung und den Sagas übereinstimmend als erster Einheitskönig genannt. Seinen Beinamen erhielt er Snorri zufolge, weil er geschworen hatte, sein Haar so lange nicht zu pflegen, bis er Norwegen unterworfen habe. Seinem Schwur war die Werbung um Gyda Eiríksdóttir vorangegangen, die eine positive Antwort daran geknüpft haben soll, ob es ihm gelänge, Norwegen als Alleinherrscher zu unterwerfen, wie das König Gorm (der Alte, gest. nach 935) mit Dänemark und König Erich (Eymundsson, gest. 882) mit Schweden gemacht hatte. Nach der entscheidenden Schlacht am Hrafnsfjord ließ sich Harald erstmals wieder die Haare kämmen und wurde seither „Schönhaar“ genannt. In der Seeschlacht im Hrafnsfjord, unweit der heutigen Stadt Stavanger, besiegte er mehrere Kleinkönige (die traditionelle Datierung ins Jahr 872 ist wohl nicht richtig; heute geht man eher davon aus, dass die Schlacht zwischen 885 und 890 stattfand und auch nicht so bedeutend war, wie lange angenommen). Snorri schreibt dazu in der „Heimskringla“: „Nach dieser Schlacht fand König Harald keinen Widerstand mehr in Norwegen.“
Wie weit sich Haralds Herrschaft erstreckte, lässt sich kaum sagen, vermutlich reichte sie nicht über die Küste im (Süd-) Westen sowie Teile des Binnenlandes hinaus. Seinen Sohn Hákon schickte Harald zur (christlichen) Erziehung nach England an den Hof Æthelstans, dessen Reich zu den kultiviertesten in Westeuropa zählte. Ein in politischer und diplomatischer Hinsicht ausgesprochen kluger Zug. Als Hákon später König in Norwegen war, orientierte er sich am englischen Vorbild. Er war ein maßvoller und gerechter Herrscher, in den Preisliedern der Skalden (Dichter) wird seine Rolle als Gesetzgeber lobend hervorgehoben. Hákon erhielt den Beinamen der Gute, er regierte von 935 bis 961. Nach dem Tod seines Nachfolgers Harald Graumantel übernahmen die Dänen die Herrschaft in Norwegen.
Ein gewaltiger Wikinger und mächtiger König wurde Ólaf Tryggvason (968–1000). Der Sohn eines Kleinkönigs aus Vik am Oslofjord (anderen Quellen zufolge aus Oppland) verbrachte seine frühen Jahre in Russland, dann begab er sich auf Wikingfahrt gen Westen. Seinen Raubzügen widmet Snorri in der „Heimskringla“ ein ganzes Kapitel: „Darauf steuerte Olaf Tryggvissohn nach England und heerte dort weit im Lande. Er segelte weiter nach Northumberland und kriegte auch dort. Darauf fuhr er nordwärts nach Schottland und plünderte auch dort weit und breit. Er segelte dann nach den Hebriden, wo er einige Schlachten schlug, dann wieder südlich nach der Insel Man, wo er gleichfalls heerte. Weit und breit heerte er dann in Irland. Von hier ging er nach Wales und kriegte dort überall, besonders auch in der Landschaft, die Kumberland heißt. Weiter fuhr er nach Frankreich, um auch dort zu wikingern. Dann zog er wieder von Westen und hatte es auf England abgesehen. Er kam zu den Scilly-Inseln, die westlich von England liegen.“
Historisch erwiesen sind Ólafs Züge nicht. Es ist aber gut möglich, dass er der Wikingerhäuptling Anlaf ist, über den die angelsächsische Chronik Ende des 10. Jahrhunderts berichtet. Besagter Anlaf beteiligte sich 994 unter Sven Gabelbart an einem missglückten Überfall auf London. Dann heerten, brandschatzten und plünderten die beiden zukünftigen Könige in ganz England, bis ihnen der zermürbte König Æethelred von Wessex Geld für den Frieden anbot. Mit einer prall gefüllten Börse, Auslandserfahrung und getauft – als sein Taufpate wird König Æthelred von England genannt – kehrte Ólaf 995 nach Norwegen zurück, um seinen Anspruch auf die Krone durchzusetzen.
Die Voraussetzungen waren ideal: Er war berühmt für seine Kampferfolge und wurde für seine Großzügigkeit geschätzt. Sein Widersacher Ladejarl Hákon endete kläglich auf der Flucht – versteckt in einem Schweinestall soll er von seinem eigenen Knecht erstochen worden sein. Ólaf machte sich daran, das Land zu christianisieren und zu unterwerfen. Die Religion diente ihm als Mittel zum Zweck, doch seine Herrschaft war nicht von langer Dauer. Im Jahr 1000 verbündeten sich Dänenkönig Sven Gabelbart, Schwedenkönig Olof Skötkonung und die Ladejarle gegen ihn. In der Schlacht von Svolder wurde Ólaf Tryggvason besiegt, er verlor sein Leben, als er von seinem Schiff Ormen Lange ins Meer stürzte. Norwegen geriet erneut unter dänische Oberherrschaft, die sein Nachfolger erst 1016 abschütteln konnte.
Ólaf II. Haraldsson (später „der Heilige“, 995–1030), der Sohn eines ostnorwegischen Kleinkönigs, führte die von seinem Vorgänger begonnene Christianisierung mit brutalen Mitteln fort. Auch er war jahrelang auf Wikingfahrt gewesen und hatte als reicher und großzügiger Heerführer keine Probleme, Gefolgschaft und Anhänger zu finden. Vorausschauend hatte er politische Allianzen geknüpft, war (im Winter 1013/14) in der Normandie getauft worden und erkämpfte (vermutlich) mit englischer Unterstützung die Macht in Norwegen. Die Christianisierung setzte er als Mittel ein, um seine politischen Ziele durchzusetzen, und auch Geld war durch die Raubzüge reichlich vorhanden:
„König Olaf ließ nun einen Königshof in Nidaros errichten. Es wurde eine große Königshalle aufgebaut mit einer Tür an jedem Ende, aber in der Mitte der Halle war der Hochsitz für den König. Nach dem Innern der Halle zu, neben dem König, saß sein Hofbischof Grimkel und diesem zunächst die anderen Geistlichen. Aber auf der andern Seite, nach dem Haupteingang zu, saßen des Königs Ratgeber. Auf dem niederen Hochsitz ihm gerade gegenüber, saß der Marschall Björn der Dicke, dann folgten auf beiden Seiten die Gäste. Kamen Männer von hohem Rang zum Könige, dann erhielten sie einen Ehrenplatz.“
Der norwegische König hielt Hof, er war jetzt Herrscher von Gottes Gnaden, Bildung und höfische Lebensart gewannen allmählich an Bedeutung. Religiöse, aber auch politische Auseinandersetzungen führten schließlich zum Aufstand gegen Ólaf. 1030 fiel er in der Schlacht bei Stiklestad in Trøndelag. Norwegen kam erneut unter dänische Herrschaft. Nach Ólafs Tod ereigneten sich solche Wunder, dass er zum Märtyrer stilisiert und heiliggesprochen wurde. Seine Parteigänger nutzten die Chance, die unbeliebte dänische Regierung abzuschütteln und Ólafs elfjährigem Sohn Magnus die Herrschaft zu übertragen. Dieser war nach Karl dem Großen, Carolus Magnus, benannt, was ein bezeichnendes Licht auf die Ideale in der Umgebung seines Vaters wirft. Ólaf wurde zum Schutzpatron eines gegen Ende des 11. Jahrhunderts endgültig geeinten, christlichen Norwegens. Fortan beriefen sich die Könige und Königsanwärter nicht mehr auf ihre Abstammung von Harald Schönhaar (und den Göttern), sondern führten sie mehr oder minder glaubhaft auf Ólaf den Heiligen zurück. Die Verbindung von weltlicher Herrschaft und Gottesmacht stärkte die Stellung des Königs und fand Nachahmer. König Knút von Dänemark, der den Märtyrertod gestorben war, wurde 1086 in der Domkirche in Odense heiliggesprochen.
In Schweden kam es nach der Herrschaft des christlichen Königs Olof Skötkonung (ca. 980–ca.1022) ab Mitte des 11. Jahrhunderts noch einmal zu Thronstreitigkeiten. Gegen Ende der Wikingerzeit war die Stellung der skandinavischen Könige weitgehend gefestigt. Wilde Horden, die zu privaten Raubzügen aufbrachen, gehörten der Vergangenheit an. Die Könige waren ambitionierte und clevere Anführer, die ihre auf Wikingfahrt erworbenen Reichtümer zielstrebig einsetzten, um an die Macht zu kommen. Die Strukturen der Kirche und internationale Allianzen nutzten sie geschickt, um ihre Herrschaft zu stabilisieren – darin unterschieden sie sich nicht von anderen europäischen Herrschern.