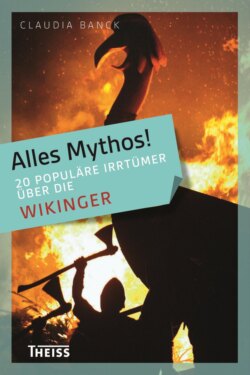Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Wikinger - Claudia Banck - Страница 9
IRRTUM 3: Wirtschaftliche Not und Überbevölkerung trieben die Wikinger außer Landes
ОглавлениеVon Norwegen zogen sie aus, die Nordmänner, die die ersten internationalen „Schlagzeilen“ als Räuber machten. Dass es ausgerechnet Norwegen war, erschien aus späterer Sicht nur allzu plausibel. Adam von Bremen beschreibt in seiner um 1075 verfassten „Geschichte des Erzbistums Hamburg“ (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum) die geografischen und wirtschaftlichen Bedingungen des Landes, das ihm zufolge dort liegt, wo „der Erdkreis ermattet aufhört“: „Norwegen ist infolge seiner rauhen Gebirge und unermeßlichen Kälte das unfruchtbarste aller Länder, nur zur Viehzucht geeignet. Man weidet dort wie bei den Arabern die Herden in entlegenen Einöden, und von solcher Viehhaltung leben sie: Die Milch der Tiere dient als Nahrung, ihre Wolle zur Kleidung. Dadurch erzieht das Land zu sehr tapferen Kriegern, die nicht durch üppige Früchte verweichlicht sind und öfter andere angreifen, als selbst von irgend jemand belästigt werden.“
In der Tat weist Norwegen, das sich von seinem südlichsten (Festland-) Punkt am Kap Lindesnes fast 3000 Kilometer gen Norden erstreckt, extreme Landschaftsformen und Klimabedingungen auf. Die höchsten, ganzjährig schneebedeckten Gipfel messen über 2500 Meter, und sie erheben sich unmittelbar hinter der von Fjorden zerklüfteten Küstenlinie. Über 70 Prozent Norwegens bestehen aus Bergen und Ödland, auch heute noch sind nur knapp vier Prozent des Landes als Ackerland nutzbar.
Die Fjorde greifen bis zu 200 Kilometer tief ins Landesinnere ein. So misst die Küstenlinie Norwegens über 20.000 Kilometer, zählt man die der Küste vorgelagerten Inseln dazu, kommt man auf mindestens 150.000 Kilometer. Siedlungen lagen auf den schmalen Uferstreifen unterhalb der vielerorts steil abfallenden Bergwände und auf den flachen Ebenen am Ende der Fjorde. Täler und Hochlandwiesen boten Weideland für das Vieh. Nur im Südwesten Norwegens, um den Oslofjord und weiter nördlich in der Gegend des Trøndelag, gab es weite Landstriche fruchtbaren Bodens, die sich auch für den Ackerbau eigneten. Für Adam gab es keinen Zweifel, dass die Hauptursachen für den Aufbruch der Nordmänner gegen Ende des 8. Jahrhunderts in der Landknappheit und materiellen Not zu suchen seien: „Deshalb ziehen sie aus Mangel an Besitz in der ganzen Welt umher, bringen von Raubfahrten zur See die reichsten Güter aller Länder nach Hause und helfen so der Dürftigkeit ihres Landes ab.“
In dem Mangel an fruchtbarem Acker- und Weideland und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Not sah man bis in die heutige Zeit die Hauptursache für die Expansion der Wikinger.
Adams Argumente der (land-) wirtschaftlichen Not könnten auf das durch Fjorde zerfurchte, gebirgige Westnorwegen zutreffen, wo es in der Tat wenig überschüssiges, landwirtschaftlich nutzbares Land gab und gibt. Neue Untersuchungen haben ergeben, dass die ersten skandinavischen Siedlungen auf den Orkney- und Shetlandinseln, den Hebriden und den benachbarten Regionen des schottischen Festlandes noch vor Beginn der Wikingerzeit von Norwegern angelegt wurden. Auf der anderen Seite gibt es eindeutige Belege dafür, dass es im 8. Jahrhundert noch in weiten Teilen Skandinaviens große Landreserven gab, die mit dem allmählichen Anstieg der Bevölkerung erst nach und nach in die landwirtschaftliche Nutzung einbezogen und kolonisiert wurden. Während zu Beginn der Wikingerzeit schätzungsweise 100.000 Menschen in Norwegen wohnten, waren es gegen Ende – also etwa 250 Jahre später – etwa doppelt so viele. Die Bevölkerung wuchs weiter, bis sie um 1300 bei 450.000 Menschen lag, die alle noch Platz fanden. Die Intensität der Elch- und Rentierjagd nahm seit der frühen Wikingerzeit sogar ab ebenso wie die Eisenproduktion in den Wald- und Bergregionen Südnorwegens. Nach Meinung der Archäologen widerlegt das eindeutig die gängige These der Landknappheit und Überbevölkerung.
Die Wirtschaftsgrundlage der Wikinger im gesamten skandinavischen Raum waren Viehzucht, Ackerbau und Fischfang. Die Skandinavier der Wikingerzeit waren in erster Linie Bauern und Fischer. Je nach Lage dominierte einer der primären Wirtschaftszweige. Eine große Rolle spielte die Viehzucht. fé – das nordische Wort für „Vieh“ – bedeutet auch „Vermögen“. Gehalten wurden Kühe, Schweine, Ziegen und Pferde. Im äußersten Norden Skandinaviens gab es naturgemäß kaum oder keinen Ackerbau, das Getreide wurde nicht reif und hätte sich bestenfalls als Viehfutter, nicht aber zum Brotbacken geeignet. Nach dem Bericht des wohlhabenden Kaufmanns Ottar (im 9. Jahrhundert) lag der landwirtschaftliche Schwerpunkt im Norden auf Tierzucht, Fischfang, Jagd und Handel mit Pelzen.
Günstig für Ackerbau und Viehzucht waren die Bedingungen im sanft hügeligen Dänemark, dessen höchste Erhebung 273 Meter über dem Meeresspiegel beträgt. Anders als heute war Jütland von ausgedehnten Eichen- und Buchenwäldern bedeckt. Als die Bevölkerung ab dem 11. Jahrhundert (wie in vielen Teilen Europas) zunahm, begann sich der Ackerbau auf Kosten des Waldlandes auszudehnen. Die allgemeine Verbesserung des Klimas im 11. und 12. Jahrhundert trug zur Steigerung der Erträge bei. Gute Voraussetzungen für Ackerbau und Viehzucht boten einige der großen Inseln. Vor allem Fünen und Seeland waren für ihre Fruchtbarkeit bekannt. Adam von Bremen zufolge war das Land im 11. Jahrhundert noch größtenteils unfruchtbar und brachliegend, doch die archäologischen Befunde sprechen eine andere Sprache: Dörfer und Gehöfte waren dicht über das Land verteilt, sie bildeten den Dreh- und Angelpunkt der wikingerzeitlichen Wirtschaft, die auf Ackerbau und Viehwirtschaft basierte – ergänzt durch Jagd, Fischerei, kleinere Gewerbe und Handel. Bis zum 11. Jahrhundert war die Weidewirtschaft vorherrschend, aber die meisten dänischen Dörfer besaßen auch etwas Ackerland. Das Vieh war in Ställen untergebracht. Zu zwei Höfen im dänischen Vorbasse gehörten im 9. Jahrhundert jeweils 22 solcher Ställe, und im 11. Jahrhundert konnten mehrere Höfe bemerkenswert viele Tiere unterbringen – mindestens 50 Tiere, so schätzen die Archäologen. Da die Ackerflächen nur klein waren, werden nur wenige als Zugtiere genutzt worden sein. Man nimmt an, dass sie viel mehr Milch, Käse, Butter, Fleisch und Häute produziert haben, als auf dem Hof benötigt wurde. Die Archäologen gehen davon aus, dass der Überschuss an viehwirtschaftlichen Produkten verkauft, möglicherweise sogar exportiert wurde.
In Schweden gab es ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Den auch heute noch dünn besiedelten Norden Schwedens prägten Nadelwälder, nackter Fels und extrem kalte, lange Winter. Weiter südlich aber erstreckten sich neben unwegsamen Wäldern und Sümpfen auch ausgedehnte, für Viehzucht und Ackerbau nutzbare Gebiete. Die waldreichen und fruchtbaren Regionen Mittelschwedens – die heutigen Provinzen Västergötland, Östergötland und Uppland mit angrenzender Ostseeküste – waren die reichsten Gegenden Schwedens. Man lebte von Ackerbau, Viehzucht und Handel. Vor der Küste lagen die Inseln Gotland und Öland, die dank der für den Handel günstigen Lage und des gemäßigten Klimas sowie ihrer fruchtbaren Böden schon in der der Wikingerzeit vorangegangenen Vendelzeit (um 550–800) bedeutend und wohlhabend gewesen waren.
Die archäologischen Untersuchungen der vergangenen Jahrzehnte ergaben keine Hinweise, die auf eine Überbevölkerung in einer der skandinavischen Regionen schließen lassen. Einen Überschuss an jungen Männern könnte es allerdings gegeben haben. Das Land, das zu einem Hof gehörte, durfte nicht geteilt werden. Der germanischen Erbteilung zufolge erbte der älteste Sohn das ganze Land, während der bewegliche Besitz aufgeteilt wurde. Die mangelnde Möglichkeit, sich den Lebensunterhalt auf dem eigenen Hof zu verdienen, trieb die nicht-erstgeborenen Söhne aus der Heimat, bemerkt Dudo von St. Quentin, der um 1020 die Geschichte der normannischen Herzöge verfasste. Er führte die Zeugung der (zu) zahlreichen Nachkommenschaft auf die sexuelle Unersättlichkeit der Nordmänner zurück. Auch Adam von Bremen thematisiert die sexuelle Maßlosigkeit und Vielweiberei, aus der viele Kinder hervorgingen. Diese mittelalterlichen Berichte trugen dazu bei, dass viele Forschergenerationen auch in der Überbevölkerung den Auslöser für die Expansion der Nordmänner sahen.
Die Zahl der Kinder, die geboren wurden, war ohne Zweifel groß, doch nicht alle überlebten das erste Lebensjahr. Viele Neugeborene wurden ausgesetzt, um dem Bevölkerungswachstum Einhalt zu gebieten. Nach Grabfunden wird geschätzt, dass in der Frühzeit (auch außerhalb Skandinaviens) zwischen 15 und 50 Prozent der Neugeborenen getötet wurden, denn unnütze Esser waren eine Belastung. Auch unter günstigen geografischen Bedingungen konnten strenge Winter oder nasse Sommer zu einer Hungersnot führen. Als die Isländer im Jahr 1000 offiziell das Christentum annahmen, wurde ihnen ausdrücklich erlaubt, weiterhin Kinder auszusetzen. In den gut zweihundert Jahre nach der Christianisierung verfassten Sagas finden sich einige „Aussetzungsepisoden“, die in die heidnische Zeit fallen. Dass das Thema Aussetzung aber auch Jahrhunderte später noch aktuell war, beweist das Verbot der Kindesaussetzung in skandinavischen Rechtssammlungen des 12. und 13. Jahrhunderts, die belegen, dass die Praxis nicht vollständig aufgegeben war. Es waren vor allem Mädchen, die ausgesetzt wurden, weshalb vielerorts Männerüberschuss herrschte. Dieser eklatante Mangel an heiratsfähigen Frauen könnte die jungen Männer dazu gebracht haben, in die Ferne zu ziehen, um sich anderswo eine Frau zu besorgen – so jedenfalls argumentieren Archäologen von der Universität Cambridge. Ihr Ansatz wird kontrovers diskutiert.
Einigkeit besteht hingegen über die wesentliche Grundvoraussetzung für die Wikingerexpansion: Mit ihren (hoch-) seetüchtigen Schiffen hatten die Nordmänner die Möglichkeit, weite Fahrten über das offene Meer zu unternehmen, während sich alle anderen Völker Europas noch vorsichtig entlang der Küsten bewegten – das Mittelmeer einmal ausgenommen, dessen Verhältnisse aber nicht mit denen des um ein Vielfaches raueren Atlantiks zu vergleichen waren.
Schon lange vor Beginn der Wikingerzeit unterhielten die Skandinavier ausgedehnte Handelskontakte. Die Schifffahrtswege zwischen blühenden Handelsorten wie Dorestad an der friesischen Küste, London in England und Staraja Ladoga am Wolchow waren ihnen vertraut. Auf ihren Handelsfahrten erfuhren die Nordmänner, wo Reichtümer lockten, wo politische Konflikte eine Region oder ein Land schwächten – und verfügten damit gewissermaßen über eine Art Basiswissen über Orte, Städte, Klöster oder Landstriche, die sie später überfielen. Die Zeit war günstig: Der Westen des europäischen Kontinents war zu Beginn der Wikingerzeit weitgehend ungeschützt. Weder das Reich der Karolinger noch die Könige Irlands und Englands besaßen stehende Heere, geschweige denn eine Flotte, um sich zu verteidigen. „Schutzlos wie ein Selbstbedienungsladen lag Europa da“, fasst Harm Paulsen vom Haithabu-Museum die Situation zusammen.
Die Wikinger nutzten ihre Chance und schlugen zu, zunächst auf den Britischen Inseln, nach dem Tod Karls des Großen wandten sie sich verstärkt dem durch Thronstreitigkeiten geschwächten Frankenreich zu. Beute gab es reichlich, vor allem in Kirchen und Klöstern. Landen, Beute greifen und abhauen – so einfach war das, wenn man ein Schiff zur Verfügung hatte. Um aber ein Schiff bezahlen zu können, benötigte man beträchtliche finanzielle Mittel. Ein Wikinger, der Besitzer oder Teilhaber eines knörr oder eines langskip war, kann nicht mittellos gewesen sein. Wenn er über das Meer nach Westen oder Osten zog, um „Reichtümer zu erwerben“, bedeutete das in der Regel, dass er noch reicher werden wollte. Bei Ulanda in Uppland wird ein Mann wegen des Reichtums, den er in die Familie einbrachte, in einem alliterierenden Vers gepriesen: „Er fuhr beherzt, erwarb Habe/auswärts in Griechenland seinem Erben.“
Und auch die Nordmänner, die im 9. und 10. Jahrhundert als Siedler nach Island oder Grönland aufbrachen, sahen die Chance sich zu verbessern: Die Mitglieder einflussreicher Familien gewannen an Macht, indem sie reichlich Land nahmen, es unter den eigenen Leuten verteilten und damit ihre führende Position als Häuptlinge festigten. Die einfachen Bauern hofften auf mehr oder ertragreicheres Land und damit auf mehr Gewinn, als sie zu Hause hatten. In der „Saga von Eirík dem Roten“ wird von einem Isländer namens þorbjörn erzählt, der seinen Freunden erklärt, warum er nach Grönland auswandern will: „Lange Zeit habe ich hier gewohnt und das Wohlwollen und die Zuneigung der Leute genossen. Ich darf wohl sagen, dass wir gut miteinander auskamen. Doch meine bisher ansehnliche finanzielle Lage verschlechtert sich. Daher will ich eher meinen Hof verlassen, als mein Ansehen zu verlieren, eher das Land verlassen, als meiner Familie Schande zu bereiten. Ich habe vor, das Angebot anzunehmen, das mein Freund Eirík der Rote mir machte, als wir uns im Breiðafjord voneinander trennten. Wenn alles so verläuft, wie ich es mir wünsche, werde ich im Sommer nach Grönland fahren.“ Sein Vorhaben überraschte die Leute, denn er war ein angesehener und beliebter Mann. þorbjörn aber verkaufte seine Ländereien, erwarb ein Schiff und folgte Eirík dem Roten nach Grönland.
Das Leben der Siedler auf Island und Grönland war schwieriger als erwartet – auch für die ersten Landnehmer, die sich das beste Land gesichert hatten. Eklatant war der Mangel an Holz für den Haus- und Schiffbau. Schon allein aus diesem Grund ließen die Isländer den Kontakt zum skandinavischen Festland nie abbrechen. Auslandsfahrten – seien es Handelsreisen, Piratenunternehmungen oder Entdeckungsfahrten – gehörten noch lange zum Werdegang junger Männer. Ihre Fahrten waren ein wichtiger Bestandteil vieler „Isländersagas“. So zieht es Gunnar (in der „Brennu-Njáls saga“) und Kjartan (in der „Laxdœla saga“) in die weite Welt, sie vollbringen große Taten, erlangen die Gunst und Geschenke von Königen, in deren Glanz sie sich – zurück in Island – bis an ihr Lebensende sonnen können.
Aus den schriftlichen, vornehmlich isländischen Quellen erhält man den Eindruck, dass sich jeder Sohn einer angesehenen Familie in seiner Jugend auf Wikingfahrt begab. Den Daheimgebliebenen wurde nur geringe Achtung entgegengebracht.
Das nordische Wort für „einfältig, dumm“ ist heimskr. Es ist abgeleitet von heimr (Heim, Wohnsitz) und bezeichnet jemanden, der zu Hause sitzen geblieben, das heißt wenig herumgekommen ist. Die in der „Hávamál“ überlieferten Verhaltensregeln lassen keinen Zweifel daran, dass ein eingeschränkter Horizont engstirnig macht:
„An kleinen Stränden und kleinen Meeren
ist kleinlich der Menschen Sinn, …“
Reisen ist wichtig, nur unterwegs lernt man sich selbst und die Menschen kennen:
„Der nur weiß,
der weithin streift
und viel gereist ist,
welche Gesinnung
ein jeder hegt –
der, welcher Verstand hat.“
Auch zweihundert Jahre nach Ende der Wikingerzeit zählten Wissbegierde und die Aussicht auf Gewinn zu den Gründen, aufzubrechen und die Welt zu „erfahren“. Die Antwort eines Vaters auf die Frage seines Sohnes, weshalb die Menschen lossegeln und sich freiwillig in Lebensgefahr begeben: „… dazu lockt sie eine dreifache Anlage des Menschen. Das erste ist die Lust am Kampf und Ruhm, denn das ist menschliche Art, dorthin sich zu begeben, wo große Gefahr zu erwarten ist, und sich dadurch berühmt zu machen. Das zweite ist Wissbegierde, denn das liegt gleichfalls in der Natur des Menschen, die Dinge zu erkunden und zu untersuchen, von denen ihm erzählt wird, und zu erfahren, ob sie so sind, wie ihm gesagt wurde, oder nicht. Das dritte ist die Aussicht des Gewinns, denn überall suchen die Menschen nach Gut, wenn sie erfahren, dass sich irgendwo Aussicht auf Gewinn darbietet, mag auch anderseits große Gefahr damit verbunden sein.“ Die Antwort findet sich im „Königsspiegel“ aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Zweifelsohne trafen die genannten Motive aber auch auf die Wikingerzeit zu.
Die meisten Nordmänner, die aufbrachen – sei es auf Kriegs-, Raub- oder auf Handelsfahrt – wird die Aussicht auf Reichtum gelockt haben. Die zeitgenössischen (fränkischen und angelsächsischen) Chroniken wimmeln von Klagen über die maßlose Geld- und Beutegier der Wikinger. Dutzende von Runensteinen sind Gedenksteine für Wikinger, die in der Ferne Reichtümer gewannen. Eine typische Inschrift lautet: Björn var nú í vikingu at afla sér fjár ok frægðar – „Björn befand sich damals auf Wikingerfahrt, um Reichtümer und Ruhm zu erwerben.“ Es gibt keine Hinweise auf eine verarmte Bauernschaft mit zu wenig Land und zu vielen Kindern.