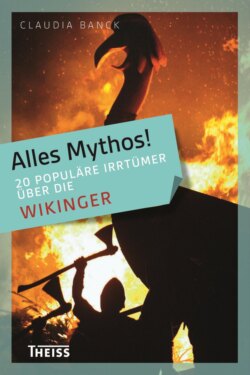Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Wikinger - Claudia Banck - Страница 7
IRRTUM 1: Die Wikinger hatten eine schlechte Presse
ОглавлениеAm 8. Juni 793 tauchten norwegische Wikinger mit mehreren Schiffen vor der Klosterinsel Lindisfarne an der Küste Northumbriens im Nordosten Englands auf, sie zogen ihre Schiffe auf den Strand und stürmten mit gezogenen Schwertern an Land. Kurz darauf stand die Abtei in Flammen, massakrierte Mönche lagen am Boden, Altäre und Kanzeln waren zerschlagen, Truhen geplündert. Die Piraten flohen mit goldenen Kruzifixen und edelsteinbesetzten Evangelienbüchern im Gepäck. „Rohe, vollkommen gottlose, verwegene Gestalten“, wie ein irischer Kleriker klagte, hätten den heiligen Ort zerstört. „Nie zuvor hat Britannien solchen Horror gesehen …“, schreibt Alkuin, der berühmte aus Northumbrien stammende Gelehrte am Hofe Karls des Großen. Es folgen weitere Überfälle in England und im Frankenreich. Angelsächsische und fränkische Chronisten beschreiben den nicht enden wollenden Alptraum. Die Schreiber sind Geistliche oder Mönche, deren (reiche und ungeschützte) Kirchen und Klöster bevorzugte Angriffsziele sind. Als Augenzeugen und Opfer beschönigen sie nichts, im Gegenteil, sie schildern die Plünderungen und Zerstörungen durch die Wikinger als Orgie der Gewalt, der Blut- und Beutegier, und interpretieren sie als Erfüllung alttestamentarischer Prophetien, nach denen von Norden das Unheil über alle Bewohner des Landes kommen sollte – als Strafe Gottes für die Sünden der Menschen. Das kam ihnen gelegen, konnten Männer der Kirche doch auf diese Weise ihre Schäflein enger an sich binden und zu einem frommen, gottgefälligeren Leben motivieren.
Über Jahrhunderte prägten ihre Augenzeugenberichte das Negativbild der Wikinger, das von späteren Geschichtsschreibern übernommen wurde und im Verlauf der Jahrhunderte nichts von seinem Schrecken einbüßte. Im irischen Epos „Cogad Gaedel re Gallaib“ (Der Krieg der Iren mit den Fremden) aus dem 12. Jahrhundert heißt es: „… obwohl auf jedem Hals einhundert stahlharte Eisenschädel saßen und in jedem Kopf einhundert scharfe, jederzeit besonnene, niemals einrostende, unverschämte Zungen und einhundert geschwätzige, laute, unaufhörliche Stimmen von jeder Zunge kamen, konnten sie nicht wiedergeben, schildern, aufzählen oder erzählen, was all die Ghaedhil, Männer wie Frauen, Laien wie Geistliche, alte wie junge, edle wie unwürdige, in jedem Haus an Unbill, Unrecht und Bedrängnis gemeinsam von diesen kühnen, wutentbrannten, fremden, vollkommen heidnischen Menschen erlitten.“
Eine nordische Gegendarstellung zu diesen Vorfällen gibt es nicht. Einen der wenigen direkten Zugänge zu Sprache und Denkweise der Wikingerzeit bieten die (häufig) wortkargen Runeninschriften. Über 5.000 Runendenkmäler und Runentexte sind bewahrt, die meisten stammen aus der Wikingerzeit. Ihr Verbreitungsgebiet reichte von Skandinavien, Grönland, England, Irland bis nach Russland, Byzanz und Griechenland. Sie enthalten knappe Informationen über Einzelpersonen und gewähren einen zeitgenössischen Einblick in eine Gesellschaft, die Tapferkeit und Mut als herausragende Tugend schätzte. „Thorulv, der Gefolgsmann Svens, errichtete diesen Stein nach Erik, seinem fila (Kameraden, Genossen), der den Tod fand, als die Krieger um Haithabu saßen, und er war Schiffsführer, ein sehr tüchtiger Krieger“, lautet die Inschrift eines Gedenksteines für Erik, der vermutlich in den Kämpfen um Haithabu gegen Ende des 10. Jahrhunderts getötet wurde. Andere Inschriften erwähnen Kriegszüge nach England und Süditalien, Handelsreisen ins Baltikum und in den Vorderen Orient, sie nennen Brücken- und Wegebau, bitten um das heidnische Wohlwollen Thors oder um das christliche Seelenheil. In der Mehrzahl sind es wohlwollende Inschriften, die ruhmreiche Taten, großartige Eigenschaften oder auch einfach nur einen Krieger, eine Frau, eine Tochter verewigen sollen. Tadelnde Nachrufe gibt es auch: So hat etwa ein Krieger seine Mannschaft im Stich gelassen. Aber solche Meldungen sind selten und lassen positive Rückschlüsse zu auf das Weltbild der Wikinger. Insgesamt sind die Runeninschriften zeitgenössische und damit authentische Dokumente, die zwar erst viele Jahrhunderte später erforscht wurden, dann aber nachhaltig zum Ruhm und Heldentum der Wikinger beigetragen haben.
Erst nach der Christianisierung und der damit verbundenen Schriftkultur begannen die Skandinavier, sich ab dem 12. Jahrhundert um die eigene Geschichtsschreibung zu kümmern und machten sich daran, die mündlichen Überlieferungen niederzuschreiben. Sie erinnerten an die Heldentaten ihrer wikingischen Vorfahren und malten ein sehr viel schmeichelhafteres Bild von dem, was letztere als Krieger, Seefahrer, Siedler und Entdecker in fernen Ländern geleistet hatten.
Am Anfang der isländischen Geschichtsschreibung steht Ari þorgilsson, der im „Isländerbuch“ (Íslendingabók) die frühe Geschichte Islands erzählt. Für sein um 1125 in isländischer Sprache verfasstes Werk zu Ereignissen, die 250 Jahre vor seiner Zeit stattgefunden hatten, standen ihm kaum schriftliche Aufzeichnungen zur Verfügung. Er musste sich auf die mündliche Überlieferung verlassen, die von Generation zu Generation weitergegeben und dabei im Verlauf der Zeit vermutlich das eine oder andere Mal dem sich verändernden Zeitgeist angepasst worden war. Das gilt auch für das „Landnahmebuch“, das Buch der Besiedlung Islands, (Landnámabók, die erste nicht erhaltene Fassung stammt aus der Zeit um 1100) und die „Isländersagas“ (Íslendinga sögur), von denen die meisten im 13. Jahrhundert aufgeschrieben wurden – bevor oder auch nachdem die Isländer im Jahre 1262 dem norwegischen König Hákon die Treue geschworen und damit ihre Unabhängigkeit verloren hatten. Der Name der einzelnen Autoren wird nirgends genannt, Isländer waren sie, und die bedrohte oder bereits verlorene Freiheit Islands beeinflusste sie alle. In den „Isländersagas“ werden historische Überlieferungen mit fiktiven, literarischen Elementen verknüpft, sie handeln von isländischen (und grönländischen) Familien oder Einzelpersonen. Der Zeitraum, den viele dieser Prosawerke behandeln, liegt etwa zwischen 930 und 1030, die in der isländischen Geschichte die „Sagazeit“ genannt wird.
In den „Königsagas“ (Konunga sögur) wird die Geschichte der norwegischen – und in ein paar Fällen auch der dänischen – Könige erzählt. Die berühmteste Sammlung von Königsgeschichten ist die dreibändige „Heimskringla“ (altnordisch für Weltkreis), die der bedeutende Gelehrte Snorri Sturluson um 1230 in Island aufzeichnete und in Form brachte. Die in den Sagas erzählten Geschehnisse waren von Generation zu Generation mündlich weitergegeben worden, bevor sie – dichterisch gestaltet – aufgeschrieben wurden.
Tapferkeit und Treue sind die wesentlichen Werte, mit denen man einen Sagahelden gern schmückte. Ein Beispiel aus der „Saga von Gísli Súrsson“: Der auf dem Thing verurteilte, geächtete und damit für vogelfrei erklärte Gísli befindet sich auf der Flucht vor seinem Rächer Bork, dessen Bruder er getötet hat. Eine Zeit versteckt er sich auf der kleinen Insel Hergilsøy bei seinem Verwandten Ingjald, der ein Pächter Borks ist. Als Bork davon erfährt, kommt er mit seinen Männern, um sich Gísli zu holen. Herrisch tritt er vor Ingjald, droht damit, ihn zu töten und verlangt die Auslieferung von Gísli, die Ingjald ihm aber verweigert: „Ich trage schlechte Kleider, und es würde mir nichts ausmachen, sie nicht bis zum Letzten aufzutragen. Aber eher will ich mein Leben lassen, als dass ich Gísli nicht so sehr Gutes erweise, wie ich nur kann, und ihn in seinen Schwierigkeiten unterstütze.“ Niemals, für kein Geld der Welt, würde Ingjald nachgeben und Gísli verraten. Die Sagaautoren romantisieren die isländische Vergangenheit als eine heroische Zeit, in der sich ein freier Mann, egal ob arm oder reich, nichts und niemandem unterwarf.
Auch aus dem Werk des dänischen Geschichtsschreibers und Geistlichen Saxo Grammaticus spricht der Stolz auf die eigene Geschichte. Im Vorwort seiner ab 1185 in Latein verfassten „Gesta Danorum“ (Taten der Dänen) heißt es: „Da alle anderen Völker sich einer Darstellung ihrer Thaten rühmen und aus der Erinnerung an ihre Vorfahren Genuss schöpfen können, so wünschte der oberste Bischof der Dänen, Absalon, dass auch unserem Vaterlande, für dessen Verherrlichung er stets begeistert war, diese Art von Ruhm und Gedächtnis nicht vorenthalten bliebe …“ Das Werk greift auf mündlich tradierte Mythen, Sagen und Lieder zurück, die zur gleichen Zeit auch auf Island niedergeschrieben wurden und die Wikingerzeit in einem neuen Licht erscheinen lassen. Saxo beschreibt die Erfolgsgeschichte ruhmreicher Herrscher, die brutalen Beutezüge spielen kaum eine Rolle. Seine Sicht der Dinge fand allerdings erst ein größeres Publikum, nachdem die „Gesta Danorum“ zu Beginn des 16. Jahrhunderts ins Dänische übersetzt worden waren. Das Buch erlangte große Popularität und weckte das Interesse an der eigenen glorreichen Vergangenheit.
In der Wissenschaft beginnt man, die Runeninschriften zu entschlüsseln und die überlieferten Mythen zu studieren. Die wichtigsten Quellen sind die beiden Eddas: die „Lieder-Edda“ (häufig auch ältere oder poetische Edda genannt) ist eine Sammlung alter Götter- und Heldenlieder, die um 1270 niedergeschrieben wurde, und die „Snorra-Edda“, ein von Snorri Sturluson um 1220 verfasstes Lehrbuch für Skalden (Dichter), in dem er die alten Göttermythen und Heldensagen zitiert und zum Teil nacherzählt, um eine beispielhafte Anleitung für poetische Umschreibungen zu geben.
Die Idealisierung der heidnischen Helden bleibt nicht auf den Norden beschränkt. Der einflussreiche französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) sieht in den beutegierigen, ungehobelten Barbaren „edle Wilde“. In seinen Essays verklärt er alles Ursprüngliche, noch nicht von der Zivilisation Korrumpierte zum Ideal. „Freie, gesunde, glückliche Menschen“ seien sie ihm zufolge. Der schwedische Universalgelehrte Olof Rudbeck behauptet in seinem um das Jahr 1700 erschienenen Werk „Atland eller Manhem“ (Atlantis oder Menschenheim), seine Heimat sei das sagenumwobene Atlantis, Mittelpunkt der Welt und Wiege aller Kulturen. Die Normannen beschreibt er als Entdecker und Pioniere. 1825 veröffentlicht der schwedische Lyriker und Bischof Esaias Tegnér die „Frithiofs Saga“. Das nordische Heldenepos wird zum Bestseller. Nicht nur Johann Wolfgang von Goethe findet Gefallen an dem tapferen und treuen Recken Frithiof, den es in die Ferne treibt: Dieser beweist ritterliche Tapferkeit und bleibt seiner Liebe zu Ingibjorg, der schönen Tochter eines Königs vom Sognefjord, treu. Das „Prachtwerk der schwedischen Nationalromantik“ wird in zahlreiche Sprachen übersetzt. Eine Welle der Begeisterung für alles Nordische erfasst Deutschland, Eltern geben ihren Kindern nordische Namen wie Frithiof oder Ingeborg. Der Brandenburger Dichter Friedrich de la Motte Fouqué mischt in der um 1810 aufgeführten Dramentrilogie „Der Held des Nordens“ wikingerzeitliche Elemente mit hochmittelalterlichen Rittermotiven. Mit den kühnen Seefahrern befasst sich Friedrich Schlegel in seinen Wiener Vorlesungen (1810). Mit Hang zur Poesie und Drang zu Abenteuern, so Schlegel, hätten die Nordmänner den „Rittergeist“ nach Europa gebracht. Die Götter- und Heldenlieder der „Edda“ faszinieren auch Richard Wagner (1813–1883), vor allem der Nibelungenzyklus hat es ihm angetan. Aufwendig inszeniert er die nordische Heldengeschichte, auf der opulent ausgestatteten Opernbühne tragen die Helden erstmals Helme mit Hörnern. Der enorme Erfolg des Werkes befeuert das positive Heldenbild und die Verbreitung vieler (fantasievoller) Vorstellungen und Klischees.
Mit der Entdeckung der beiden spektakulären Schiffsgräber am Oslofjord – Gokstad (1880) und Oseberg (1904) – gelangen erstmals konkrete Detailkenntnisse über den Schiffbau und das Kunsthandwerk der Wikinger ins nationale und internationale Bewusstsein. Die Skandinavier sind hingerissen von ihrer eigenen, glorreichen Vergangenheit. (Die Gegenwart hat indes wenig zu bieten: Norwegen und Island sind zu Beginn des 20. Jahrhunderts verarmt. Auch in Dänemark und Schweden sind die Großmachtzeiten vorbei.) Mit dem nordischen Drachenstil werden Tier- und Pflanzenornamente aus der Wikingerzeit ebenso wie Gestaltungselemente der mittelalterlichen Zimmermannskunst – der Schiffe und Stabkirchen – wieder aufgenommen, fortan prägen sie Architektur und Möbeldesign.
Ein großes Faible für alles Nordisch-Germanische hat auch Kaiser Wilhelm II. Zwischen 1889 und 1914 unternimmt er in Begleitung seines Hofstaates insgesamt 26 Nordlandfahrten auf seiner Yacht „Hohenzollern“ durch die norwegischen Fjorde. Er schwärmt von dem „kernigen Volk, welches in seinen Sagen und seiner Götterlehre stets die schönsten Tugenden, die Mannentreue und Königstreue, zum Ausdruck gebracht hat“. Dem Helden Frithiof setzt er in Vangsnes am Sognefjord ein kolossales Denkmal. Von einer der Reisen bringt er als Souvenir eine norwegische Stabkirche mit, die er 1893 in der Rominter Heide bei Rominten/Raduznoje (im ehemaligen Ostpreußen) neben seinem Jagdschloss von norwegischen Handwerkern wieder aufbauen lässt, Holzbalken für Holzbalken. Der Norden war für Wilhelm die „Wiege der Germanen“.
Die Verehrung der nordisch-germanischen Vergangenheit bildet den Nährboden für arisches und antisemitisches Gedankengut, das im Nationalsozialismus ideologisch überhöht wird. „Ehre und Freiheit trieben die einzelnen in die Ferne und Unabhängigkeit, Länder, wo Raum für Herren war …“, begründet Parteiideologe Alfred Rosenberg den Aufbruch der Nordmänner in seinem 1930 erschienen Buch „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“. „Geniale Zwecklosigkeit, fern aller händlerischen Überlegung“ ist seiner Meinung nach der Grundzug des nordischen Menschen, der „mit … heldischer Unbekümmertheit … Staaten in Rußland, Sizilien, England und in Frankreich“ errichtet.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933 wird der Wikingerkult greifbar und gegenwärtig. Heinrich Himmler, Reichsführer der SS, nutzt die Runenzeichen der Nordmänner für seine Zwecke, aus den gezackten Sigrunen setzt die SS ihr Kürzel zusammen. Als die Wehrmacht 1940 Norwegen besetzt, erhalten die deutschen Soldaten die Anweisung, dort als Beitrag zur Vermehrung der „arischen“ Rasserettung möglichst viele (blonde und blauäugige) Kinder zu zeugen. Als direkte Nachfahren der Wikinger hätten sie nordische Kühnheit und Stärke in ihren Adern.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Begeisterung für die Wikinger erst einmal gedämpft, zu eng sind die Wikinger als Verkörperung eines Herrenvolkes mit dem Rassenwahn der Nazis verwoben. Die mittelalterlichen Sagas und die Götter- und Heldenlieder der „Edda“ werden aber weiterhin gelesen. John R. R. Tolkien, Oxford-Professor für englische Sprache und Literatur, bedient sich für seine Fantasy-Trilogie „Der Herr der Ringe“ (erschienen 1954/55) aus den altnordischen Göttermythen der „Edda“.
Historiker und Archäologen stellen die Wikinger nicht mehr als großartige Nationalhelden dar, sie heben jetzt ihre Tüchtigkeit als Händler, Kolonisten, Schiffbauer und Entdecker Amerikas hervor, eine zunehmend sachliche Auseinandersetzung – nicht ohne schwärmerische Elemente: „Stolz, Freude an Taten, Wagemut, Verlangen nach Kampf und Ruhm, Freude am Wettbewerb, Raubgier, Todesverachtung“ werden (etwa von Johannes Brøndsted, 1960) als „Sinnesart der Wikinger“ genannt.
Die Popularität der nordischen Plünderer und Rowdies wächst. Aufwendig produzierte Hollywoodfilme erreichen ein Millionenpublikum. Der Zeichentrickfilm „Wickie und die Starken Männer“, Comics und Cartoons – allen voran Hägar der Schreckliche – erfreuen seit Jahrzehnten ihre großen und kleinen Fans. Die vom kanadischen Fernsehsender „History Television“ produzierte Serie „Vikings“ war (2013) so erfolgreich, dass sogleich die 2. Staffel folgte. Die actionreiche Handlung basiert lose auf der Geschichte des legendären Wikingers Ragnar Lodbrok, der 845 Paris eroberte. Die Wirtschaft nutzt die Wikinger und ihre stolzen Drachenschiffe als attraktive Werbeträger. Alles, wo Wikinger drauf stand und steht, verkauft(e) sich besser. Bis heute sind die Wikinger der Inbegriff für Abenteuerlust, Entdeckergeist, Erfolg, Mobilität und Stärke.
Das extrem schlechte Zeugnis, das zeitgenössische Chronisten den Piraten aus dem Norden ausgestellt hatten, diente Historikern in späteren Jahrhunderten immer wieder als Aufhänger, um zur „Ehrenrettung“ der Wikinger aufzurufen. Randaliert habe schließlich nur eine Minderheit von (geschätzten) fünf Prozent. Dies klarzustellen, rechtfertigt noch heute so manches Werk über die Wikinger und ihre Zeit. Leidenschaftliche Dichter, begnadete Kunsthandwerker, geschickte Händler, große Entdecker und Staatengründer seien sie gewesen. In ihrer Rede zum tausendjährigen Jubiläum der Entdeckung Vínlands durch die Wikinger brach auch die damalige Präsidentengattin Hilary Clinton eine Lanze für die blonden Recken: „Wie die USA“ hätten auch sie „neue Ideen“ in die Welt getragen; ihre Schiffe hätten „Menschen und Orte verbunden“. „Ein gewagter Vergleich“, kommentieren die „Spiegel“-Autoren in dem im Jubiläumsjahr erschienenen Sonderheft über die Wikinger, und zweifelsohne wieder einmal eine überaus wohlmeinende Interpretation ihrer Taten. Über schlechte Presse konnten die Nordmänner allenfalls zu ihren Lebzeiten klagen.