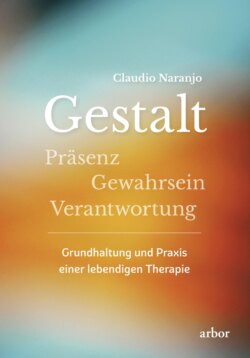Читать книгу Gestalt - Präsenz - Gewahrsein- Verantwortung: - Claudio Naranjo - Страница 11
ОглавлениеKAPITEL 2
Die Gegenwart im Mittelpunkt
Für mich existiert nichts weiter als das Jetzt.Jetzt = Erfahrung = Gewahrsein = Wirklichkeit.Die Vergangenheit ist nicht mehr und die Zukunft noch nicht.Nur das Jetzt existiert.
FRITZ PERLS
A) ALLE THEMEN IM SPIEGEL DER GEGENWART
Im vorangegangenen Kapitel habe ich folgendes postuliert:
1. daß die Techniken der Gestalttherapie in bestimmten Haltungen verwurzelt sind;
2. daß diese Haltungen Verkörperungen einer inneren Grundhaltung sind, die sich unter dem dreifachen Aspekt – Gewahrsein, Verantwortung und Präsenz – zusammenfassen läßt;
3. daß diese Grundhaltung keine Ideologie ist, sondern selbst auf Erfahrung beruht: die Evidenz des Gegenwärtigen (Verständnis für die Tatsache, daß wir im Hier und Jetzt leben und eins mit unserem konkreten Tun sind); die Evidenz der Verantwortung (der Tatsache, daß wir tun, was wir tun und nichts anderes sind, als das, was wir sind) und die Evidenz des Gewahrseins (daß wir auf einer bestimmten Ebene wissen, was wir tun und erfahren, ganz gleich, wie sehr wir uns selbst belügen und so tun, als wüßten wir es nicht).
Auf den folgenden Seiten werde ich einen Aspekt der dreifachen Haltung der Gestalttherapie im Detail darstellen, als Beispiel für eine Form der Erläuterung, die mit jeder der drei Haltungen durchgeführt werden kann. Vor allem werde ich den Aspekt der Gegenwärtigkeit oder Präsenz erläutern, der gleichzeitig ein Aspekt der Philosophie der Gestalttherapie ist. Wie ich aufzeigen werde, spiegeln sich alle Themen in diesem Aspekt, ebenso wie in allen anderen, denn die Fragen der Präsenz, des Gewahrseins und der Verantwortung sind nur an der Oberfläche verschieden. Wenn wir genauer hinsehen, können wir beispielsweise entdecken, daß die Frage der Präsenz nicht allein mit der Würdigung von zeitlicher und örtlicher Gegenwart zu tun hat, sondern mit der Würdigung der konkreten Realität, des Spürens und Fühlens, statt des Denkens und Vorstellens, mit Gewahrsein und Selbstbestimmung. Weiterhin hoffe ich, daß die folgenden Seiten zeigen werden, daß der Wille, in der Gegenwart zu leben, untrennbar mit der Frage der Offenheit für Erfahrungen verknüpft ist, mit dem Vertrauen in die Abläufe der Realität, mit dem Unterscheidungsvermögen zwischen Realität und Phantasie, Aufgeben der Kontrolle und Inkaufnehmen einer möglichen Enttäuschung, eine hedonistische Weltsicht, Bewußtheit des möglichen Todes und so weiter. Alle diese Themen sind Facetten einer Gesamterfahrung des In-der-Welt-Seins, und die Betrachtung einer solchen Erfahrung aus der Perspektive der Gegenwartsbezogenheit ist eine Möglichkeit unter vielen.
B) GEGENWARTSBEZOGENHEIT ALS TECHNIK
Obwohl die Formel hic et nunc in der scholastischen Literatur ein wiederkehrendes Thema ist, hat sich die Beziehung der modernen Psychologie zum Hier und Jetzt nur allmählich entwickelt.
Die Psychoanalyse begann mit einer vergangenheitsorientierten Verfahrensweise. Freuds Entdeckung der freien Assoziation hatte ihren Ursprung in seinen Erfahrungen mit der Hypnose, und seine ersten Erkundungen der Technik waren eher ein Versuch, ohne Trancezustand auszukommen und dennoch dieselben Schlüssel zum Verständnis der Vergangenheit seines Patienten zu finden. Er stellte gewöhnlich dem Patienten eine Frage und bat ihn, den ersten Gedanken wiederzugeben, der ihm in dem Moment kam, während er seine Stirn berührte. Mit zunehmender Erfahrung fand er heraus, daß er die Berührung der Stirn auch weglassen konnte, ebenso wie die Frage, und statt dessen jede Äußerung als eine Assoziation zur vorangegangenen in dem spontanen Fluß der Gedanken, Erinnerungen und Phantasien ansehen konnte. Zu seiner Zeit war dies für ihn nicht mehr als das Rohmaterial für einen Deutungsversuch, wobei die kostbarsten Assoziationen diejenigen waren, die mit der Kindheit des Patienten zu tun hatten. Freud ging davon aus, daß der Patient sich nur von seiner eigenen Vergangenheit befreien kann, indem er in der Gegenwart für sie Verständnis findet.
Der erste Schritt hin zu einem Interesse an der Gegenwart in der Psychoanalyse war Freuds Entdeckung des Phänomens der Übertragung. Da die Gefühle des Patienten für den Analytiker als Abbild seiner früheren Gefühle für seine Eltern oder Geschwister gesehen wurden, gewannen sie sofort an Bedeutung für das Verständnis der noch immer im Mittelpunkt stehenden Vergangenheit des Patienten.
Anfangs hielt sich die Analyse der Übertragung noch immer an die retrospektive Deutung der Vergangenheit, aber wir können davon ausgehen, daß sie sich immer mehr in Richtung eines verselbständigten Interesses bewegte, denn der nächste Schritt war die allmähliche Verlagerung der Betonung von der Vergangenheit in die Gegenwart, nicht nur als das untersuchte Medium oder Material, sondern als das eigentliche Ziel des Verständnisses. Daher wurde aus dem Verständnis der Gegenwart zum Zweck der Vergangenheitsbewältigung die heutige Deutung der Kindheitserlebnisse als Mittel zum Verständnis der Gegenwartsdynamik.
Die Entwicklungslinien, die zu dieser Verschiebung führten, sind zahlreich. Melanie Klein beispielsweise pflegt eine interpretative Sprache, die auf Annahmen über frühe Kindheitserfahrungen beruht, wenngleich die Tendenz ihrer Schule in der eigentlichen Praxis fast ausschließlich auf das Verständnis der „Übertragungsbeziehung“ abzielt. Ein ähnlicher Schwerpunkt auf die Gegenwart wurde von Bion auf die Gruppensituation angewendet.
Wilhelm Reichs Schwerpunktverlagerung auf die Gegenwart war das Ergebnis seiner Interessenverlagerung von Worten zu Taten. In seiner Charakteranalyse ist der Schwerpunkt auf das Verständnis der Ausdrucksform des Patienten gelegt, statt auf das, was er sagt. Dies geschieht am besten dadurch, daß man sein Verhalten in der jeweiligen Situation beobachtet.
Ein dritter Beitrag für die Evaluation der Gegenwart im therapeutischen Prozeß geht auf Karen Horney zurück und berührt die eigentliche Grundlage der Interpretation von Neurosen. Aus ihrer Sicht werden Störungen, die in der Vergangenheit ihren Ursprung haben, in der Gegenwart durch eine falsche Identität aufrechterhalten. Der Neurotiker hat irgendwann im Austausch für ein glänzendes Selbstbild seine Seele an den Teufel verkauft und zieht es weiterhin vor, diesen Pakt zu respektieren. Wenn ein Mensch versteht, wie er sein wahres Selbst in diesem Augenblick verbirgt, kann er frei werden.
Die wachsende Betonung der Orientierung auf die Gegenwart in der zeitgenössischen Psychotherapie kann auf den Einfluß zweier Quellen außerhalb der Psychoanalyse zurückgeführt werden: Encounter-Gruppen und östliche spirituelle Disziplinen. Über letztere sind mittlerweile auch im Westen Informationen weit verbreitet, und die Praxis von einigen nimmt zu. Besonders Zen kann als Einfluß genannt werden, der zur Entwicklung der Gestalttherapie in ihrer gegenwärtigen Form beigetragen hat.
Das Jetzt in der Aktualisierung und im „Gewahrseinskontinuum“
Die Gegenwartsbezogenheit spiegelt sich im methodischen Repertoire der Gestalttherapie auf mindestens zweierlei Weise wider. Die eine ist die ausdrückliche Aufforderung des Patienten, alles, was in den Bereich seiner gegenwärtigen Aufmerksamkeit eintritt, zu registrieren und zum Ausdruck zu bringen. In den allermeisten Fällen wird dies damit verbunden sein, daß der Therapeut den Patienten bittet, den Fluß seiner Gedanken zugunsten der puren Selbstwahrnehmung aufzugeben. Die andere ist die Aktualisierung der Vergangenheit und der Zukunft (oder der Phantasietätigkeit im allgemeinen). Dies kann als innerer Versuch geschehen, vergangene Ereignisse neu zu erleben oder sich mit ihnen zu identifizieren oder, in den allermeisten Fällen, als ein aktives Nachvollziehen der Szenen mit Gesten, Körperhaltungen und Stimme, nach Art eines Psychodramas.
Beide Techniken haben Vorläufer in spirituellen Disziplinen, die weit älter sind als die Psychotherapie, was angesichts ihrer Bedeutung kaum verwunderlich ist. Die Technik der Aktualisierung findet man in der Geschichte des Schauspiels, in Magie und Ritual wie auch in der Inszenierung von Träumen bei einigen Naturvölkern. Das Verweilen in der Gegenwart ist das Fundament einiger Meditationsarten. Dennoch finden die Aktualisierung und das Verweilen in der Gegenwart in der Gestalttherapie eine unverwechselbare Verkörperung und Nutzungsweise, die es lohnt, ausführlich vorzustellen. Auf den folgenden Seiten werde ich mich auf das Verfahren konzentrieren, das man in der Gestalttherapie die Übung des „Gewahrseinskontinuums“ nennt. Da sie sehr einer in Worte gefaßten Meditation ähnelt und ihre Rolle der Rolle der freien Assoziation in der Psychoanalyse vergleichbar ist, werde ich sie überwiegend in vergleichender Form vorstellen.
Gestalttherapie und Meditation
Die Übung der Aufmerksamkeit für die Erfahrung der Gegenwart hat in zahlreichen spirituellen Traditionen ihren Platz. Im Buddhismus ist es die natürliche Folge der „Rechten Achtsamkeit“, einer der Bestandteile des „Edlen Achtfachen Pfades“. Ein Aspekt der „Rechten Achtsamkeit“ ist die Übung der bloßen, ungerichteten Aufmerksamkeit.
Die bloße Aufmerksamkeit befaßt sich mit nichts anderem als der Gegenwart. Sie lehrt, was viele Menschen vergessen haben: im vollen Gewahrsein des Hier und Jetzt zu leben. Sie lehrt uns, uns der Gegenwart zu stellen, ohne in Gedanken über Vergangenheit und Zukunft abzuschweifen. Vergangenheit und Zukunft sind für das gewöhnliche Bewußtsein kein Gegenstand der Wahrnehmung, sondern nur der Reflektion. Im gewöhnlichen Leben werden Vergangenheit und Zukunft jedoch höchst selten zum Gegenstand wahrhaft weiser Reflektion, sondern sie sind meistens Anlaß zu Tagträumen und allerlei Phantasien, die die Haupthindernisse für die rechte Achtsamkeit ebenso wie für die rechte Versenkung darstellen. Bloße Aufmerksamkeit, die treu an ihrem Beobachtungspunkt festhält, verfolgt achtsam und ohne innere Bindung den unaufhörlichen Lauf der Zeit: Sie wartet geduldig darauf, daß die zukünftigen Dinge vor ihren Augen erscheinen, zu Gegenwärtigem werden und wieder in der Vergangenheit verschwinden. Wieviel Energie wird durch nutzlose Gedanken an die Vergangenheit verschwendet: in untätiger Sehnsucht an längst vergangene Tage, in vergeblichem Bedauern und Reue und durch die sinnlose und geschwätzige Wiederholung aller Banalitäten der Vergangenheit in Worten oder Gedanken. Gleichermaßen überflüssig ist ein Großteil der Gedanken, die der Zukunft gewidmet sind: vergebliche Hoffnungen, phantastische Pläne und hohle Träume, unbegründete Ängste und unnötige Sorgen. All dies wiederum ist die Ursache für vermeidbare Enttäuschungen und Belastungen, die durch bloße Aufmerksamkeit vertrieben werden können.8
Vergangenheit und Zukunft sind als „Ding an sich“ ungeeignet, weil sie von Natur aus der Vorstellung entspringen. Gleichzeitig sollte man sie lieber meiden, weil das Verharren bei ihnen einen Verlust von Freiheit mit sich bringt: Die Illusion verwickelt uns in immer neue Illusion. Wie Nyaponika es ausdrückt:
Rechte Achtsamkeit fördert für den Menschen die verlorene Perle seiner Freiheit wieder zutage, entreißt sie den Fängen des Drachen Zeit. Rechte Achtsamkeit befreit den Menschen aus den Fesseln der Vergangenheit, die er in seiner Torheit ständig zu verstärken sucht, indem er zu häufig zurückschaut, mit sehnsuchtsvollem Blick, in Reue oder Zorn. Rechte Achtsamkeit bewahrt den Menschen sogar vor den Fesseln der Gegenwart, die er sich durch die Einbildungen seiner Ängste und Hoffnungen auf vorweggenommene zukünftige Ereignisse anlegt. So bringt die Rechte Achtsamkeit dem Menschen eine Freiheit zurück, die nur in der Gegenwart gefunden werden kann.
Die wichtigste Übungsform im Zusammenhang mit diesem Zitat ist die Meditationsweise, die im Chinesischen wu-hsin (Ideallosigkeit) genannt wird und, wie Alan Watts feststellte, vor allem aus „der Fähigkeit, das normale und alltägliche Bewußtsein beizubehalten und gleichzeitig loszulassen“ besteht.
Das heißt, man beginnt, eine objektive Sichtweise des Gedankenflusses, der Eindrücke, Gefühle und Erlebnisse einzunehmen, die unaufhörlich durch unseren Geist fließen. Statt zu versuchen, sie zu kontrollieren und einzugreifen, läßt man es einfach fließen, wie es will. Während jedoch normalerweise das Bewußtsein sich von dem Fluß forttragen läßt, ist es in diesem Falle wichtig, ihn wahrzunehmen, ohne sich davon beeinflussen zu lassen.
Dies ist ein Zustand, in dem
… man die Erfahrungen einfach so annimmt, wie sie kommen, ohne einerseits in sie einzugreifen und andererseits sich mit ihnen zu identifizieren. Man beurteilt sie nicht, bildet keine Theorien über sie, versucht sie nicht zu kontrollieren und bemüht sich nicht, ihre Natur in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Man läßt ihnen die Freiheit, genau das zu sein, was sie sind. „Der Vollkommene“ sagte Chuang-tzu, „nutzt den Geist als Spiegel; er hält nichts fest, er weist nichts zurück, er empfängt, doch behält nichts“. Dieser Zustand muß jedoch klar unterschieden werden von der bloßen Leere des Geistes auf der einen und dem undisziplinierten Umherschweifen der Gedanken auf der anderen Seite.9
Die Übung, die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu richten, stellt sich im Zusammenhang der Gestalttherapie sehr ähnlich dar wie die in Worte gefaßte Meditation. Mehr noch, es ist eine in den interpersonellen Bereich gebrachte Meditation in Form einer Selbstoffenbarung. Dies erlaubt die Supervision der Übung durch den Therapeuten (was für unerfahrene Anfänger unerläßlich sein kann) und kann den Inhalten des Gewahrseins Signifikanz verleihen.
Ich habe keinen Zweifel, daß die Suche nach Worten und der Prozeß des Berichterstattens mit bestimmten Geisteszuständen in Konflikt geraten kann. Gleichzeitig jedoch trägt der Vorgang des Ausdrückens etwas zur Übung des Gewahrseins bei und geht über die bloße Informationsgewinnung zum Zwecke der Intervention des Therapeuten hinaus.
Das verbalisierte Gewahrsein hat gegenüber der stillen Meditation zahlreiche Vorteile:
1. Der Vorgang des Ausdrückens ist eine Herausforderung für die Schärfe des Gewahrseins. Es entspricht nicht ganz der Wahrheit, wenn wir sagen, wir wissen etwas, können es aber nicht in Worte fassen. Natürlich sind Worte nur Worte, und wir können niemals irgend etwas in Worte fassen. Dennoch geht die Klarheit der Wahrnehmung in begrenztem Maße Hand in Hand mit der Fähigkeit, sich auszudrücken. So ist ein Künstler in erster Linie ein Meister des Gewahrseins und erst in zweiter ein geschickter Zeichner, und in der Kunst der Psychotherapie ist die Aufgabe der Kommunikation gleichzeitig eine Herausforderung, wirklich genau hinzusehen, statt nur vom Hinsehen zu träumen.
2. Die Gegenwart eines Zeugen führt normalerweise zu einer Erhöhung sowohl der Aufmerksamkeit als auch der Bedeutsamkeit des Beobachteten. Ich bin ebenfalls der Meinung, daß unsere Aufmerksamkeit durch die bloße Gegenwart eines außerordentlich wachsamen und bewußten Menschen geschärft werden kann, so, als sei Bewußtsein ansteckend oder als könne man sich nur schwer dem entziehen, was von jemand anderem intensiv wahrgenommen wird.
3. Die Bewußtseinsinhalte eines interpersonellen Settings neigen von Natur aus dazu, durch interpersonelle Beziehungen geprägt zu sein, während der allein Meditierende, wenn er sich auf das Hier und Jetzt konzentriert, in seinem Gewahrseinsbereich solche Inhalte niemals finden wird. Da unter psychopathologischen Bedingungen hauptsächlich Beziehungs- und Selbstwahrnehmungsprozesse gestört sind, ist dieser Faktor bei der gemeinsam durchgeführten therapeutisch orientierten Hier-und-Jetzt-Übung nicht zu übersehen.
4. Die interpersonelle Situation erschwert die Gegenwartsbezogenheit zusätzlich, weil sie im allgemeinen Projektionen, Vermeidungsstrategien und Selbsttäuschung hervorruft. Was zum Beispiel für den einsam Meditierenden eine Reihe von Beobachtungen körperlicher Zustände sein kann, wird im Kontext der Kommunikation möglicherweise von einem Gefühl der Angst durchsetzt, daß der Therapeut sich langweilen könnte, oder von der Annahme, daß solche Beobachtungen trivial sind oder die Wesensleere des Patienten entlarven könnten. Das Einlassen auf solche Gefühle und Phantasien ist wichtig:
a) Wenn die Konzentration auf die Gegenwart eine erwünschte Lebensweise ist, die gewöhnlich durch die Wechselfälle interpersoneller Beziehungen getrübt wird, führt die Herausforderung des Kontakts zu einer idealen Trainingssituation. Ich möchte meinen, daß die Praxis des Lebens im Augenblick eine wirkliche Übung ist und nicht nur eine Gelegenheit zur Selbsteinsicht. Ebenso wie in der Verhaltenstherapie handelt es sich um einen Prozeß der Befreiung von neurotischen Spannungen, bei dem der Mensch sich von der zentralen Konditionierung zur Vermeidung von Erfahrung befreien und lernen kann, daß es nichts gibt, was er zu fürchten hätte.
b) Damit einher geht die Tatsache, daß es das Gewahrsein der Schwierigkeiten bei der Gegenwartsbezogenheit ist, das den ersten Schritt zu ihrer Überwindung bilden kann. Die Erfahrung der Zwanghaftigkeit des Grübelns und Pläneschmiedens ist möglicherweise untrennbar mit der Würdigung der Alternativen dazu verbunden sowie mit einem wirklichen Verständnis des Unterschiedes zwischen diesen Gemütszuständen und der Gegenwartsbezogenheit.
5. Der therapeutische Kontext erlaubt eine genaue Beobachtung des Prozesses der Selbstwahrnehmung, wodurch der Therapeut den Patienten in die Gegenwart zurückbringen kann, nachdem er von ihr (von sich selbst) abgelenkt worden ist. Es gibt im wesentlichen zwei verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Die einfachste (außer der bloßen Erinnerung an die Aufgabe) besteht darin, ihn allmählich auf die Dinge aufmerksam zu machen, die er unwillkürlich tut. Dies wird erreicht, indem man seine Aufmerksamkeit auf Aspekte seines Verhaltens lenkt, die anscheinend einen Teil seiner automatischen Verhaltensmuster ausmachen oder mit seinen absichtlichen Handlungen kollidieren. Ein solches einfaches Funktionieren als Spiegel für den Patienten kann dabei helfen, sich auf seine Beziehung zu sich selbst und auf sein Handeln im allgemeinen zu konzentrieren.
P.: Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll …
T.: Ich merke, daß du mich jetzt nicht anschaust.
P.: (kichert)
T.: Und jetzt hältst du dir eine Hand vors Gesicht.
P.: Du machst mir so ein schlechtes Gefühl.
T.: Und jetzt hältst du dir beide Hände vors Gesicht …
P.: Hör auf! Das ist ja unerträglich!
T.: Was fühlst du jetzt?
P.: Es ist mir so peinlich. Schau mich bitte nicht so an!
T.: Bleib eine Weile bei dieser Peinlichkeit.
P.: Mein ganzes Leben habe ich dieses Gefühl. Ich schäme mich für alles, was ich tue. Meinem Gefühl nach habe ich nicht einmal das Recht auf mein Leben.
Eine Alternative zu diesem Prozeß der einfachen Reflektion des Verhaltens des Patienten besteht darin, sein Scheitern bei der Gegenwartsbezogenheit als Schlüssel zu seinen Problemen zu betrachten (oder vielmehr als lebendige Beispiele für sie), ebenso wie in der Psychoanalyse das Scheitern der freien Assoziation zum Gegenstand der Interpretation wird. Statt einer Interpretation haben wir es in der Gestalttherapie jedoch mit einer Aufdeckung zu tun: die Aufforderung an den Patienten, sich selbst der Erfahrung bewußt zu werden, die seiner Gegenwartsvermeidung zugrundeliegt, und sie auszudrücken. Denn eine der Voraussetzungen der Gestalttherapie ist, daß die Gegenwartsbezogenheit natürlich ist: tiefes, gegenwartsbezogenes Erleben ist das, was wir am meisten wollen, und daher sind Abweichungen von der Gegenwart eher den Vermeidungsstrategien oder zwangsläufigen Opfern zuzuordnen als zufälligen Alternativen. Selbst wenn diese Annahme nicht für die interpersonelle Kommunikation im allgemeinen gültig wäre, wird sie doch in der Gestalttherapie besonders durch die Aufforderung des Patienten verstärkt, in der Gegenwart zu bleiben. Innerhalb einer solchen Struktur können Ablenkungen entweder als Scheitern interpretiert werden, als Boykott der eigentlichen Absicht oder als ein Mißtrauen gegenüber dem gesamten Ansatz einschließlich des Psychotherapeuten.
In der Praxis wird daher der Therapeut nicht nur dem Patienten zu einer dauerhaften Aufmerksamkeit für seine gegenwärtige Erfahrung verhelfen wollen, sondern er wird ihn ermuntern, sich seiner Erfahrung bewußt zu werden und sie zum Ausdruck zu bringen, besonders wenn ihm die Aufgabe nicht gelungen ist. Das führt letztendlich dazu, daß man innehält, um die Lücken des Gewahrseins zu füllen:
P.: Mein Herz schlägt heftig. Meine Hände schwitzen. Ich habe Angst. Ich erinnere mich, als ich das letztemal mit dir arbeitete und …
T.: Was willst du mir sagen, wenn du dich an vergangene Woche erinnerst? P.: Ich hatte Angst, mir eine Blöße zu geben, und dann fühlte ich mich wieder erleichtert, aber ich glaube, daß ich das Richtige nicht rausgebracht habe …
T.: Warum willst du mir das jetzt erzählen?
P.: Ich würde mich gern dieser Angst aussetzen und alles herausbringen, was ich bisher vermieden habe.
T.: Gut. Das ist es also, was du jetzt möchtest. Bitte fahre fort mit deiner Erfahrung im jetzigen Augenblick.
P.: Ich würde gerne hinzufügen, daß ich mich diese Woche viel besser fühle. T.: Könntest du mir etwas von deinem jetzigen Erleben mitteilen, während du mir dies erzählst?
P.: Ich bin dir sehr dankbar, und ich möchte es gern zum Ausdruck bringen.
T.: Okay. Nun vergleich bitte einmal diese beiden Aussagen: „Ich bin dankbar“ und die Mitteilung, daß du dich diese Woche viel besser fühlst. Kannst du mir sagen, was dich dazu gebracht hat, diese Geschichte der direkten Mitteilung deiner gegenwärtigen Gefühle vorzuziehen?
P.: Wenn ich sagen würde: „Ich bin dir dankbar“, hätte ich das Gefühl, ich müßte es noch erklären …
Oh! jetzt weiß ich es. Über meine Dankbarkeit zu sprechen, ist mir zu direkt. Ich fühle mich sicherer, wenn ich dich es erraten lasse oder dir nur ein gutes Gefühl vermittele, ohne dir etwas über meine Gefühle zu sagen.
In diesem besonderen Fall können wir sehen, daß der Patient: 1) es vermeidet, für seine Gefühle die Verantwortung zu übernehmen und sie zum Ausdruck zu bringen (wie später in seiner Ambivalenz deutlich wird), und 2) seine Gefühle ausagiert, statt sie zu offenbaren, in einem Versuch, die Gefühle des Therapeuten zu beeinflussen und ihn zufriedenzustellen, statt sich seines Bedürfnisses bewußt zu werden, ihm zu schmeicheln.
Wenn durch solches Befragen deutlich wird, daß der Patient über das bloße Gewahrsein hinausgehende, erlebnismotivierende Aktivitäten entfaltet hat, geschieht es häufig, daß er die Umwege seines Ausdrucksverhaltens, mit dem er von der Gegenwart abgelenkt hat, loslassen kann. Direkter Ausdruck wiederum kann zu einem reicheren Gewahrsein führen.
T.: Jetzt sehen wir, wie es sich anfühlt, wenn du mir so direkt wie möglich von deiner Dankbarkeit erzählst.
P.: Ich möchte dir danken für alles, was du für mich getan hast. Ich habe das Gefühl, ich müßte dich für deine Aufmerksamkeit in irgendeiner Weise entschädigen … Wow! Ich habe ein ziemlich unangenehmes Gefühl, wenn ich dir dies sage. Ich habe das Gefühl, daß du denken könntest, ich bin ein Heuchler und ein Schleimer. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das war eine ziemlich geheuchelte Aussage. Ich fühle mich gar nicht so dankbar. Ich möchte nur, daß du glaubst, ich sei so dankbar.
T.: Bleiben wir mal dabei. Wie fühlst du dich, wenn du willst, daß ich das glaube?
P.: Ich fühle mich klein, ungeschützt. Ich habe Angst, du könntest mich angreifen, also will ich dich für mich einnehmen.
Wir können die vorangegangene Illustration so verstehen, daß der Patient anfangs keine Verantwortung für seine vermeintliche Dankbarkeit übernehmen will. Denn schon bald wurde deutlich, daß dies an seiner Ambivalenz lag und an seiner Unwilligkeit, eine ausdrückliche Lüge zu erzählen (oder zumindest eine Halbwahrheit). Als er schließlich die Verantwortung dafür übernahm, den Therapeuten dazu bringen zu wollen, ihn als dankbar wahrzunehmen, konnte er seine Angst als die Wurzel des ganzen Ereignisses erkennen. Es ist wahr, daß seine erste Aussage sich auf das Schlagen seines Herzens und auf seine Angst bezog, aber da er jetzt von seiner Erwartung spricht, der Therapeut könne ihn angreifen, geht er tiefer auf die Substanz seiner Angst ein. Wenn man sich die Mitschrift noch einmal anschaut, scheint es logisch, anzunehmen, daß er in dem Moment von der Gegenwartsbezogenheit abwich, als er implizit begann, zu manipulieren, statt zu erfahren. Das bloße Bestehen auf eine Rückkehr in die Gegenwart hätte möglicherweise nur weitere Inhalte aus seinem oberflächlichen Bewußtsein zutage gebracht, aber nicht vermocht, die Funktion seiner Vermeidung zu enthüllen, die außerhalb seines Gewahrseins lag.
Das Gewahrseinskontinuum und die freie Assoziation
Der Platz, den das Mitteilen der gegenwärtigen Erfahrung in der Gestalttherapie einnimmt, ist durchaus der freien Assoziation in der Psychoanalyse vergleichbar. So ist der Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren gar nicht so deutlich, wie dies von den Definitionen her den Eindruck macht.
Im Prinzip betont die „freie Assoziation der Gedanken“ zwar das, was die Gestalttherapie am meisten vermeidet: Erinnerungen, Überlegungen, Erklärungen, Phantasien. In der Praxis jedoch kann der psychoanalytische Patient in seiner Kommunikation durchaus in erster Linie erfahrungsorientiert sein, während der Gestalttherapiepatient häufig von dem Gebiet der gegenwärtigen Sinneswahrnehmungen, des Fühlens und Tuns abschweift. Neben den Anleitungen, die dem Patienten in der Gestalttherapie gegeben werden, um seine Kommunikation auf das Gegenwärtige und den Bereich der unmittelbaren Erfahrung zu beschränken, gibt es einen weiteren Unterschied in der Einstellung des Therapeuten zur Verständigung mit dem Patienten.
Nehmen wir den Fall eines Patienten, der in Erinnerungen an ein angenehmes Ereignis schwelgt. Ein Analytiker wird möglicherweise zuerst den Patienten dazu anhalten, sich mit der Bedeutung des erinnerten Ereignisses auseinanderzusetzen. Der Gestalttherapeut wird darauf zu sprechen kommen, warum der Patient nicht über das spricht, was jetzt mit ihm geschieht, und, statt in der Gegenwart zu bleiben, lieber in Erinnerungen lebt. Mehr als mit dem Inhalt seiner Erinnerungen befaßt er sich damit, was er gegenwärtig tut: nämlich ein vergangenes Ereignis aktualisieren und darüber sprechen.
Auch der Analytiker kann sich jedoch mit der Gegenwart des Patienten befassen. In diesem Fall wird er wahrscheinlich dessen Erinnerungen entweder als Ersatzhandlung und Abwehrhaltung angesichts seiner gegenwärtigen Gefühle interpretieren oder als Schlüssel oder indirekten Hinweis auf seine aktuellen erfreulichen Gefühle. Der Gestalttherapeut hingegen wird Interpretationen für Botschaften an den analytischen Geist des Patienten halten, der sich von der Realität entfernen muß, um „darüber nachzudenken“. Er wird sich darum bemühen, die gegenwärtige Entfremdung der Erfahrung gegenüber, die aus Abstraktion und Interpretation resultiert, zu reduzieren. Daher wird er statt dessen die Fähigkeiten des Patienten als „Co-Phänomenologe“ nutzen, um statt des Theoretisierens oder Einordnens dieses Erinnerungsvorganges an ein angenehmes Ereignis ihn einfach nur wahrzunehmen. Das Gewahrsein des „ich erinnere mich an etwas Angenehmes“ ist bereits ein Schritt über das Erinnern hinaus, der einen Weg zum Verständnis des eigentlichen Motivs oder der Absicht hinter dem Prozeß eröffnet. So kann es beispielsweise zu der Erkenntnis fuhren, daß „ich dir das Gefühl vermitteln möchte, daß ich viele gute Freunde habe, damit du denkst, ich bin ein toller Kerl“, oder: „ich wünsche, daß ich mich ebenso wohlfühlen könnte wie damals. Bitte hilf mir dabei“, oder: „ich fühle mich im Augenblick sehr gut aufgehoben – fast wie damals“ und so weiter.
Wenn der Patient sich darüber im klaren wäre, was er tut, während er sich erinnert, Dinge vorwegnimmt und interpretiert, dann wäre eigentlich alles „in Ordnung“. Das Problem ist nur, daß solche Handlungen meistens eine gegenwärtige Erfahrung ersetzen, verdecken und dazu führen, daß sie ausagiert wird, statt sie zu erkennen und anzunehmen. Es ist also nicht „in Ordnung“, wenn die Handlungen aus der Annahme herrühren, daß etwas nicht stimmt, und daß unser Bewußtsein sich in ihnen verfängt, bis wir uns selbst vergessen.
Alan Watts schreibt dazu, daß nach einer Zeit der Übung des Lebens in der Gegenwart deutlich wird:
… daß es in der wirklichen Realität unmöglich ist, außerhalb dieses Augenblicks zu leben. Natürlich sickern unsere Gedanken an Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart ein, und in diesem Sinne ist es unmöglich, sich auf irgend etwas zu konzentrieren, außer auf das, was gerade geschieht. Wenn man jedoch versucht, einfach in der Gegenwart zu leben, indem man das reine „momentane“ Gewahrsein des Selbst kultiviert, entdeckt man in der Erfahrung ebenso wie in der Theorie, daß der Versuch unnötig ist. Wir lernen, daß das Zeitdenken des Egos keinen einzigen Moment mit dem ewigen und momentanen Bewußtsein des Selbst in Konflikt geraten ist. Tiefer als alle Erinnerungen, Zukunftsgedanken, Ängste und Wunschvorstellungen liegt jederzeit dieses Zentrum des reinen und unbewegten Gewahrseins, das sich zu keiner Zeit jemals von der gegenwärtigen Realität getrennt hat und daher niemals wirklich von der Kette der Träume gefesselt werden konnte.
Nachdem dies erkannt ist:
… wird es wiederum möglich, Erinnerungen und Zukunftsgedanken gewähren zu lassen und dennoch frei von ihrer bindenden Kraft zu sein. Denn sobald man in der Lage ist, auf Erinnerung und Zukunftsgedanken als etwas Gegenwärtiges zu schauen, hat man sie (und das Ego, welches sie bilden) objektiviert. Davor waren sie subjektiv, weil sie aus der Identifikation mit vergangenen oder zukünftigen Ereignissen, mit der zeitlichen Verkettung, die das Ego ausmacht, bestanden. Wenn man jedoch beispielsweise in der Lage ist, einen Gedanken an die Zukunft als etwas Gegenwärtiges zu betrachten, identifiziert man sich nicht mehr länger mit der Zukunft und trennt damit den Blickpunkt des Selbst von dem des Egos. In anderen Worten: Sobald die Identifikation des Egos mit der Zukunft als etwas Gegenwärtiges gesehen werden kann, sieht man es von einem Standpunkt, der dem des Ego übergeordnet ist: dem Standpunkt des Selbst. Daraus folgt, daß sobald das Zentrum unseres Bewußtseins sich auf den streng gegenwärtigen und momentanen Ausblick des Selbst verschoben hat, Erinnerungen und Zukunftsgedanken die peripheren und objektiven Bewegungen des Geistes leiten und unser Sein nicht mehr von der egoistischen Funktion des Denkens dominiert und identifiziert wird. Wir haben alle Ruhe und Gelassenheit, das schärfste Gewahrsein und die ganze Freiheit von der Bindung an die Zeit. Wir leben vollständig in der Gegenwart, jedoch ohne die absurde Einschränkung, sich nicht an die Vergangenheit erinnern und nicht für die Zukunft planen zu können.10
Die Übung des Gewahrseinskontinuums und Askese
Trotz dieser Feststellungen kann es als psychologisches Faktum gelten, daß ein Mensch sich kaum dauerhaft auf die Gegenwart konzentrieren kann, während er sich an etwas erinnert, wenn er nicht vorher unter den erleichterten Bedingungen des Entzugs von Erinnerungen einen Geschmack davon bekommen hat. Dasselbe gilt, nebenbei gesagt, auch für den Kontakt zur Erfahrung während des Nachdenkens. Gewöhnlich vertreibt das Denken die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung als denkendes Selbst und zur Wahrnehmung der Gefühle, die die Basis der Denkmotive bilden, ebenso, wie die Sonne die Wahrnehmung der Sterne verhindert. Die Erfahrung des Denkens, ohne sich in den Gedanken zu verlieren, ist ein Zustand, der am leichtesten herbeigeführt werden kann, indem man in Momenten der Abwesenheit von Gedanken Kontakt zur Grundlage der Erfahrung bekommt. Darin gleichen die Techniken der Gestalttherapie des Entzugs von Erinnerungen, Zukunftsgedanken und anderen Gedankeninhalten der Askese im allgemeinen: Bestimmte Deprivationen werden auf sich genommen, um mit dem in Kontakt zu kommen, was gegenwärtig durch die psychischen Bewegungen infolge der entsprechenden Situationen verdeckt wird. Demzufolge begünstigt der Entzug von Schlaf, Sprechen, sozialer Kommunikation, Komfort, Essen oder Sex angeblich den Zugang zu außerordentlichen Bewußtseinszuständen, aber ist kein Selbstzweck – außer in seiner kulturell verwässerten Form.
Die Übung der Aufmerksamkeit für den Strom des Lebens ähnelt der Askese im allgemeinen nicht nur deshalb, weil sie eine freiwillige Aufhebung der Ego-Befriedigung und einen Entzug beinhaltet, sondern auch dadurch, daß sie die Person mit der Schwierigkeit konfrontiert, auf eine Weise zu funktionieren, die den Gewohnheiten entgegenläuft. Da die Übung nichts anderes zuläßt, als die Inhalte des Gewahrseins auszudrücken, schließt sie die Funktionen des „Charakters“ – der Organisation der Bewältigungsmechanismen und sogar das Tun als solches aus. Darin erweist sich die Übung des Jetzt als Verlust des Ego, wie dies im Buddhismus hervorgehoben und von Watts in obenstehendem Zitat beschrieben wurde.
C) GEGENWARTSBEZOGENHEIT ALS MITTEL DER WAHL
Sind psychologische Techniken Rezepte zur Bewältigung des Alltags?
Nicht alles, was als psychologische Übung einen Wert hat, muß auch notwendigerweise für das Leben taugen. Freie Assoziation kann eine nützliche Übung sein, aber nicht unbedingt ein gutes Verfahren für ein persönliches Gespräch, ebenso wie der Kopfstand im Hatha Yoga nicht die beste Körperhaltung für die meiste Zeit des Tages ist. Psychologische Techniken haben ein mehr oder weniger großes Potential, um in den Alltag transportiert zu werden und das ganze Leben zu einer Gelegenheit zu innerem Wachstum zu machen. Es ist jedoch nicht nur der individuelle Wert eines bestimmten Verfahrens, der für seine Alltagstauglichkeit entscheidend ist, sondern auch seine Verträglichkeit mit anderen erstrebenswerten Zielen im Leben, der Grad der Konfrontation, den es mit der existierenden sozialen Struktur bewirkt, und besonders seine Verträglichkeit mit der Vorstellung von einer guten Gesellschaft. So kann beispielsweise das Abreagieren von Feindseligkeit in einer psychotherapeutischen Situation wertvoll sein, aber trägt dieses Verfahren zur Optimierung der Gesundheit und des Wohlergehens in der Gesellschaft bei?
Ich glaube, die Meinungen darüber würden erheblich auseinandergehen, selbst in der Frage: „Was ist wahr, und was ist unwahr?“ Obwohl Aggression eher als unsozial gilt und in den Zehn Geboten steht: „Du sollst nicht töten!“, wird die Wahrheit gemeinhin als Tugend angesehen und die Lüge als Sünde. Man könnte daher erwarten, daß die Technik des offenen Selbstausdrucks – wertvoll im Kontext der Psychotherapie – ohne weiteres auf das Leben übertragbar wäre. Angesichts der gewöhnlichen Verfassung der Menschheit jedoch war und ist die Wahrheit nicht nur oft unbequem, sondern gelegentlich sogar gefährlich. Die Beispiele von Sokrates, Jesus Christus oder den Häretikern zur Zeit der Inquisition zeigen, daß eine bedingungslose Verpflichtung zur Wahrheit möglicherweise das Annehmen des Märtyrertums bedeutet, für das – so bin ich sicher – die Mehrzahl der durchschnittlichen Menschen nicht gerüstet ist. Der Wunsch, Gefühle zuzulassen, kann in Fällen, in denen die Gesellschaft solche Vorhaben nicht gestattet, einer der impliziten oder expliziten Beweggründe sein, um spezielle Gemeinschaften zu bilden für jene, die das gemeinsame Ziel eines Lebens der inneren Suche teilen. In solchen Gruppen, die manchmal im Geheimen wirken, suchen Menschen ein Leben gemäß Prinzipien, die nicht verträglich sind mit anderen, die nicht monastisch, therapeutisch oder auf andere Weise außergewöhnlich sind.
Humanistischer Hedonismus
Das Leben im Augenblick scheint im Gegensatz zu anderen Praktiken ein vollkommen angemessenes Rezept für das Leben zu sein. Darüber hinaus erscheint es eher wie die Systematisierung einer Lebensformel als wie die Verschreibung einer Technik. Die Idee einer Rezeptur mag Bilder suggerieren wie das eines übelriechenden Tonikums, das Kindern „zu ihrem Besten“ eingeflößt wurde, bevor die Zeit von Gelatinekapseln und der Geschmacksstoffchemie angebrochen war. Dies ist Teil eines dualistischen Weltbildes, in dem „die guten Sachen“ etwas anderes zu sein scheinen als das, was „uns guttut“, und das Ziel der Selbstvervollkommnung etwas anderes als „bloß zu leben“.
Dies ist jedoch nicht das, was die klassischen Anwendungen der Konzentration auf die Gegenwart vermitteln. Nehmen wir beispielsweise König Salomos: „Iß freudig dein Brot, und trink vergnügt deinen Wein“ (Prediger 9,7) oder die spätere Version desselben Gedankens im Zweiten Paulusbrief an die Korinther: „Laßt uns essen und trinken, denn morgen werden wir sterben“.
Der Charakter dieser Äußerungen ist ebenso hedonistisch wie die meisten Aussagen, die sich mit dem Wert des Gegenwärtigen beschäftigen. Und wie sollte es auch anders sein, denn wenn der Wert der Gegenwart nicht in etwas Zukünftigem liegt, dann muß er intrinsisch sein: Die Gegenwart muß ihre eigenen Belohnungen enthalten.
Heutzutage scheint der hedonistische Blickwinkel sich von der Religiosität getrennt zu haben und ihr sogar zuwiderzulaufen – ebenso wie er auch allgemein im Leben nicht unbedingt empfehlenswert zu sein scheint. Da „Körper“ und „Geist“ als unvereinbare Werte betrachtet werden, gelten Idealismus und Spiritualität als entsagungsvoll und todernst, während die Vertreter der Lebenslust häufig zynische Pragmatiker und hartnäckige und unverbesserliche „Realisten“ sind. Das war anscheinend jedoch nicht immer so, und wir wissen, daß es Zeiten gab, in denen religiöse Feste regelrechte Freudenfeste waren. Wenn wir in der Bibel lesen: „Laßt uns essen und trinken, denn morgen werden wir sterben“, dann sollten wir diesem Satz nicht unsere gegenwärtige Trennung von Körper und Geist überstülpen und auch nicht jene amüsiersüchtige Haltung, für die solche Aussagen immer wieder herhalten müssen. Ursprünglich stand dahinter eine Lebenshaltung, gemäß der ein erfülltes Leben in der Gegenwart eine heilige Handlung war, ein Weg in Übereinstimmung mit dem göttlichen Willen.
Nur selten finden wir diese Balance von Transzendenz und Immanenz im westlichen Denken, mit der Ausnahme jener bemerkenswerten Individuen, die jedoch zu ihrer Zeit eine eher beiläufige Rolle gespielt haben –Häretiker für die religiösen und Narren für die gewöhnlichen Menschen. William Blake zum Beispiel war ein solcher Mensch, wenn er postulierte: „Die Ewigkeit ist voller Liebe für die Werke der Zeit“.
Sogar in der Psychoanalyse, die in der Praxis viel für das „Es“ der Menschheit getan hat, wird auf das „Lustprinzip“ als etwas Kindisches und Lästiges herabgeschaut, das ein „reifes“ wirklichkeitsorientiertes Ego unter Kontrolle halten muß.
Im Gegensatz dazu sieht die Gestalttherapie eine viel stärkere Verbindung zwischen Lust und Lebensqualität, und man könnte ihre Philosophie, im Sinne der guten alten Hedonismen der vorchristlichen Zeit geradezu hedonistisch nennen. Ich möchte hier den Begriff eines „hedonistischen Humanismus“ einführen, der nicht notwendigerweise eine theistische Haltung beinhaltet und dennoch diese Einstellung von dem hedonistischen Egoismus eines Hobbes, dem utilitaristischen Hedonismus eines J.S. Mill und von dem der gewöhnlichen Lustsucher unterscheidet. (Wer sich an dieser Stelle fragt, wie die Gestalttherapie gleichzeitig asketisch und hedonistisch genannt werden kann, dem sei gesagt, daß Epikurs Vorstellung von einem höchst angenehmen Leben im wesentlichen zwei Voraussetzungen hatte: die Möglichkeit zur philosophischen Reflektion und eine einfache Ernährung aus Brot, Milch und Käse.)
Carpe diem
Die hedonistische Denk- und Lebensweise ist untrennbar mit einem tiefgehenden Einlassen auf die Gegenwart verbunden, und das nicht nur in der Gestalttherapie, sondern auch im Denken vieler Menschen (hauptsächlich Dichter und Mystiker), die ein ähnliches Rezept für ein gutes Leben ausgaben. Am deutlichsten hat dies möglicherweise Horaz vertreten, dessen Devise carpe diem (Ergreife den Tag!) zum Inbegriff eines Motivs geworden ist, das sich durch die gesamte Literaturgeschichte zieht. Hier ist die Äußerung in ihrem ursprünglichen Kontext:
Dum loquimur fugerit invida aetas:carpe diem, quam minimum credula postero.
Da wir bloß reden,
wird entflohen sein die Zeit des Neides:
so pflücke den Tag,
vermeide leichtgläubiges Hoffen auf morgen.
(HORAZ)
Horaz’ Gegenwartsbezogenheit geht mit seiner Wahrnehmung der fliehenden „Zeit des Neides“ einher: der unwiederbringliche Verlust des Lebens, der die Alternative zu einem Leben in der Gegenwart ist. In der biblischen Anweisung, zu essen, zu trinken und es sich gutgehen zu lassen, ist ebenfalls der Tod das Argument und zugleich der Lehrer. Dasselbe gilt für zahlreiche andere Spruchweisheiten, wie die in Ovids „Die Kunst der Liebe“:
Carpite floremQui nisi carptus erit turpiter ipse cadet
Pflücke die Blume,
denn pflückst du sie nicht, wird sie welken und vergehen.
Gather therefore the rose whilestyet is prime,
For soon comes the age what will her pride deflowre;
Gather the rose of love whilest yet is time,
Whilest loving thou mayst love be with equal crime.
SPENSER: THE FAERIE QUEENE
Pflücke die Rose dann, wenn sie blüht,
schon bald kommt die Zeit, da wird sie ihrer Pracht beraubt;
pflücke die Rose der Liebe in deiner Zeit,
wenn du liebst, dann ergehe dich in Liebe genauso weit.
(SPENSER: THE FAERIE QUEENE)
Make use of time, let not advantage slip;
Beauty within itself should not be wasted;
Fair flowers that are not gathered in their prime,
Rot and consume themselves in little time.
SHAKESPEARE: VENUS UND ADONIS
Nutze die Zeit, laß den Vorteil nicht enteilen;
Schönheit in Schönheit soll nicht unnütz verweilen;
Anmut der Blumen, die nicht in ihrer Blüte gebunden,
Welkt im Nu und ist verschwunden.
(SHAKESPEARE: VENUS UND ADONIS)
If you let slip time, like a neglected rose
it withers on the stalk with languished head.
MILTON: COMUS
Laß die Zeit nicht entgleiten, sonst
welkt sie am Stock dahin,
wie eine vergeßne Rose
mit hängendem Kopf.
(MILTON: COMUS)
Die Konzentration der Gestalttherapie auf die Gegenwart ist untrennbar von ihrer Wertschätzung für Bewußtheit an sich, die ihren Ausdruck im Aufgeben der Vermeidungsstrategien findet, an denen unser Leben krankt. Der Gegenwart nicht aus dem Weg zu gehen, heißt, es nicht zu vermeiden, in ihr zu leben – wie wir es alle zu häufig tun, in dem Versuch, den Folgen unseres Handelns aus dem Wege zu gehen. Insofern, als die Konfrontation mit der Gegenwart eine Hingabe an das Leben ist, bedeutet sie auch Freiheit: die Freiheit, wir selbst zu sein, gemäß den Vorlieben unseres Seins zu wählen: unseren Weg zu wählen. Die Begegnung mit der Gestalttherapie kann die Erfahrung ermöglichen, daß die Gegenwart, wenn man sich ohne auszuweichen und im Geist der Lebensfreude auf sie einläßt, zu dem wird, was John Dryden in ihr sah:
This hour’s the very crisis of your fate,
Yourgood and ill, your infamy of fame,
And the whole colour of your life depends
On this important now.
THE SPANISH FRIAR
Die Stunde jetzt ist deines Schicksals Gipfel,
dein Gut und Schlecht, deine Schande, dein Ruhm,
die Farbe deines ganzen Lebens
hängt an diesem
bedeutsamen
Jetzt.
(THE SPANISH FRIAR)
Es dreht sich um das Jetzt, aber wir erkennen es nicht in unserem halbherzigen Lebensstil. Statt dessen funktionieren wir das Leben zu einem tödlichen Ersatz seiner selbst um. Wir „schlagen die Zeit tot“ oder ziehen uns jenen „Verlust der Zeit“ zu, der laut Dante „weise Menschen höchst verärgert“. Ebenso deutlich erscheint dieser Aspekt des Lebens in der Gestalttherapie in dem Begriff der Verschlossenheit. Ebenso wie sich in der Gestaltpsychologie Verschlossenheit auf die Wahrnehmung bezieht, so bezieht sie sich in der Gestalttherapie auf das Handeln:
Wir wollen ständig das Unfertige, die unvollendete Gestalt, vollenden und vermeiden dennoch gleichzeitig, es wirklich zu tun. Durch unser Unvermögen, in der Gegenwart zu handeln, erhöhen wir das Maß des Unvollendeten und steigern unsere Verpflichtungen gegenüber der Last unserer Vergangenheit. Horaz drückte es in einer seiner Episteln folgendermaßen aus:
„Derjenige, welcher die Stunde des Lebens vor sich herschiebt, ist wie der Bauer, der darauf wartet, daß der Fluß wegfließen möge, bevor er ihn überquert; doch er fließt weiter und wird ewig weiterfließen.“
Möglicherweise würden wir uns dem Leben in der Gegenwart nicht verschließen, wenn wir nicht ständig von zukünftigen Handlungen oder Befriedigungen träumen würden. In diesem Zusammenhang stellt die Gestalttherapie ihren Realismus unter Beweis, indem sie sich an dem Greifbaren, Existierenden orientiert, statt an dem Begrifflichen, Symbolischen, nur in der Einbildung Existierenden. Nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit kann in der Gegenwart nur als Gedankenform, Erinnerung oder Phantasie existieren. Die Gestalttherapie zielt auf die Unterordnung dieser Formen unter das Leben ab. Diese Haltung findet ihren Ausdruck in einem Gedicht von Longfellow:
Trust no future, howe’er pleasant,
Let the dead Past bury its dead!
Act, act in the living Present!
Heart within and God o’erhead.
Trau nicht der Zukunft, wie angenehm auch immer,
laß die tote Vergangenheit ihre Toten begraben!
Handle, handle im lebendigen Jetzt!
Herz im Innern und über dir Gott.
(LONGFELLOW)
wie auch in dem persischen Sprichwort:
Ergreife die Jetztzeit, denn niemals wirst du
mit dem verflossenen Wasser die Mühle antreiben.
oder einem weiteren, demnach
Derjenige, welcher die Zeit besitzt und dennoch nach besseren ZeitenAusschau hält, die Zeit verliert.
Alle diese Aussagen beziehen sich auf die Vorstellung der Unterschiedlichkeit eines Lebendigseins in der Gegenwart auf der einen und einer ereignislosen (und daher vergleichsweise unrealen) Vergangenheit und Zukunft auf der anderen Seite:
Nothing is there to come, and nothing past,
But an eternal now does always last.
ABRAHAM CAWLEY
Nichts wird da kommen, nichts ist vergangen,
doch ein ewiges Jetzt
wird immer dauern.
(ABRAHAM CAWLEY)
Vieles entgeht uns im Leben allein dadurch, daß wir Substanz durch Symbole ersetzen, Erfahrungen durch geistige Konstrukte, Wirklichkeit durch Reflektion über die Wirklichkeit im Spiegel des Intellekts. Das Aufgeben von Vergangenheit und Zukunft zugunsten einer andauernden Gegenwart ist ein Aspekt des gestalttherapeutischen Slogans: „Lose your mind, and come to your senses“.
D) GEGENWARTSBEZOGENHEIT ALS IDEAL
Der den rechten Augenblick ergreift
Das ist der rechte Mann.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
Der Begriff des „Ideals“ bedarf einiger Erläuterung. Ideale haben häufig den Beigeschmack von Pflichterfüllung und/oder eines Gutseins an sich, die der Philosophie der Gestalttherapie fremd sind.
Wenn wir dem Ideal das „Sollte“ und „Müßte“ nehmen, bleibt von ihm nichts weiter übrig als eine Aussage über das erwünschte Mittel zu einem bestimmten Zweck, das heißt ein Hinweis, oder ein „angemessenes“ Verhalten. Damit meine ich den Ausdruck von Gutsein, und weniger einen Weg oder ein Verbot: ein Zeichen oder Symbol für eine optimale Lebensbedingung. In diesem Sinne spricht man beispielsweise von den „Idealen“ des Taoismus, obwohl es sich um eine Philosophie des Nicht-Strebens handelt. Trotz seiner Freiheit von Geboten beschreibt das Tao Te King ständig die Wesenszüge des Weisen: „Aus diesem Grund kümmert sich der Weise um den Bauch und nicht um die Augen“ oder: „Der Weise ist frei von Krankheit weil er die Krankheit als Krankheit erkennt“ oder: „Der Weise weiß, ohne hinauszugehen“ und „erfüllt, ohne zu handeln“. In demselben Sinne gilt die Gegenwartsbezogenheit als ein Ideal, wenn es in einem englischen Sprichwort heißt: „Jetzt ist die Parole des Weisen“.
Einige Hinweise für ein besseres Leben sind zwar Mittel zu einem bestimmten Zweck, unterscheiden sich aber qualitativ von einem solchen Zweck. Dies gilt jedoch nicht für die Gegenwartsbezogenheit. Für diese (wie für die Gestalttherapie im allgemeinen) gilt, daß das Mittel zum Zweck darin besteht, sofort und ohne zu zögern den erwünschten Zustand einzunehmen: das Mittel, um glücklich zu sein, ist, jetzt glücklich zu sein, der Weg zur Weisheit ist, die Beschränktheit in diesem Moment abzulegen – ebenso wie der Weg zum Schwimmen darin besteht, schwimmen zu lernen. Das Rezept zum Leben im Jetzt ist daher die Konsequenz der Tatsache, daß wir nur im Jetzt leben, und dies ist etwas, was jeder gesunde Mensch weiß, aber der Neurotiker nicht erkennt, während er in einer traumartigen Pseudoexistenz verwickelt ist.
Im Buddhismus ist das Jetzt nicht bloß eine spirituelle Übung, sondern die Lebensform des weisen Menschen. In einer Passage des Pali Kanon spricht Buddha erstmals die Anweisung aus:
Häng dein Herz nicht an vergangene Dinge
und hege keine Hoffnungen für die Zukunft:
Die Vergangenheit hast du längst verlassen,
die Zukunft liegt noch vor dir.
und dann das Ideal:
Doch wer klar und deutlich im Auge hat
die Gegenwart, die hier und jetzt ist,
ein solcher Weiser ist auf das eingestellt,
was niemals verlorengehen oder erschüttert werden kann.
Während die buddhistische Version des Jetzt-Gebotes den Illusionscharakter der Alternativen betont, legt die christliche Perspektive Wert auf Vertrauen und Hingabe, die zu einer Verwurzelung in der Gegenwart führen. Wenn Jesus sagt: „Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen“ und wenn er das Beispiel der Lilien auf dem Felde (Matthäus 6) anführt, dann meint er damit nicht: „Handelt nicht aufgrund der schlimmsten Erwartungen“, sondern er drückt es positiver aus: „Habt Vertrauen!“. Während die christliche Version in eine theistische Vorstellung vom Universum eingebettet ist und Vertrauen immer Vertrauen in den himmlischen Vater meint, kann man die Grundhaltung doch als dieselbe wie das Ideal in der Gestalttherapie betrachten, das man als Vertrauen in die eigene Fähigkeit beschreiben könnte, mit dem Jetzt umzugehen, wie es kommt. Darin sehen wir, daß die Idee der Gegenwartsbezogenheit mit Erfahrung zu tun hat und weniger mit Manipulation, mit Offenheit und Akzeptanz des Erlebten, statt mit Festhalten und Verteidigen angesichts neuer Möglichkeiten. Solche Haltungen verdeutlichen zwei Grundvoraussetzungen der Weltanschauung der Gestalttherapie:
1. Nur so und nicht anders können die Dinge im Augenblick sein, und
2. Achtung! Die Welt ist sehr gut!
Wenn die Gegenwart nicht anders sein kann, als sie ist, wird der Weise nichts anderes tun, als sich auf sie einzulassen. Und wenn darüber hinaus die Welt auch noch gut ist, warum dann nicht, wie Seneca es ausdrückt, „freudig die Gaben der gegenwärtigen Stunde entgegennehmen und allen Groll vergessen“. Von irgend etwas zu sagen, es sei gut, ist natürlich eine Aussage, die der Gestalttherapie fremd ist, denn sie geht davon aus, daß etwas nur gut für uns sein kann. Das wiederum hängt davon ab, was wir aus unserem Leben machen. Die Existenz, wie wir sie gegenwärtig erleben, ist jedoch voller Leid, Hilflosigkeit und Unterdrückung. Wie Edmund Burke vor mehr als zweihundert Jahren feststellte, „Sich über die Zeit, in der wir leben, zu beklagen, die gegenwärtigen Inhaber der Macht schlechtzumachen, der Vergangenheit nachzuhängen und sich extravagante Hoffnungen auf die Zukunft zu machen, sind die häufigsten Übel eines Großteils der Menschheit.“
Aus der Sicht der Gestalttherapie sind solche Klagen und Beschwerden nichts weiter als ein schlechtes Spiel mit sich selbst – ein weiterer Aspekt der Ablehnung der möglichen Glückseligkeit des Jetzt. Im tiefsten Inneren sind wir, wo wir sein wollen, tun, was wir tun wollen, selbst wenn es letztlich auf eine scheinbare Tragödie hinausläuft. Wir können in unserer Sklaverei unsere Freiheit entdecken und unter dem Mantel des Zwanges unsere tiefste Freude.
Der gesamte Prozeß der Entfremdung von der Gegenwart als der Wirklichkeit, wie sie im ewigen Jetzt gegeben ist, kann als ein Mangel an Vertrauen gesehen werden, daß alles gut wird. Statt dessen stellt man sich etwas Katastrophales vor oder bestenfalls eine Leere, die wir zu füllen versuchen, indem wir uns ein Paradies aus Idealen und Zukunftserwartungen oder einer glorifizierten Vergangenheit vorstellen. Von solchen „Idolen“ aus schauen wir auf unsere gegenwärtige Lebenswirklichkeit herab, die niemals an unsere Konstrukte heranreicht und daher niemals vollkommen genug erscheint. So verbindet sich die Frage der Gegenwartsbezogenheit mit dem Annehmen des Erlebten im Gegensatz zu seiner Be- und Verurteilung. Wie Emerson schrieb:
Jene Rosen unter meinem Fenster haben nichts mit früheren, möglicherweise noch schöneren Rosen zu tun. Sie sind, was sie sind. Sie existieren mit Gott, heute. Sie haben nichts mit der Zeit zu tun. Es gibt nur „die Rose“. Sie ist vollkommen in jedem Augenblick ihrer Existenz… aber der Mensch weist sie ab und lebt in Erinnerungen… er kann solange nicht glücklich und stark sein, bis auch er mit der Natur in der Gegenwart, über der Zeit lebt.11
Auf der Suche nach der idealen Rose sehen wir nicht, daß jede Rose die äußerste Vervollkommnung ihrer selbst ist. Aus Angst, wir könnten nicht die Rose finden, die wir suchen, hängen wir dem Inbegriff der „Rose“ nach und merken niemals, daß „eine Rose eine Rose eine Rose ist“. Nur unsere Unersättlichkeit und Ungeduld hindern uns daran, die Ersatzfunktion fallenzulassen, durch die wir uns mit einem Abklatsch der Wirklichkeit in Form eines Versprechens oder einer Möglichkeit begnügen und gleichzeitig davon abgehalten werden, uns an ihrer Gegenwart zu erfreuen. Die Vorstellung eines Verlorenen Paradieses und des Gelobten Landes sind zwar besser als eine totale Gefühllosigkeit, aber weit von der Erkenntnis entfernt, daß diese direkt vor unseren Augen liegen. Khayaam wußte, wovon er sprach:
Sie sagen, Eden sei mit Houris wie mit Juwelen besetzt;
ich antworte, der Traubennektar hat keinen Preis –
So belache den Langzeitkredit, nimm die Münze,
trotze den fernen Trommeln, die dein Begierdeohr betören.
Und:
Kümmere dich nie um die Sorgen von morgen.
Lebe stets im paradiesischen Jetzt –
das sich schon bald der Fügung treu
den anderen auf siebentausend Jahre vergangenen
hinzugesellt;
Einer nach dem anderen verschwinden meine Zechkumpanen,
unschuldige Opfer eines flüchtigen Todesstreichs.
Alle waren ehrbare Trinker, doch versagten alle;
zwei Runden vor der letzten leerten sie den Krug nicht mehr.
Steh auf, warum die flüchtige Menschenwelt beweinen?
Verbringe dein Leben in Dank und Freude ganz und gar.
Wäre die Menschheit befreit von Schoß und Grab,
wann wäre denn deine Stunde gekommen, zu leben, zu lieben?
Laß keinen Schatten von Bedauern dich umwölken,
keinen Kummer sinnlos deine Tage verdunkeln.
Verzichte nie auf Liebeslieder, Wiesen oder Küsse,
bis dein Lehm sich wieder mit dem älteren Lehm vermischt.12
8 Nyaponika Thera, The Heart of Buddhist Meditation (London: Rider, 1962) p. 4l
9 Alan Watts, The Supreme Identity (New York: Farrar, 1957)
10 Ibid.
11 Zitiert von Watts
12 The original Rubayyat of Omar Khayaam, a new translation with critical commentaries by Robert Graves and Omar Ali-Shah (New York: Doubleday, 1968)