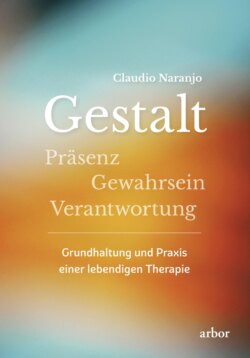Читать книгу Gestalt - Präsenz - Gewahrsein- Verantwortung: - Claudio Naranjo - Страница 8
ОглавлениеEinleitung des Autors
Es war 1966, als Michael Murphy auf der Wiese vor dem Hauptgebäude des Esalen Instituts auf mich zukam und mich bat, einen Artikel über Gestalttherapie zu schreiben, den er als Esalen-Monographie herausgeben wollte, was er schließlich auch tat. Er hatte vorher bereits Fritz Perls darum gebeten, der jedoch vorschlug, daß er statt dessen mich ansprechen sollte. Ich hatte damals an einigen seiner Seminare teilgenommen, und er würdigte meine Teilnahme unter anderem dadurch, daß er mir ein Dauerstipendium für seine Arbeit in Esalen gewährte. Ich nahm dieses Angebot freudig an, und das Ergebnis war meine erste englischsprachige Veröffentlichung. Dies war für mich ein besonderer Segen, denn ich entdeckte, daß ich mich in dieser Sprache leichter ausdrücken konnte, als ich vermutet hatte.
Zu jener Zeit gab es so gut wie keine Veröffentlichungen zum Thema Gestalttherapie, außer zwei von Fritz Perls’ frühen Büchern, einigen seiner Artikel und einer kurzen Erklärung von Van Dusen, in der er feststellte, daß die Gestalttherapie die schlüssigste therapeutische Anwendung der Phänomenologie sei. Darüber hinaus zirkulierten in der Zeit, in der ich an Perls’ und Simkins erstem professionellem Ausbildungsseminar in Esalen teilnahm, zwei weitere Aufsätze in vervielfältigter Manuskriptform: einer von Simkin selbst und ein anderer von John Enright. (Beide sind mittlerweile in chronologisch richtiger Reihenfolge in Stephensons Gestalt Therapy Primer1 erschienen.)
Diese mir zugeteilte Aufgabe war eine echte Herausforderung, denn ich war mir sehr bewußt, wie schwierig es ist, sich von der Lektüre von Perls’ beiden ersten Büchern, die Gestalttherapie in der Praxis vorzustellen. Durch eine Laune des Schicksals zählte ich zu den ersten, die Perls’ frühestes Buch über Gestalttherapie lesen durften, denn mein Onkel Ben Cohen, einer der Mitbegründer der Vereinten Nationen, erhielt, als Julian Press es in den fünfziger Jahren herausbrachte, vom Verlag ein druckfrisches Exemplar zur Ansicht zugesandt. Mein Onkel war damals für die Presse- und Informationsabteilung der Vereinten Nationen zuständig, und auf seinem Schreibtisch stapelten sich die verschiedensten Bücher aus den unterschiedlichsten Quellen. Daher reichte er gelegentlich Titel, von denen er annahm, daß ich ein besonderes Interesse an ihnen hatte, an mich weiter. Insbesondere bei Perls’ Buch stellte sich heraus, daß es einen erheblichen Einfluß auf meine spätere berufliche Laufbahn haben sollte – weniger in meiner Eigenschaft als Therapeut, sondern mehr als Forscher und Lehrer. Dennoch muß ich sagen, daß ich mir Perls aufgrund seiner Schriften – trotz der Übungen am Anfang des besagten Buches – als einen jungen Intellektuellen vorstellte und nicht als einen alten erfahrenen Praktiker. Ebensoweit war ich offenbar von der Realität entfernt, wenn ich mir die Praxis der Gestalttherapie vorzustellen versuchte. Jetzt erscheint es mir, daß Fritz hinsichtlich der therapeutischen Interaktion genial veranlagt, als Theoretiker jedoch weder begabt noch angemessen ausgebildet war. In seinen frühen Jahren verließ er sich daher weitgehend auf Kollegen mit eher theoretischen Neigungen, die seinen therapeutischen Ansatz in akademischen Kreisen vorstellten, in denen die Psychoanalyse die vorherrschende Doktrin war. Dennoch bin ich der Meinung, daß die Gestalttherapie von Anfang an ihre theoretischen Formulierungen bei weitem übertraf. Sie fand jedoch erst dann wirklich zu sich selbst, als Fritz sich später in seinem Leben vollkommen von dem „elephant shit“ der Theoretiker sowie von der Notwendigkeit befreite, seine Praxis durch akademische Rationalisierungen zu rechtfertigen.
Wahrscheinlich sah Fritz Perls in meinem Artikel eine bessere Darstellung seiner Arbeit als in seinen eigenen frühen Veröffentlichungen, denn ich sah ihn in den gesamten Jahren unserer Freundschaft niemals glücklicher als damals, als er mir erzählte, wie sehr er diesen Aufsatz schätzte – nicht einmal während jenes denkwürdigen Esalen-Meetings, bei dem er das Gefühl hatte, über Maslow gesiegt zu haben, und Abraham Levitsky ins Bein biß.
Als Fritz sich seinem siebzigsten Geburtstag näherte und Jim Simkin Beiträge für eine Festschrift ihm zu Ehren sammelte, verfaßte ich einen Aufsatz mit dem Titel: Present Centeredness – Technique, Prescription and Ideal (Zentriertheit in der Gegenwart – Technik, Anwendung und Ideal)2. Nachdem Fritz den Artikel gelesen hatte, machte er den Vorschlag, die beiden Aufsätze sowie weitere Beiträge in Form eines Buches zusammenzufügen. Trotz meiner Begeisterung für Arnold Beissers Theory of Paradoxical Intention (Theorie der paradoxen Intention) und Bob Resnicks Chicken Soup is Poison (Hühnersuppe ist Gift) ging die Verwirklichung des Projekts nur langsam voran. Als ich Fritz nach etwa einem Jahr in Chile wiedertraf, berichtete er mir, daß er mittlerweile den „Miami Girls“ (Fagan und Shepherd) vorgeschlagen hatte, eine solche Sammlung zu veröffentlichen, und ich entschloß mich, selbst ein Buch über die Gestalttherapie zu schreiben.
Ich glaube nicht, daß ich ohne diese Anregung dieses Buch überhaupt geschrieben hätte. Für das Werk eines fremden Autors zu schreiben, hätte bedeutet, weniger Zeit für die Beschreibung meiner eigenen persönlichen Arbeit zu haben. Auch hatte ich das Gefühl, daß alles, was ich über das, was ich bereits geschrieben hatte, hinaus hätte sagen können, zu offensichtlich erschien. Im Laufe der Jahre jedoch – nachdem ich gelesen hatte, was seit Fagan und Shepherds Gestalt Therapy Now geschrieben wurde – bekam ich den Eindruck, daß das, was mir offensichtlich erschien, für andere keineswegs so offensichtlich war.
Außer den ersten zwei Kapiteln wurde das vorliegende Buch in den Wochen verfaßt, die auf den Tod von Fritz Perls im Jahre 1970 folgten. Da mein einziger Sohn in den Big Sur Hills tödlich mit dem Auto verunglückte, während ich auf Fritz’ Beerdigung war, wurde dieses Buch in einer Zeit tiefer Trauer verfaßt. Die Tatsache, daß ich dieses Buch überhaupt in Angriff nahm, zeigt, wie wichtig es für mich in jener Zeit war, dieses „unerledigte Kapitel“ in meinem Leben zu Ende zu bringen. In erster Linie war dies eine Zeit, in der ich mich für eine Reise bereit machte, die, wie ich in der Einleitung zu Die Reise zum Ich erläuterte, eine Reise ohne Wiederkehr werden sollte. Ich hatte mich entschlossen, mich in einer Haltung vollkommener Hingabe, einem spirituellen Lehrer anzuvertrauen. Es schien mir, daß ich noch eine Schuld an meiner Vergangenheit zu begleichen hatte, bevor ich mich auf eine neue Stufe meines Lebens begeben konnte, frei von allen Lebensplänen und Verpflichtungen. Das Gestalttherapiebuch war eines meiner unvollendeten Projekte, und die Zeit nach Fritz Perls’ Tod schien mir geeignet zu sein, es in Angriff zu nehmen.
Obwohl die Reise, die ich 1970 in die chilenische Wüste unternahm, in einem gewissen, inneren Sinne tatsächlich als eine Reise ohne Wiederkehr erschien, kam ich 1971 zurück nach Berkeley und bot Stuart Miller, der damals die Esalen-Buchreihe des Viking Verlages betreute, das Gestalttherapiebuch an. Der Verlag hatte bereits einige meiner früheren Titel, The One Quest und Die Psychologie der Meditation3 veröffentlicht. Das Manuskript wäre auch längst gedruckt worden, wenn es nicht in einem Kopierladen verlorengegangen wäre. Seither war mein Leben sowohl innerlich als auch äußerlich so geschäftig, daß überhaupt nicht daran zu denken war, in alten Aktenordnern nach den Originalen zu kramen, aus denen das Buch wieder hätte zusammengesetzt werden können. Nur ein Teil des Buches wurde unter dem Titel Techniken der Gestalttherapie veröffentlicht, zuerst nur für meine Studenten in Berkeley, dann als Bestandteil von Hatcher und Himelsteins Handbook of Gestalt Therapy4 und schließlich im The Gestalt Journal.
Dennoch ist nun die Zeit gekommen, dieses so häufig unterbrochene und verschobene Werk vor dem Hintergrund anderer Projekte Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist wieder einmal, wie damals 1969 und 1970, Zeit, die Früchte meiner Arbeit zu ernten, wobei ich nicht nur damit beschäftigt bin, neue Bücher zu schreiben, sondern auch damit, alte fertigzustellen.
Neben den Kapiteln, die zu der früheren Version von Die Grundhaltung und Praxis der Gestalt Therapie gehören, stelle ich unter dem Titel Gestalt Therapie in neuem Licht eine Reihe von Statements vor, die in die Zeit einer Rückkehr zur Psychotherapie gehören, die sich an meine kurze, aber zutiefst lebensverändernde Pilgerfahrt nach Südamerika anschloß. Während ich in dem Buch von 1970 im wesentlichen meine Erfahrung der Gestalttherapie mit Perls und Simkin schilderte, enthält die spätere Sammlung von Essays einen kürzeren persönlichen Beitrag: der grundlegende transpersonale Aspekt von Gestalt, eine Kritik der „Löcher“ in dem Ansatz dieser Therapieform, einige Erläuterungen meiner späteren klinischen Arbeit, eine Schilderung meiner Einstellung bezüglich therapeutischer und ausbildungsbezogener Übungen einschließlich einiger besonderer Einblicke in meine persönliche „Trickkiste“ sowie Überlegungen zu Übereinstimmungen zwischen Gestalt und einigen spirituellen Traditionen. Die ersten drei dieser Aufsätze sind bereits im The Gestalt Journal erschienen (der zweite ist ein überarbeitetes Transkript der Eröffnungsansprache der Baltimore Conference 1981). Zwei weitere gehen aus Vorträgen hervor, die ich auf der Zweiten Internationalen Gestaltkonferenz in Madrid 1987 gehalten habe, während das Kapitel über Gestaltübungen – meine besondere Spezialität – eigens für dieses Buch geschrieben wurde. Kurz vor Drucklegung entschloß ich mich, ein weiteres Kapitel hinzuzufügen: Gestalt nach Fritz, das sich mit der Geschichte der Gestaltbewegung auseinandersetzt. Es beruht auf einem Vortrag, den ich auf der Vierten Internationalen Gestaltkonferenz in Siena 1991 hielt, und bedarf keiner weiteren Erläuterung.
Trotz dieser Ergänzungen gibt es jedoch noch ein Thema, das in diesem Buch fehlt: In meiner Besprechung der Lebensphilosophie, die der Gestalttherapie zugrundeliegt, habe ich es versäumt, das Vertrauen in die Selbstregulierungskräfte des Organismus zu erwähnen. Ich habe gesagt, daß Gestalt (von Seiten des Patienten) aus fünfzig Prozent Aufmerksamkeit und fünfzig Prozent Spontaneität besteht. In dem Kapitel „Integrationstechniken“ habe ich jedoch mehr das Gewahrsein als die Spontaneität betont.
Fritz Perls’ Vertrauen auf die Selbstregulierung des einzelnen ist für die moderne Psychotherapie von ähnlich wichtiger Bedeutung wie Rogers’ Vertrauen auf die Selbstregulierung von Gruppen: Beider Haltung war unabhängig von den Abgrenzungen verschiedener Strömungen und hat die psychotherapeutische Praxis durch ihren Einfluß, der verschiedene Ansätze vereinigte, nachhaltig geprägt.
Ich habe eine umfangreiche Textsuche nach dem Ausdruck „organismische Selbstregulierung“ in den Titeln und Abhandlungen von zweihundert psychologischen und medizinischen Zeitschriften angestellt, die seit 1966 erschienen sind, und es erscheint mir sehr kennzeichnend, daß die Formulierung kein einziges Mal auftaucht. Es war sicherlich Fritz Perls, der den Ausdruck populär machte, und er gebrauchte ihn auf eine Weise, die den Eindruck erweckte, als handele es sich um einen bekannten Begriff. Ich glaube, ich war nicht der einzige seiner Zuhörer, der sich in dem Glauben befand, er zitiere Sherrington oder Goldstein. Sicherlich war der Begriff seinen Hörern bekannt, und trotzdem war die unterschwellige Verwendung des Begriffs „Selbstregulierung“ im Sinne eines durch wissenschaftliche Autorität sanktionierten Konzeptes eher ein schamanistischer Taschenspielertrick. Das Vertrauen auf die Selbstregulierung des Organismus ist in der Gestalttherapie als Vertrauen auf die Spontaneität verkörpert – und diese wiederum geht Hand in Hand mit dem, was ich als „humanistischen Hedonismus“ bezeichnet habe. Das ist nichts anderes als eine biologische Übertragung des existentiellen Begriffs, „man selbst“ zu sein. In beiden Fällen ist ein Leben gemeint, das von innen heraus gelebt wird, im Gegensatz zu einem äußerlich orientierten Leben aus Gehorsam, Pflichtgefühl oder Sorge darum, wie man vor anderen erscheint. Die Ideale der Spontaneität und Authentizität beinhalten ein Vertrauen, das der innenwohnenden Vollkommenheit im Mahayana Buddismus und anderen spirituellen Traditionen ähnelt.
Es ist kennzeichnend, daß der Ort, an dem Fritz Perls die Blüte seiner Jahre erlebte und als der bekannt wurde, der er wirklich war – völlig losgelöst und fernab aller Konventionen –, das Esalen Institute war, ein Zentrum, das teilweise durch Alan Watts’ Hilfe und Unterstützung entstand und zu dessen ersten Bewohnern Gia-Fu-Feng gehörte, der damals viele Wände mit seinen wunderschönen Kalligraphien verzierte, Tai-Chi lehrte und uns später eine der zeitgemäßen Übertragungen von LaoTse schenkte. Diese äußeren Umstände kamen einer Vorliebe von Fritz für taoistische Ideen sehr entgegen, die sich in seinem Leben und Werk widerspiegeln. Wenn Fritz von „organismischer Selbstregulierung“ sprach, dann meinte er damit auch das „Tao“ zumindest im Sinne des „Tao des Menschen“, das die Taoisten vom überindividuellen „Tao des Himmels“ unterscheiden. Das „Tao des Menschen“ bezeichnet ein angemessenes, von Intuition, statt von Vernunft bestimmtes Handeln, das zudem eher dionysisch auf Vorlieben abzielt, statt im Sartreschen Sinne auf Gelegenheiten zu warten.
In seinem Festhalten an der Vorstellung von einer Selbstregulierung des Organismus stellte sich Perls nicht nur in die Nachfolge Freuds, der erstmals die schädlichen Folgen der Triebunterdrückung aufzeigte, sondern auch in die Wilhelm Reichs (seines Analytikers), der als erster mehr auf den Instinkt als auf die zeitgenössische Zivilisation vertraute. Anstelle eines eigenen Kapitels über die organismische Selbstregulierung in diesem Buch möchte ich die Thematik in dieser Einleitung umreißen, bevor ich auf das Thema Gewahrsein eingehe – ein Begriff, der für die innere Haltung der Gestalttherapie eine wichtige Rolle spielt und der vorwiegend dionysischen Qualität ihrer Ethik entspricht.
Ich habe unter der Rubrik „Theorie“ meine Aussagen über die Betonung der inneren Haltung im Gegensatz zu den Techniken der Gestalttherapie sowie meine Anmerkungen zur Gegenwartsbezogenheit zusammengestellt. Trotzdem habe ich es von Anfang an bewußt vermieden, dieses Buch „Theorie und Praxis der Gestalttherapie“ zu nennen. Die Wortwahl „Grundhaltung und Praxis“ beruht auf meiner Überzeugung, daß die Gestalttherapie nicht als die Anwendung eines theoretischen Lehrgebäudes entstanden ist, das man als ihre Grundlage bezeichnen könnte, sondern vielmehr mit einer bestimmten Weise des Daseins in der Welt zu tun hat.
Es ist in erster Linie Fritz Perls’ psychologische Perspektive, die mich interessiert, und natürlich könnten wir seine Sichtweise in allen Einzelheiten darstellen und darin – wie in Das Ich, der Hunger und die Aggression5 dargelegt – eine bestimmte Sichtweise des Ego als internem Störfaktor sowie als „Identifikationsfunktion“ entdecken. Wir würden darüber hinaus bestimmte Vorstellungen über das Selbst und seine Beziehungen finden, neben der Sicht des Organismus als offenes System innerhalb seiner Umwelt und dem ganzheitlichen Ansatz der Gestalttherapie. Obwohl wir all dies und mehr finden können, empfinde ich die psychologischen Vorstellungen Fritz Perls’ eher als den Kontext seiner Arbeit und weniger als die Grundlage, als Erläuterung, nicht als Skelett. Daher vermied ich bei der Darstellung Esalens und Herbert Ottos in I and Thou Here and Now (Ich und du hier und jetzt) Mitte der sechziger Jahre jegliche Begriffsdefinition (was von einem Kritiker in Etc.: The Journal of General Semantics besonders bemerkt wurde), indem ich die Gestalttherapie einfach als den „Ansatz, der seinen Ursprung in der Arbeit Fritz Perls’ hat“6, bezeichnete.
Als ich in den späten sechziger Jahren nach einem besseren Verständnis der „theoretischen Grundlagen“ der Gestalttherapie suchte, wendete ich mich an Gene Sagan (über den Fritz in den frühen Sechzigern sehr begeistert war und der dessen Verbindung zum Esalen Institut hergestellt hatte). Überraschenderweise sagte er mir, daß er der Meinung sei, daß die Gestalttherapie mehr mit der Stanislawski-Schule des Schauspiels zu tun habe als mit der Gestaltpsychologie. Ich stimme in dieser Beziehung noch immer mit ihm überein. Ebenso vertrat ich auf der Konferenz in Baltimore die Auffassung, daß Fritz eine wissenschaftliche Untermauerung der Gestalttherapie erst dann suchte, als er sie gegen akademische Kreise verteidigen mußte.
Ich bin weit davon entfernt, theoriefeindlich eingestellt zu sein, und habe erhebliche Einwände gegen die anti-intellektuelle Einstellung Fritz Perls’, die von vielen anderen übernommen wurde. Wenn die Gestalttherapie überhaupt eine Theorie braucht, dann ist sie nicht in einer Sammlung von Fritz Perls’ persönlichen Auffassungen zu finden, wie etwa: „Angst ist Erregung minus Atem“ oder: „zu sterben und wiedergeboren zu werden ist nicht einfach“, so tiefschürfend diese auch sein mögen. Der Psychotherapeut kann einen weitaus größeren Nutzen aus einem Verständnis der Psyche und des Wachstumsprozesses ziehen, als aus einer trockenen, spezifischen Gestalttheorie. Zumindest persönlich bin ich eher an einer Theorie von Gesundheit und Krankheit interessiert (um es anspruchsvoller auszudrücken: eine Theorie von Erleuchtung und Verdunkelung), die nicht nur die Inspirationen der Gestaltpsychologie zusammenbringen würde, sondern auch all das, was wir über Prägung, Psychodynamik und darüber hinaus über die Einflüsse der östlichen spirituellen Traditionen wissen.
Weniger ehrgeizig als ein solch umfassendes Unterfangen und dennoch relevanter als Paul Goodmans Versuch Mitte der fünfziger Jahre (jene „Gestalttheorie“, die durch die gegenwärtig sich entwickelnde Orthodoxie in der Gestalttherapie vereinnahmt wird) wäre eine „Theorie der Gestalttherapie“ – ein Vorhaben, vergleichbar mit der Theorie einer psychoanalytischen Therapie, die sich seit einiger Zeit als Alternative zur psychoanalytischen Theorie des Geistes entwickelt hat. Darüber habe ich in diesem Buch berichtet, ohne dies jedoch in den Vordergrund zu stellen, und meine Sicht kann in folgender Formel zusammengefaßt werden:
Gestalttherapie =(Gewahrsein/Natürlichkeit + Verstärkung/Konfrontation) Beziehung
In anderen Worten: Der therapeutische Prozeß beruht auf der Seite des Patienten auf zwei transpersonalen Faktoren: Gewahrsein und Spontaneität, während der Therapeut (wie ich im Kapitel über die Gestalt-Techniken zeigen werde) die authentischen Ausdrucksformen anregt und unterstützt und Pathologisches negativ verstärkt („Ego-Reduktion“). Soweit Psychotherapie überhaupt erlernt werden kann, bildet diese Aktivität der Anregung authentischen Verhaltens und des Ansprechens der Fehlfunktionen eine Strategie; soweit Therapie eine Funktion des Grades der Wesensentwicklung des Therapeuten ist, werden beide das spontane Ergebnis ungekünstelter Beziehung und individueller Kreativität sein.
1 Gestalt Therapy Primer: Introductory Readings in Gestalt Therapy, F. Douglas Stephenson, ed. (Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 1975)
2 in: Fagan and Shepherd: Gestalt Therapy Now
3 How to Be, Claudio Naranjo, Los Angeles: Jeremy Tarcher, 1991
4 The Handbook of Gestalt Therapy, edited by Chris Hatcher and Philip Himelstein, New Jersey: Jason Aronson, Inc., 1990
5 Das Ich, der Hunger und die Aggression, F. S. Perls
6 „Contributions of Gestalt Therapy“ in: Ways of Growth: Approaches to Expanding Awareness, edited by Herbert Otto and John Mann (New York: Grossman, 1968)