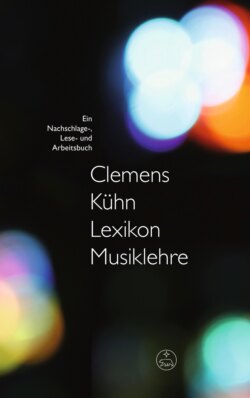Читать книгу Lexikon Musiklehre - Clemens Kühn - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|9| Introduktion: Musiklehre!
ОглавлениеVersuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen (1752), Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (I, 1753; II, 1762), Anleitung zur Singkunst (1757), Klavierschule, oder Anweisung zum Klavierspielen (1789): Die Lehrwerke aus dem 18. Jahrhundert von Johann Joachim Quantz, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Friedrich Agricola und Daniel Gottlob Türk stellen in ihren Titeln »spielen« und »singen« heraus, doch mit größter Selbstverständlichkeit vermitteln die Autoren umfassende Kenntnisse in Satztechnik, Kontrapunkt, Harmonielehre. Türks Klavierschule breitet auf knapp 100 Seiten nahezu den gesamten Stoff der Allgemeinen Musiklehre aus. Agricolas Singkunst bespricht anfangs zwölf Seiten lang die unterschiedlichen Tonleitern, wenig später schreibt er sogar 20 Seiten über den Schall, die Gegebenheiten der Luftröhre, die Entstehung des Stimmklanges. Leopold Mozarts Gründliche Violinschule (1756) behandelt Notenwerte, Schlüssel, Takt, Tempovorschriften, Skalen, Intervalle, Fachbegriffe.
Dass praktische Lehrwerke des 18. Jahrhunderts sich nicht mit ihrem Instrument oder mit der Stimme begnügen, sondern musiktheoretisches Wissen integrieren, ist verblüffend, wenn man dies mit später vergleicht, wo die Bereiche meist so säuberlich voneinander getrennt werden, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Schon Friedrich Wilhelm Marpurg (Abhandlung von der Fuge, I, 1753, S. IX) nahm eine Frontstellung der »theoretischen« und »practischen Tonkünstler« auf die Schippe:
Ein Grillenfänger, der bey dem Zirkel und Lineal grau geworden, […] siehet die Ausüber der Kunst mit einem verächtlichen Schulstolze an. Er thut keinen Griff auf dem Claviere, bevor er sich besonnen, dass die kleine Sexte in der proportione supertripartiente Quintas besteht. Ein blosser Practicus wiederum lachet den Theoreticus mit der Mine eines misgerathnen Petitmaitre aus. Nur mit der Geige oder einer feuchten Partitur in der Hand erhält man bey ihm Zutritt.
Dagegen steht bei Agricola (S. 168) ein hübsches Bild: »Wer aber nichts von der Composition versteht, der arbeitet im Finstern.« Doch |10| hinreißender als von dem Komponisten und Theoretiker Sethus Calvisius (1556–1615) ist die Bedeutung von Theorie wohl nie formuliert worden. Er empfiehlt allen, »die die Musik studieren«, besonders die »Lehre von den Tonarten« hochzuschätzen, und gibt diesen Satz hinzu:
Die Sänger aber, die die Tonarten nicht kennen, sind gleich einem Betrunkenen, der in ein Haus gelangt, aber nicht weiß, über welchen Weg er zurückgehen soll.