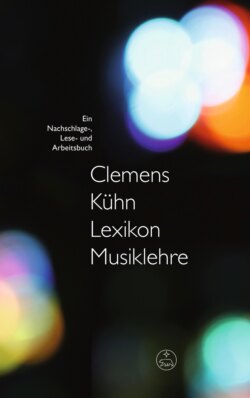Читать книгу Lexikon Musiklehre - Clemens Kühn - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B
ОглавлениеBarform ergibt sich aus der formalen Abfolge nach dem Muster a a b: Zwei melodisch gleichen oder leicht variierten Stollen (a) folgt ein – oft längerer – Abgesang (b). Die Barform war in alter Musik verbreitet, in mittelalterlichen Liedern, im Meistergesang des 15. und 16. Jahrhunderts, in älteren Choralmelodien (Jesus meine Zuversicht), vereinzelt in Volksliedern (Wie schön blüht uns der Maien). Die folgende schöne Melodie aus dem 17. Jahrhundert zieht nach dem zweiten (ebenfalls auf dem Ton fis in T. 8 offenen) Stollen so geschmeidig in den Abgesang hinein – textausdeutend mit großem Sprung zum melodischen, rhythmisch verbreiterten Höhepunkt (»Wol-ken«) –, dass in der Schwebe bleibt, wo der eine anfängt und der andere aufhört:
12
In klassisch-romantischer Musik, deren Formverständnis der Idee der Wiederkehr zuneigt (a b a), spielt die Barform so gut wie keine Rolle mehr. Dort aber, wo sie auftritt, hat sie besonderen Sinn. Schumanns Lied Ich hab’ im Traum geweinet aus dem Zyklus Dichterliebe sucht in |30| seiner musikalischen Reduktion und Regungslosigkeit seinesgleichen. Zwei musikalisch identische Strophen (»Stollen«) münden T. 25 in eine dritte Strophe. Ihr »Abgesang« stellt Klavier und Singstimme – bislang kahl nebeneinander – erstmals übereinander, bohrt die Stimme auf einem Ton fest (des2), unterlegt ihr dissonant geschärfte Klänge und am Ende einen Dominantseptakkord, bei der »Tränenflut« nach dem Erwachen: Der Gesangspart schließt harmonisch nicht, das Klavier kehrt zurück zu dem ersten kargen Partikel, mit dem es begonnen hatte. Die äußere Form ist innerlich begründet: Die Musik führt ins Offene. Die Tränen haben, im Traum wie im Wachen, kein Ende.
Basso continuo abgekürzt B.c., ist seit der Barockzeit in einem zwei- oder mehrstimmigen Satz die fortlaufende Bassstimme (ital. continuo = durchgehend), deren darunter gesetzte Ziffern dem Spieler angeben, welche Intervalle er über den Basstönen zu greifen hat (→Generalbass). Im Sinne dieser Begleitung spricht man auch nur vom Continuo und dem Continuo-Spieler.
Basston ist jener Ton, der in einem Akkord die tiefste Stimme abgibt. Vom Basston zu unterscheiden ist der Grundton, auf dem ein Akkord errichtet wird. Der Basston ist musikalisch dreifach wichtig:
1. Der Basston bestimmt die →Stellung eines Akkordes. Von ihr hängt wesentlich ab, wie ein Akkord wirkt: offen, stabil, weich …
2. Die Akkordnamen verdanken sich den Intervallen vom Basston her, gezählt in der engen Darstellung eines Akkordes. Der Klang e-g-c beispielsweise heißt Terz(e-g)-Sext(e-c)-Akkord und wird kurz »Sextakkord« genannt.
3. Die Unterscheidung von Basston und Grundton begründet Jean-Philippe Rameaus wichtige Lehre vom →Fundamentalbass: eine Theorie des tonalen Zusammenhalts von Musik, der sich der Abfolge der Grundtöne verdanke.
Bicinien sind zweistimmige Sätze, die im 16. Jahrhundert verbreitet waren, im Geist der »großen« Vokalpolyphonie erfunden, aber in der Stimmenzahl reduziert. Sie waren, als Zwiegesänge, primär zum Singen gedacht, als Musik für sich oder als klanglicher Kontrast (häufig als ein selbständiges »Duo« in einem mehrstimmigen geistlichen Werk). |31| Bicinien wurden aber auch mit Instrumenten gespielt – ein Tribut an die allmählich erwachende Instrumentalmusik. Dieser Anfang eines Biciniums von Orlando di Lasso (um 1532–1594)
13
zeigt jene typische Satztechnik, die ein Bicinium von der »großen« Vokalpolyphonie übernimmt:
Ein neues Wort oder Satzglied erhält einen neuen Gedanken: ein neues, vom Text her erfundenes →Soggetto. Hier sind es drei: zu »Sicut [wie] locutus est [er gesprochen hat] ad patres nostros [zu unseren Vätern]«. Sie unterscheiden sich nach ihrer Gestalt (Drehbewegung, Tonrepetition, Melisma nach Sprung), nach Ambitus und Ausdehnung (»ad patres nostros« ist in beidem umfänglicher), und sie werden von Halben über Viertel zu Achteln bewegter.
Die Stimmen imitieren einander (→Imitation).
Zäsuren werden in der Regel gemieden, um den Stimmfluss zu erhalten. Die einzelnen Imitationen greifen ineinander, indem jeweils eine Stimme liegen bleibt, bis die andere eingesetzt hat.
Anregungen zur Weiterarbeit
Wer sich eingehender mit diesem Satztypus beschäftigen möchte, sei auf zwei Sammlungen hingewiesen:
Singen wir aus Herzensgrund. 25 geistliche Lieder von Michael Praetorius (1571–1621), Kassel 1993
Bicinia sacra von Caspar Othmayr (1515–1553), kritisch revidierte Neuausgabe, hrsg. von Marco De Cillis, Köln 2010
Die Bicinien über geistliche Melodien gehen mit diesen jeweils völlig unterschiedlich um: Praetorius bearbeitet die Melodien so frei und schmückt sie derart aus, dass oftmals nur noch ihr Umriss bleibt. Man ist versucht, von »Paraphrasen« zu sprechen. Othmayr hält sich dicht an das melodische Original, seine Sätze sind kürzer und einfacher, doch bei entsprechenden eigenen Schreibversuchen merkt man, dass ihre Schlichtheit gar nicht so simpel ist …