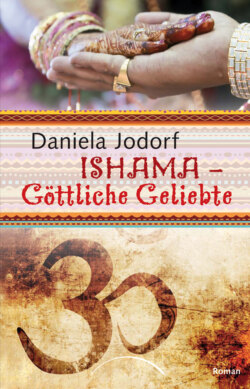Читать книгу Ishama - Daniela Jodorf - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Viertes Kapitel
ОглавлениеSchwester Irenes offenkundige Ablehnung verunsicherte mich und löste einen tiefen Schmerz in mir aus, der mein Herz umklammerte und sich in mir festzusetzen begann wie der Schmerz einer Wunde, die man nicht hinreichend gereinigt hatte. Gemeinsam mit Victor, Ian und Schwester Baquiya betrat ich nach der Visite das Besprechungszelt und kämpfte mit der Verletzung und der Wut darüber, dass mich Irenes Verhalten so sehr berührte. Plötzlich war es wieder da, das Gefühl, beobachtet zu werden. Glasklar, rein und völlig unberührt von allen Ereignissen fühlte ich die Bewusstheit des reinen Sehens auf mich gerichtet. Reflexartig blickte ich mich auch diesmal suchend nach einer Person um. Doch wie immer war auch hier niemand außer meinen Kollegen, die sich offenbar nicht beobachtet fühlten.
Panik ergriff mich. Bildete ich mir das alles nur ein? War ich dabei, verrückt zu werden? Stand ich kurz vor einem Nervenzusammenbruch? War das Gefühl, beobachtet zu werden, eine Dissoziation, eine Abspaltung von mir selbst? Mir wurde schwindelig. Mein Herz begann vor Angst zu rasen. „Beruhige dich, Ellen!“, sagte ich beschwichtigend zu mir. Ich begann, bewusst langsam zu atmen, versuchte, den Kontakt meiner Füße zum Boden zu spüren. Das war ein alter Trick aus den Anfängen meiner medizinischen Karriere. Mein erster Anatomie-Lehrer hatte ihn uns beigebracht, als während der ersten Sezierlektionen die Studenten reihenweise ohnmächtig wurden. Und tatsächlich, die Erdung wirkte. Der Schwindel löste sich auf, mein Herz schlug ruhiger.
Doch die beobachtende Präsenz war noch immer in unverminderter Stärke gegenwärtig. Vorsichtig wagte ich, mich ihr zu nähern, und versuchte für einen Augenblick, mit ihren Augen zu sehen. Es gelang mir jedoch kaum, denn diese Art der Betrachtung war mir völlig fremd. Sie war so kraftvoll und energiegeladen, dass ich wieder ein Gefühl des entwurzelnden Schwindels spürte. Doch es verflog rasch und ich schaffte es irgendwie, zu entspannen, loszulassen und die Bewusstheit zuzulassen. In diesem Moment sah ich mit den Augen dieses reinen beobachtenden Bewusstseins. Nichts, das ich je erlebt hatte, glich diesem Zustand, und doch war ich sicher, die Welt das erste Mal so zu sehen, wie sie wirklich war: unverstellt von meinen Vorstellungen, Wünschen, Hoffnungen und Ängsten. Ich betrachtete alles durch Augen, die völlig klar und absichtslos waren; bereit, jede Erfahrung so hinzunehmen, wie sie war – in sich vollständig und richtig in einem größeren Zusammenhang, der mir unendlich erschien. Ich sah Victor mit diesem Bewusstsein, spürte seine Sorgen und seine ganz persönliche Motivation, hier zu sein. Ian war hier, um seinem Vater zu beweisen, dass er mehr als ein flapsiger Junge war, der nichts ernst nahm. Schwester Baquiya hatte seit zwei Tagen kaum etwas gegessen, weil sie pausenlos arbeitete und nie an sich dachte.
Wie ein Fisch aus dem Wasser tauchte ich aus dem beobachtenden Bewusstsein wieder auf. Plötzlich war alles wie zuvor. Die innere Wand war wieder undurchsichtig, doch das beobachtende Gewahrsein blieb präsent.
Sobald die Besprechung vorbei war, lief ich ins Versorgungszelt und holte Schwester Baquiya einen Kaffee mit viel Zucker und ein gebuttertes Fladenbrot. Als ich ihr beides brachte, sah sie mich erstaunt und dankbar an.
Die Arbeit kostete mich heute viel weniger Kraft als sonst. Sie geschah eher automatisch als gewollt, eher selbstverständlich als durch jeglichen Aufwand eigener Willenskraft. Wir schafften zwei Operationen mehr als gewöhnlich und Ian scherzte selbst während einer schwierigen Beckenoperation ununterbrochen über meine übersinnliche Fähigkeit, scheinbar über Nacht kleine Kinder zu heilen. Ich selbst war trotz der Kraft und der eigenartigen Erlebnisse dieses Morgens innerlich vollkommen ruhig und ausgeglichen. Zum ersten Mal, seit ich meinen Job verloren hatte, war ich wieder im emotionalen Gleichgewicht.
Ich nutzte die kurze Mittagspause, um Niki anzurufen. Seit ich in Pakistan war, hatten wir nicht oft miteinander gesprochen. Ich hatte zu wenig Zeit und vermied das Gespräch mit ihm, weil ich mich bis heute unverstanden fühlte. Niki glaubte, dass meine Entscheidung für den Nothilfeeinsatz bedeute, unsere Beziehung sei mir nichts mehr wert. Ich hatte die neue Rolle abgelehnt, die er mir wohlmeinend als Alternative zu meinem alten erfüllten Berufsleben angeboten hatte: Ehefrau und Mutter. Er war verletzt, fühlte sich verraten und verlassen und gab mir die Schuld für diese Empfindungen.
Ich erreichte ihn um halb neun in seinem Büro. Er trank gerade den ersten Kaffee und las die Morgenpost. „Niki! Ich bins, Ellen!“
„Ellen!“ Er freute sich.
„Ich vermisse dich“, sagte ich aufrichtig.
Er mauerte. „Hier ist die Hölle los. Wir haben wahrscheinlich den Zuschlag für das neue Messegebäude in Frankfurt.“
„Gratuliere!“ Meine Kraft schwand. Niki war mir plötzlich vollkommen fremd. Sein beruflicher Erfolg berührte mich nicht. Er wirkte emotionslos, kalt und distanziert.
„Wir arbeiten Tag und Nacht und doch kommen immer neue Verletzte zu uns. Es nimmt einfach kein Ende.“
„Ihr macht das schon. Ihr seid gut ausgebildet und ausgerüstet“, gab er nüchtern zurück.
„Wir brauchen mehr Zelte und Heizöfen für die Obdachlosen. Der Winter beginnt bald.“
„Soll ich mich darum kümmern?“
„Das würdest du tun?“ Mein Herz schlug schneller vor Freude. Er war also doch bereit, meinen Weggang zu akzeptieren und sich für meine Sache einzusetzen.
„Ich habe da ein paar Kontakte. Aber ich kann dir nichts versprechen!“
„Danke, Niki.“
„Ich muss los. Wir haben gleich eine Besprechung.“
„Nik!“
„Ja?“
„Ich liebe dich.“
„Küsschen, Ellen. Ich melde mich.“
Mit dem Ende des Gespräches durchdrangen mich Kälte, Einsamkeit und Leere. Erst jetzt begriff ich, dass ich mit der Illusion hierher gefahren war, eines Tages nach Frankfurt und zu Niki zurückzukehren. Doch heute sah ich mit den klaren Augen des reinen Beobachters, der nichts will, was nicht ist, und der nichts nicht will, was ist. Unsere Beziehung war zu Ende und ich musste einen Weg finden, dies trotz dieser für mich schwierigen Zeiten zu akzeptieren, auch wenn dadurch mein letzter emotionaler Halt wegbrach. Es war meine Schuld, dass die Kluft zwischen Nik und mir unüberbrückbar geworden war. Ich war nicht in der Lage gewesen, ihm zu erklären, was ich erlebt und gefühlt hatte, als ich meinen Job verlor. Niki hatte hilflos mit ansehen müssen, wie ich in wenigen Tagen alles aufgab, was mir viele Jahre lang wichtig gewesen war: zuerst meine Arbeit und dann unsere Beziehung. Aber hatte nicht auch er mich viel zu schnell aufgegeben? Hatte Niki überhaupt versucht, mich zu verstehen? Was hatten wir außer Tisch und Bett wirklich geteilt, wenn meine Entscheidung für meine ganz persönliche Wahrnehmung und meine berufliche Zukunft das Ende unsere Liebe bedeutete?
Weinend setzte ich mich auf eine Bank im Versorgungszelt. Als ich aufsah, um mir die Nase zu putzen, sah ich Schwester Irene, die sich gerade einen Tee holte. Sie blickte zu mir herüber und bemerkte sofort meine Tränen und meine Trauer, doch sie sah wieder durch mich hindurch und verließ wortlos das Versorgungszelt. Kälte legte sich wie ein enges Band um meine Schultern, als ich von einem Weinkrampf regelrecht geschüttelt wurde.
Am Abend aß ich zusammen mit Ian. Ich war sehr schweigsam und in mich gekehrt und fürchtete, Ian könnte doch noch ein ernsthaftes Gespräch über die wundersame Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes unserer kleinen Patientin suchen. Doch er war feinfühlig und taktvoll wie immer mir gegenüber. Ich vertraute ihm wie keinem Zweiten hier. Nur deshalb schüttete ich ihm mein Herz über meine eigenartigen Erfahrungen mit Schwester Irene aus.
„Ist dir an Schwester Irene irgendetwas Komisches aufgefallen?“, fragte ich vorsichtig.
„An Irene? Nein, was meinst du?“
„Sie sieht mich manchmal so merkwürdig an.“
„Wie, merkwürdig?“
„So mitleidlos.“
„Mitleidlos? Hältst du dich für bemitleidenswert, meine Liebe?“
Ich lachte. „Nein, Ian. Hör mir doch mal zu! Heute zum Beispiel hat sie mich weinen sehen. Ich hatte das Gefühl, sie verachtet mich für meine Tränen.“
„Verachtung … Ellen, das ist ein sehr starkes Wort für eine sehr fleißige Schwester, die schon viel Erfahrung bei der Arbeit mit DoctorsAid hat.“
„Ich stelle ja nicht ihre Kompetenz in Frage. Sie ist wirklich gut und arbeitet sehr selbstständig. Aber sie sieht die Patienten manchmal so merkwürdig an. Ganz anders als Schwester Baquiya zum Beispiel.“
„Wie anders? Ich verstehe nicht was du meinst, Ellen.“
Ich suchte nach Worten, nach Bildern, nach Beschreibungen. „Schwester Baquiya sieht die Patienten fürsorglich, warmherzig und besorgt an. Aber Irenes Blick ist voller Kälte. Als sie mich heute Morgen im Kinderzelt fand, hat sie zum Beispiel gesagt, dass die Kinder lernen müssten, mit ihrem Schicksal allein fertigzuwerden. Das ist grausam, Ian.“
Ian schwieg nachdenklich, von meinem Bericht sichtlich ergriffen, ja fast geschockt. „Ja, das ist wirklich grausam. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Irene generell grausam ist. Vielleicht hatte auch sie eine schlechte Nacht. Wir alle haben hier schlechte Tage. Du weißt doch selbst genau, wie das ist.“
Ians Erklärungsversuch beruhigte mich nicht und reichte mir auch nicht. Doch er lenkte ab. „Warum hast du geweint, Ellen?“
Die Tränen wollten schon wieder aufsteigen, als ich Ian von meinem Telefonat mit Niki erzählte. „Ich bin fort, aber wir haben uns nicht getrennt. Keiner von uns hatte den Mut, es auszusprechen. Wir wollten endlich heiraten und Kinder kriegen und jetzt bin ich weit weg in einer anderen Welt, die Niki sich nicht einmal vorstellen kann. Wie soll es da eine gemeinsame Zukunft geben? Wann soll es die noch geben, Ian?“
„Ihr müsst darüber sprechen! Vielleicht fühlst du dich dann besser hier. Manchmal ist man erst frei, wenn die alten Brücken gänzlich abgebrochen sind – auch wenn es weh tut.“
„Hast du alle Brücken in Australien abgebrochen?“
„Nein. Das musste ich Gott sei Dank auch nicht. Ich bin seit einem Jahr allein. Und unser Krankenhaus in Brisbane hat ein Programm, das alle Ärzte dazu anhält, humanitäre Hilfe zu leisten. Ich bin für ein halbes Jahr freigestellt. Ich wollte endlich einmal etwas wirklich Sinnvolles tun.“
Ich dachte an Ians Vater und das schwierige Verhältnis, das die beiden zueinander haben mussten. Doch ich fragte Ian nicht danach. Es war nicht der richtige Zeitpunkt. Wir lernten uns gerade erst kennen.
„Ich wünsche mir noch immer, es wäre alles anders gekommen. Ich musste mein altes Krankenhaus verlassen“, gestand ich Ian zum ersten Mal. Ich hatte bisher nur mit Niki und meiner Familie darüber gesprochen.
„Warum?“
„Unüberbrückbare Differenzen nennt man das wohl.“
„Und die wären?“ Ian insistierte.
„Wir waren unterschiedlicher Ansicht über die Behandlung einer bei einem Verkehrsunfall verletzten Frau. Sie starb bei der OP.“ Mehr konnte und mehr wollte ich heute nicht sagen.
„Jedem von uns ist schon einmal jemand auf dem OP-Tisch gestorben.“
„Natürlich, Ian. Mir auch. Aber das war nicht das Problem. Ich wollte sie nicht operieren und ich habe nicht operiert.“
„Du wirst deine Gründe gehabt haben!“
Ich lachte, weil ich diesen Satz schon einmal gehört hatte. „Ja, die hatte ich, aber genau an diesen zeigten sich die unüberbrückbaren Differenzen. Ich musste gehen. Es gab keine Alternative.“
„Wenn du mich fragst, Ellen, kannst du das hier nur schaffen, wenn du dich mit deiner Vergangenheit versöhnst. Du hast das Richtige getan. Das weiß ich. Ich weiß, dass du ein Mensch bist, der das Richtige tut.“