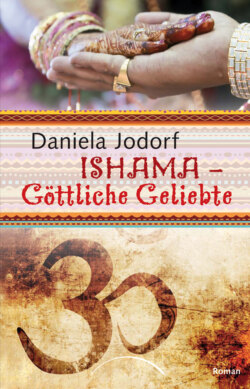Читать книгу Ishama - Daniela Jodorf - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fünftes Kapitel
ОглавлениеStändig mussten wir blitzschnell auf neue Situationen reagieren. Oft blieb nicht mal Zeit zum Nachdenken. Wir waren geschult darin, routiniert zu handeln und unsere eigenen Bedürfnisse hinter die Notwendigkeiten des Augenblicks zu stellen. So wurde am nächsten Tag eine Gruppe schwer verletzter Frauen aus einer Kleinstadt südlich von Muzaffarabad eingeliefert. Die Näherei war über ihnen zusammengebrochen und es grenzte an ein Wunder, dass fast alle lebend geborgen werden konnten. Doch ihre Wunden waren nur notdürftig versorgt worden und wir kämpften jetzt, nach Tagen, gegen Infektionen und falsch gerichtete Brüche. Jede Hand wurde gebraucht und keiner von uns gönnte sich mehr als eine kurze Pause.
Als ich in einer ruhigeren Minute im Kinderzelt allein nach dem Rechten sehen wollte, hörte ich plötzlich Schwester Irenes Stimme laut werden.
„Shut up!“, schrie sie, als sie einen Wundverband am Unterschenkel eines etwa dreijährigen Jungen fachkundig wechselte. „Stop crying! Only cowards cry. Hör auf zu heulen. Nur Feiglinge weinen.“
Mein Herz zog sich zusammen wie eine Schnecke, die sich in ihr schützendes Haus zurückzog. Schnell war ich an der Seite des Kindes und sah Schwester Irene scharf an. „Wie kannst du den Kleinen so anfahren. Er ist verletzt, er ist allein, er weiß nicht, wo seine Mutter ist. Viel mehr als einen neuen Verband braucht er das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit.“
Irene sah mich verständnislos an. „Wenn er heult, wird es auch nicht besser. Man kann nicht früh genug lernen, dass Selbstmitleid hinderlich ist.“
„Du willst mir hier erklären, dass dieser Junge aus Selbstmitleid weint?“, rief ich gerade fassungslos, als Ian das Kinderzelt betrat.
„Was ist denn hier los?“
„Ich habe den Kleinen getröstet und ihm gesagt, dass er nicht weinen soll“, log Irene ungerührt.
„Ich habe dich bis draußen gehört, Irene. Erzähl mir also keinen Mist. Du hast den Kleinen angeschrien! Weißt du eigentlich, was du damit anrichten kannst? Diese Kinder sind traumatisiert. Sie brauchen Liebe und Fürsorge. Im Moment sind wir alles, was sie haben.“
„Ich bin nicht ihr Mutterersatz. Sie sollten sich nicht an uns klammern. Wir werden nicht ewig für sie da sein. Es ist nicht meine Aufgabe, sie von meiner Zuneigung abhängig zu machen.“
Ich versuchte zu verstehen, was Schwester Irene da sagte; zu begreifen, wie sie denken und fühlen musste, um solche Worte zu sprechen. Rasende, ohnmächtige Wut breitete sich in mir aus. Es kostete mich unbändige Kraft, sie nicht anzuschreien.
„Wenn ich so etwas noch einmal erlebe, wird das Konsequenzen haben, Irene.“ Ian wirkte autoritärer als sonst, aber auch viel ruhiger und gelassener als ich.
Schwester Irene blickte uns kalt und trotzig an und verließ das Kinderzelt. Meine Hand streichelte den Kleinen, der trotz unseres Streits in einen unruhigen Schlaf gefallen war.
„Das habe ich gestern gemeint, Ian.“
„Ja, jetzt verstehe ich dich. Sollen wir mit Victor darüber reden?“
Doch das schien mir zu früh. Wir sollten Schwester Irene weiter beobachten und notfalls noch einmal ein Gespräch mit ihr suchen, schlug ich vor.
Die Lichter unserer Klinik lagen am Abend dieses erschöpfenden Tages schon weit hinter mir, als ich auf meinem nächtlichen Streifzug ein Poltern hinter einer Hausecke hörte. Ich blieb erschrocken stehen. Doch größer als der Schreck war die Hoffnung, dass jeden Moment Iman um die Ecke kommen könnte. Aber schon einen Augenblick später kroch eine fremde Frau hinter den Trümmern hervor. Sie trug einen Sari und hatte ihren Schleier tiefer als üblich ins Gesicht gezogen. „Dacta, Misses. Help, please. Kommen Sie schnell. Sie müssen uns helfen.“
„Was ist passiert?“ fragte ich.
„Aana! Come! Kommen Sie. Please, quickly. Bitte, schnell.. My daughter. Meine Tochter. Sie ist schwer verletzt. Please, Misses“, schluchzte sie.
„Ich brauche meine Tasche. Aana! Come!“ rief ich und lief zurück in Richtung Hospital. Die Frau hielt in ihrem Sari ohne Weiteres Schritt.
In kürzester Zeit hatte ich eine Notarzttasche gegriffen und lief hinter der Unbekannten her durch die Nacht. Ich achtete nicht darauf, wohin wir liefen, kreuz und quer durch die Stadt, durch die Gassen, die ich bereits kannte, und weiter nach Norden entlang des Nilam. Meine Lunge brannte und ich rang nach Luft, als wir endlich eine notdürftig zusammengezimmerte Hütte in einem der ärmeren Viertel erreichten. Die Frau stieß die Tür auf und zog mich hinter sich her in einen dunklen, engen Raum. Erst als sie eine Öllampe anzündete, sah ich im hinteren Teil der zugigen Hütte ein Bett, auf dem eine junge Frau bewusstlos zusammengekauert lag. Das zerknitterte Laken war voller Blut. Ich bat um mehr Licht und nahm eine weitere Öllampe entgegen. Das junge Mädchen atmete flach und beunruhigend langsam.
„Was fehlt ihr?“ Die verzweifelte Mutter verstand mich nicht. „Was ist passiert?“
Keine Antwort.
„Kya? Kaun? Was? Wer?“
„The evil! Buraai. Der Teufel, Misses!“
Ich glaubte, falsch verstanden zu haben. „Der Teufel?“
„Yes, yes.“
„Was hat er getan? Kya?“
„Torture!“
„Folter?“ Ich verstand nicht, was die Frau meinte.
„Musalmaan buraai. Die muslimischen Teufel haben sie gefoltert ...“
Mein Herz raste. Vorsichtig begann ich, die junge Frau, die leblos vor mir auf dem schmalen, harten Lager lag, zu untersuchen. Ich betastete ihren Körper und hob ihre Kleidung an den Stellen, an denen ich Blut sah oder Verletzungen erfühlte. Sie war mit Hämatomen übersät. Selbst im Gesicht hatte sie schwerste Prellungen. Die Mutter wurde langsam ungeduldig. Sie wickelte ihr Kind geschickt aus seinem Sari und zeigte auf seinen Unterleib. Er war blutverschmiert, geschunden und wund. Ich wusste nicht, wer und womit er diesem Mädchen solche Verletzungen zugefügt hatte, doch endlich begriff ich, dass ich mich zusammenreißen und handeln musste. Ich zog eine Spritze auf, schickte die Mutter heißes Wasser holen und begann mit meiner Arbeit. Systematisch untersuchte ich das geschundene Bündel, nachdem ich zuerst ein Schmerzmittel gespritzt hatte. Ich wusch die Wunden, ich untersuchte die Genitalien. Meine Befürchtung bewahrheitete sich: man hatte die Frau wiederholt mit irgendwelchen Gegenständen in die Vagina gestochen. Meine Ausrüstung war zu dürftig für diese Schwere von inneren Verletzungen, doch ich gab nicht auf.
Nach zwei Stunden hatte ich das Mädchen von allem Blut gereinigt, hatte die Wunden an Armen und Beinen versorgt und verbunden, die inneren Verletzungen, so gut ich konnte, sterilisiert, antiseptisch versorgt und sie genäht. Doch so bemüht ich auch darum war, diesen leblosen Körper, der vor mir lag, zu „reparieren“, so wenig konnte ich mir vorstellen, dass dieser Mensch jemals wieder lebensfähig werden würde. Die Verletzungen waren so demütigend, so entwürdigend, so traumatisierend, dass ich glaubte, keine Seele würde dieses Leid ertragen können.
Erschöpft sackte ich auf einen Hocker, der in der Nähe des Bettes stand, als getan war, was ich tun konnte. Es brauchte ein Wunder, damit die junge Frau überlebte. Da war sie wieder, die Grenze meiner ärztlichen Fähigkeiten, die mir eigentlich jeden Tag seit den Ereignissen in Frankfurt wie ein übergroßes Mahnmal vor Augen stand. Die Mutter reichte mir dankbar einen heißen Tee mit viel Zucker und Kardamom. Ich trank ihn mechanisch, betäubt von den schockierenden Verletzungen ihrer Tochter. Ich hatte viele schwer Verletzte operiert, doch fast alle waren durch Unfälle zu Schaden gekommen. Verletzungen, die auf Gewalt beruhten, konnte ich an einer Hand abzählen: Schlägereien auf offener Straße, zumeist nach Alkoholkonsum. Doch so etwas hatte ich noch nie gesehen.
Müde versuchte ich, von der Mutter mehr über die Täter zu erfahren. „Who does such things? Wer tut so etwas?“
„Giroh! Die Banden!“
„Welche Banden?“ Wie wenig wusste ich doch über dieses Land, über seine Menschen und ihre Konflikte.
„Krieg älter als Kashmir. Kashmir zwei: halb Moslem, halb Hindu. Niemals eins.“
Sie sprach besser Englisch, als ich am Anfang unserer Begegnung gedacht hatte; vielleicht, weil sie nun beruhigt war, nachdem ich ihre Tochter versorgt hatte.
„Warum Ihre Tochter? Was hat sie getan?“
„Wir Hindus. Nicht sehr gläubig. Tochter verliebt in jungen Moslem. Familie traditionell. Streng und politisch. Religion benutzen für Herrschaft, Macht. Was nicht in Koran, darf nicht passieren. Andere Religion unrein.“ Die Frau weinte still. Ich nahm ihre Hand und drückte sie fest.
„Nur ein Kuss. Junge jetzt in Bergen bei Armee. Tochter von Teufeln fast getötet. Sie unschuldig. Wusste nicht Falsches tun. Wir nie etwas verboten ... Wir sie lieben.“
„Police?“, fragte ich.
„Nahin, nahin! No, no! Police dangerous.. Muslim.“
Ich weiß nicht mehr, wie lange ich bei dieser Mutter saß, deren Kindes Seele mutwillig gebrochen worden war. Ich hielt ihre Hand und vergaß alles, was jemals gewesen war und jemals sein könnte. Schmerzbetäubt verließ ich ihr Haus und suchte den Weg durch die engen Gassen zurück zum Nothospital, das mir heute als sicherer Hort erschien. Tränen liefen lautlos über mein Gesicht. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich angesichts des Leids eines Patienten weinte. Vor meinem inneren Auge sah ich nur ein Bild: das aufgerissene, blutende, bewusstlose Mädchen. Ich sah es so konzentriert, dass ich mich für einen Moment eins mit ihm fühlte. Ich empfand den physischen und seelischen Schmerz der jungen Frau wie meinen eigenen. Im selben Moment veränderte sich mein Bewusstsein ein weiteres Mal, tat einen weiteren Schritt über die normale Wahrnehmung hinaus und ich war wieder der neutrale Beobachter, der weder mit dem Mädchen noch mit mir identifiziert schien und der so viel mehr wusste und wahrnahm als ich, Ellen. Dieses Beobachterbewusstsein schien jegliche Erfahrung zu umfassen und doch völlig frei von allem, was geschah, zu bleiben. Ich war in diesem Bewusstsein enthalten und gleichzeitig war es in mir. Und dann erlebte ich ein Wunder: Der Schmerz löste sich auf. Mein Schmerz, der der Schmerz des geschundenen Mädchens war. Mein Herz war mit meinem unerwarteten Blick in die tieferen Ebenen des Bewusstseins augenblicklich aus seiner engen Umklammerung befreit worden. Wo ich vorher Leid, Ohnmacht, Hass, Wut und Widerstand empfunden hatte, blieb jetzt nur eines: reine Wahrnehmung und Akzeptanz. Ich konnte das Leid annehmen und der Schmerz löste sich auf. Ja, mir war sogar, als wäre dem Mädchen niemals ein Leid geschehen. Da wusste ich, dass es überleben würde.