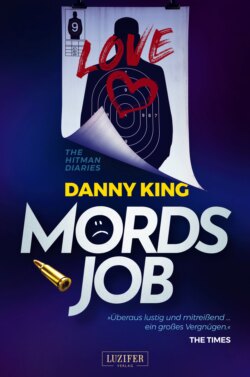Читать книгу MORDSJOB - The Hitman Diaries - Danny King - Страница 7
Noch mehr Fische im Meer
ОглавлениеWie jeder Abend hatte auch mein Abend mit Janet zwei Hälften. Nachdem wir unser Essen beendet hatten – oder vielmehr: Nachdem sie unser Essen beendet hatte, machte Janet auf dem Weg nach draußen ein paar Andeutungen in Richtung Tanzengehen, aber da ich sie sowieso nicht wiedersehen wollte, überhörte ich alle. Wir verließen das Restaurant und gingen über den Parkplatz zu meinem Auto, als Janet rundheraus fragte, ob ich vielleicht noch mit zu ihr kommen wollte. »Das ist schon in Ordnung. Ich wohne alleine, seit sie Mama mitgenommen haben.«
So, wie unser Date gelaufen war, und in dem neuen Licht, in dem ich Janet inzwischen sah, fand ich sie nicht mehr im Geringsten attraktiv.
»Okay«, sagte ich.
Ich hatte sie ursprünglich eingeladen, weil ich gedacht hatte, sie besäße innere Schönheit und ein gutes Herz, aber jetzt interessierte sie mich nicht mehr. Ein schneller Fick war alles, wofür sie noch gut war, und das auch nur, weil es mich auf andere Gedanken bringen würde. Ich bin schließlich auch nur ein Mensch. Ich brauche Sex genauso sehr wie jeder andere Mann. Zwar mochte ich Janet nicht mehr besonders, aber eine schnelle Runde mit ihr im Bett würde meine Libido für zwei Wochen oder so in Schach halten, damit ich zur Abwechslung mal an etwas anderes denken konnte. Nach einem längeren prüfenden Blick auf ihren Arsch korrigierte ich die Berechnung noch einmal. Beim Aufwachen als Erstes dieses milchigweiße Hinterteil zu sehen, könnte mich sogar mit genug Selbstverachtung erfüllen, dass es mir einen ganzen Monat lang den Sex verleidete – was, wenn man sowieso nicht regelmäßig welchen bekommt, eine gute Sache ist.
Ich wollte Janet gerade die Beifahrertür öffnen, als ich eine wütende Männerstimme hörte. Anscheinend war ich gemeint.
»Ja, du, du verficktes, rotznasiges kleines Arschloch!«
Ich drehte mich um und sah diesen gewaltigen Gorilla und seine prollige Frau quer über den Parkplatz auf uns zustürmen.
»Reden Sie mit mir?«, fragte ich. Er knallte mich gegen die Seite meines Autos.
»Ja, ich rede mit dir, du dreistes Arschloch. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, mich so anzuglotzen?«
»Was?« Ich war verwirrt. »Wovon reden Sie? Wer sind Sie?«
Er drückte seinen Arm auf meinen Hals und beugte sich vor, bis sein Gesicht nur noch ein paar Zentimeter von meinem entfernt war.
»Tu doch nicht so! Ich bin der arme Kerl, den du den ganzen Abend gefickt hast.«
»Gefickt?« Ich wusste nicht, was er meinte.
»Du hast zu mir rübergegafft, mich und meine Freundin den ganzen verfickten Abend verfickt böse angestarrt, oder etwa nicht, du verfickter kleiner … Ficker?« Ganz offensichtlich war er sehr aufgebracht.
»Verzeihung?«, fragte ich noch einmal. Mir war immer noch nicht klar, wovon er eigentlich sprach.
»Dafür ist es jetzt zu spät.« Er glaubte wohl, ich hätte es als Entschuldigung gemeint, was mich wirklich verärgerte.
»Es tut ihm gar nicht leid, Frank«, rief seine Frau zu uns herüber. »Er und seine fette Frau, sie haben uns beide beim Essen angestarrt.«
»Sie ist nicht meine Frau«, berichtigte ich und überlegte kurz, ob ich noch »und fett ist sie auch nicht« hinzufügen sollte, aber das hätte uns bloß alle in Verlegenheit gebracht.
»Lassen Sie uns in Ruhe«, kam Janet mir endlich zu Hilfe. »Gehen Sie weg oder ich hole die Polizei.«
»Ich habe Sie noch nie im Leben gesehen, geschweige denn angestarrt«, erklärte ich Frank.
»Du verfickter Lügner. Das ganze verfickte Essen lang hast du mich angeglotzt.«
»Ich weiß nicht, wer Sie sind. Das hier ist das erste Mal, dass ich Sie je gesehen habe.«
»Hast du das gehört, Mandy?«, bezog er seine Frau wieder ins Geschehen ein. »Verfickt dreist und frech.«
»Er ist ein Arschloch!«, mutmaßte sie.
»Gehen Sie weg von mir!« Ich versuchte, seine Hände zu lösen.
»Fang bloß nicht so an«, sagte Frank, wobei er mich noch härter gegen das Auto drückte. Langsam übertrieb er etwas.
»Hau ihm endlich eine rein«, drängte Mandy, und das tat er, direkt in die Rippen, dann drückte er mich wieder gegen das Auto.
»Jetzt glotzt du nicht mehr, was?« Mit der freien Hand schlug er mir ins Gesicht und ließ mich auf den Boden fallen. Die Landung war schmerzhaft, aber ich erhielt keine Gelegenheit, darüber nachzudenken, denn Frank bearbeitete mich bereits mit seinen Stiefeln. Von irgendwo jenseits seiner Quadratlatschen hörte ich Janet weinen und Mandy einen Orgasmus bekommen, während mir die volle Härte der Parkplatzjustiz zuteilwurde. Ich spürte, dass Frank noch lange nicht mit mir fertig war, und versuchte mich so gut es ging zu schützen, da legte sich plötzlich in meinem Inneren ein Schalter um und der Instinkt übernahm das Ruder.
Bevor ich mich versah, war meine Glock aus dem Holster und auf Franks Hals gerichtet. Verglichen mit seinem schwerfälligen Angriff war die Bewegung so schnell, dass er die Waffe erst bemerkte, als die Kugel seinen Kehlkopf zerriss und seine Arterien durchschlug.
Sofort war ich auf den Beinen und zielte mit der Waffe auf Mandys Gesicht. Sie bekam keine Gelegenheit zu schreien oder zu verstehen, was geschah. In einer Sekunde war sie noch mit ihrem harten Kerl ausgegangen, in der nächsten gingen die Lichter aus. Ich hatte sie so sauber erwischt, dass ich – auch wenn meine Glock einen Schalldämpfer hatte – keinen zweiten Kopfschuss riskieren musste. Frank dagegen klammerte sich mit lästiger Hartnäckigkeit an seinem Leben fest, also kam er in den Genuss des Inhalts der dritten Kammer.
Ich wirbelte herum und nahm mein letztes Ziel ins Visier. Gerade als ich den Abzug durchziehen wollte, fiel mir ein, dass sie mein Date war.
»Tut mir leid«, sagte ich zu Janet, die Waffe nur knappe zehn Zentimeter von ihrer Stirn entfernt. »Ich bin ein Auftragskiller.«
»Ich werd’s niemandem verraten«, flennte sie, die kleinen pummeligen Hände vor den Mund gepresst.
»Ich weiß«, sagte ich, »das wirst du nicht«, und pustete ihr das Gehirn weg. Die Leute behaupten immer, sie würden nichts verraten, wenn sie eine Knarre am Kopf haben. Aber am Ende tun sie es doch. Ich ließ die Automatik sinken und nahm mir einen Moment Zeit, um zu begreifen, was ich gerade getan hatte.
Dann geriet ich in Panik.
Ich stand ein paar Meter entfernt von einem gut besuchten Restaurant, drei Leichen zu meinen Füßen und die Mordwaffe in der Hand. Nicht nur das; kurz zuvor hatte ich mit einem der Opfer zu Abend gegessen.
Welcher Anwalt auch immer mich aus dieser misslichen Lage herauspauken wollte – er würde hart für sein Geld arbeiten müssen.
In Gedanken ging ich schnell die positiven Aspekte durch: Es war dunkel, wir befanden uns am äußersten Ende des Parkplatzes … ich hatte einen Kombi.
Egal, wie trostlos die Dinge auf den ersten Blick aussehen mögen, es gibt immer eine Chance. Man sollte nie verfrüht das Handtuch werfen. Es ist nicht vorbei, bevor die fette Dame singt – sorry, Janet, war nicht so gemeint – also machte ich mich unverzüglich an die Arbeit. Ich schleifte die drei Leichen tiefer in die Schatten zwischen die geparkten Autos, entriegelte die Kofferraumklappe meines Wagens und lud meine Glock mit einem vollen Magazin, nur für alle Fälle.
Ich erzähle euch was über mein Auto: In meinem Beruf ist ein Kombi sehr viel praktischer als ein Ferrari. Wahrscheinlich könnte ich mir einen Ferrari leisten, wenn ich wollte, aber wie viele Leichen passen da wohl rein? Allzeit bereit, das ist mein Motto, und fünf Türen und eine Menge Platz können manchmal die nützlichste Waffe in deinem Arsenal sein. Versteht mich nicht falsch: So etwas passierte mir normalerweise nicht, wenn ich ein Date hatte, aber andererseits müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, es wäre vorher noch nie passiert.
Ich klappte den Rücksitz um, wobei ich die Hutablage als Sichtschutz an Ort und Stelle ließ, dann lud ich Mandy als Erste ein. Mandy war die Leichteste und schmiegte sich passgenau gegen die hintere Beifahrertür. Gerade, als ich die Hand nach Frank ausstrecken wollte, hörte ich Stimmen. Ich schaute mich um und sah ein gutes Dutzend Leute verschiedener Alters- und Hässlichkeitsstufen aus dem Restaurant in Richtung Parkplatz kommen. Offensichtlich ein Familienausflug der Munsters.
Jetzt musste ich einen kühlen Kopf bewahren. Es waren viel zu viele, um sie alle auszuschalten, also ruhig Blut. Zu allem Überfluss hatte ich sogar ein Maschinengewehr im Auto versteckt, aber die Situation war auch so schon absurd genug. Wenn das so weiterging, würde ich für den Leichentransport noch einen LKW brauchen. Ich stellte mich für alle sichtbar hin, nahm meinen Eimer und Abzieher, ging lässig zu meiner Windschutzscheibe und begann sie zu säubern. Die Munsters verteilten sich auf drei Autos und fuhren gemächlich los. Wahrscheinlich unterhielten sie sich immer noch über das Essen, die Bedienung, die Rechnung und die ganzen Kleinigkeiten, über die Leute so reden, wenn sie gerade aus einem Restaurant kommen. Niemand schenkte mir mehr als einen flüchtigen Blick. Für den Moment war die Gefahr gebannt. Aber mein Auto war auf allen Seiten von anderen Fahrzeugen umgeben und es würde nicht lange dauern, bevor einer dieser Gäste das Lokal verließ.
Ich wuchtete Frank als Nächsten hinein, drückte ihn gegen seine Freundin und schob seine Füße von hinten an seinen Körper. Dann widmete ich mich dem Problemfall Janet. Erst jetzt wurde mir bewusst, wie massig sie war. Frank war schwer gewesen, doch er bestand nur aus Muskeln und Sehnen, die man gut greifen und heben konnte. Bei Janet war alles weich und lose. Ich bekam keinen Teil von ihr richtig zu packen, mit Ausnahme ihrer Handgelenke und Knöchel. Außerdem musste ich feststellen, dass es ein Fehler gewesen war, Mandy zuerst ins Auto legen. Eine unförmige, schwere Last einzuladen war schwierig genug, aber sie in einen bereits gefüllten Raum laden zu müssen, verstärkte die Probleme noch. Ich hätte mir die Leichteste bis zuletzt aufheben sollen. Allerdings würde ich jetzt nicht anfangen, wieder auszupacken.
Ich schaffte es, Janets Beine anzuheben und hineinzumanövrieren, dann packte ich sie unter den Achseln und hob sie ins Auto, wo ich sie schließlich mit aller Kraft von der Kofferraumtür wegschob, so weit es ging. Ich schloss die Tür, musterte meine Kleidung und stellte fest, dass die drei mich vollgeblutet hatten. Auf meiner schwarzen Jacke und Hose fiel die klebrige rote Soße nicht allzu sehr auf, aber mein Hemd war hin. Ich zog es schnell aus und warf es zu den Leichen hinten ins Auto. Es gab doch noch mehr Platz, als ich zuerst gedacht hatte, nur wo Janet lag, war es richtig eng.
Ein oder zwei Dinge musste ich noch erledigen, bevor ich losfahren konnte. Ich riss ein paar schwarze Müllsäcke, die ich im Auto hatte, auf und bedeckte damit Janet, Mandy und Frank. Dann nahm ich eine Zweiliterflasche Mineralwasser aus dem Handschuhfach und spülte so gut es ging die Blutpfützen vom Asphalt. Sehr effektiv war es nicht, tatsächlich wurde das Blut nur ein bisschen verdünnt, aber das musste reichen. Schließlich konnte ich schlecht ans Küchenfenster klopfen und nach einem Eimer Seifenwasser fragen.
Ich fuhr schön langsam und vorsichtig vom Parkplatz und machte mich auf den Weg nach Kent. Warum Kent? Nun, in der Themsemündung, vertäut in einem kleinen, abgelegenen Hafen, lag mein Motorboot. Nichts Luxuriöses oder Besonderes, nur ein ramponiertes altes Boot mit einer kleinen Kajüte und ein bisschen Stauraum, für den ich von Zeit zu Zeit Verwendung hatte. Es dümpelte schön anonym zwischen ungefähr einem Dutzend Vergnügungsbooten. Meins war allerdings nicht fürs Vergnügen gedacht. Es war, wie Mandy, Frank und Janet bald herausfinden würden, ein Nutzfahrzeug.
Manche Killer vergraben ihre Opfer gern, pflanzen sie ein wie kleine Eicheln im Epping Forest, aber meiner Erfahrung nach hat diese Methode einige Nachteile. Zuerst einmal muss man seine Begräbnisstätte vorher gut auskundschaften. Großbritannien ist ein ziemlich kleines Land und nur sehr wenig davon ist von Wanderern, Hundespaziergängern, Förstern, Bauern und so weiter unberührt geblieben. Wenn du jemanden loswerden willst, legst du höchstwahrscheinlich keinen Wert darauf, dass diese Person wieder auftaucht und dich auf die Anklagebank bringt, deswegen ist die Auswahl des Ortes enorm wichtig. Zweitens muss man das verschissene Loch ausheben und das ist harte Arbeit. Außerdem macht es Lärm. Sollte irgendjemand in der Nähe sein, während du gräbst, erregst du garantiert seine Aufmerksamkeit. Und wenn ihm auffällt, dass du eine Leiche neben dir liegen hast, kannst du gleich zwei Löcher graben. Wer seine Toten also unbedingt beerdigen will, sollte am besten schon einen Tag vorher das Loch ausheben und mit Farnkraut abdecken. Zu guter Letzt wäre da noch das Logistikproblem. Natürlich möchte man seinen Mann möglichst am Arsch der Welt verbuddeln, wobei die Schwierigkeit darin besteht, das Loch zu erreichen. Idealerweise nimmt man für den Großteil der Strecke das Auto, anschließend ein kurzer Fußweg durch Büsche und Gestrüpp zum Grab. Es muss ein kurzer Weg sein, denn immerhin trägt man totes Gewicht von siebzig, achtzig, neunzig oder hundert Kilo mit sich herum, und wer das Töten zum Beruf gemacht hat, arbeitet am liebsten allein. Die eleganteste Lösung für dieses Problem besteht darin, dass man seine Opfer zu Fuß zum Grab gehen lässt und sie direkt vor Ort tötet, aber das bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, denen wir uns in einem späteren Kapitel widmen werden.
Ich für meinen Teil bin eher der Wirf-sie-ins-Wasser-Typ. Es ist einfacher, die Auswahl ist viel größer (immerhin bestehen zwei Drittel des Planeten aus Wasser) und es besteht keine Gefahr, dass ein Bauunternehmen irgendjemanden wieder ausgräbt, nachdem die Auenlandschaft zur Neubausiedlung geworden ist.
Auf dem Weg zu meinem Boot ließ ich es gemütlich angehen. Tempo minimal über der Geschwindigkeitsbegrenzung, vor dem Abbiegen Rückspiegel checken und Blinker setzen, alles schön vorsichtig. Wenn es ging, hielt ich mich an kleine Land- und Nebenstraßen. Dabei dachte ich darüber nach, ob ich das Auto jetzt entsorgen musste oder ob es vielleicht möglich wäre, es trotz der Menge an forensischen Spuren, die darin verteilt waren, zu behalten. Besser weg damit. Kein Risiko eingehen. Ich würde ein schönes ruhiges Plätzchen finden und es ausbrennen. Das war die professionelle Vorgehensweise. Abgesehen davon hatte ich keine Lust, auf Händen und Knien das ganze klebrige Zeugs wegzuschrubben. Eine furchtbare, widerliche Arbeit, die sowieso nichts bringen würde. Ein blutbespritztes Auto so zu reinigen, dass es durch eine forensische Untersuchung kommt, ist so gut wie unmöglich. Nein, nur Feuer beseitigt alle Spuren endgültig.
Trotzdem war es eine Schande. Ich besaß das Auto noch nicht lange und es war schön und komfortabel. Eigentlich hatte ich eine Menge Autos, oder zumindest standen mir eine Menge Autos zur Verfügung, je nachdem, was für einen Auftrag ich bekam. Schnelle Fluchtwagen, Transporter, die man als Firmenwagen tarnen konnte, Motorräder für die Innenstadt (mein persönlicher Favorit) … wir hatten sogar irgendwo ein paar Taxis, die ich noch nie benutzt hatte, alle komplett mit gefälschten Nummernschildern und Fahrtenbüchern und entfernten Seriennummern. Sogar das Auto, in dem ich gerade nach Kent fuhr, war auf irgendeinen lange vergessenen Fall von plötzlichem Kindstod zugelassen, samt Führerschein und Fahrzeugpapieren in der Beifahrertür. Ich glaube, seit meine Mutter »IAN BRIDGES, 13 JAHRE« in meine Schuluniform geschrieben hatte – zwei Wochen vor meinem vierzehnten Geburtstag – hatte ich in nichts mehr gesessen, das man zu mir hätte zurückverfolgen können.
Dieses war allerdings kein Auto für die Arbeit, es war mein Alltagsvehikel, mit dem ich zum Einkaufen oder in den Park fuhr. Typisch. Kaum hatte ich ein Auto gefunden, das mir gefiel, musste ich es schon wieder verbrennen. Morgen würde ich zu Logan gehen und ihn bitten, mir ein neues zu beschaffen, aber er würde bestimmt einen Riesenaufriss darum machen und mir nicht noch einmal dasselbe Modell besorgen können. Ich musste nehmen, was ich vorgesetzt bekam.
Das waren die Gedanken, über denen ich an der Ampel einer kleinen Kreuzung zweier Landstraßen kurz hinter Gravesend brütete, als hinter mir ein Range Rover hielt. Ich drehte am Innenspiegel, sodass ich den Fahrer im Auge behalten konnte, während wir auf Grün warteten.
Er schaute über die mondbeschienenen Wiesen zu unserer Linken, runter auf sein Radio, dann ein schneller Blick auf die Ampel, rüber zu den Bäumen rechts von uns, in mein Auto auf den verdrehten, blutbesudelten Arm, der unter den schwarzen Mülltüten hervorragte … und sehr, sehr schnell wieder weg.
Das verdammte Ding musste sich gelöst haben, als ich durch ein Schlagloch oder so was gefahren war.
Im Bruchteil einer Sekunde war ich aus dem Auto gesprungen und zielte mit der Waffe auf seinen Kopf.
»Britischer Secret Service«, sagte ich. »Steigen Sie bitte aus, Sir.«
Der Typ machte einen geschockten und verwirrten Eindruck, was auch Sinn der Sache war, denn jetzt konnte ich seine Autotür aufreißen und ihn herausziehen. Diese Masche benutze ich in solchen Situationen oft. Sie hält das Gegenüber von einer instinktiven Reaktion ab, was einem genug Zeit verschafft, nahe genug heranzukommen, um das Risiko auszuschalten. Lasst es mich erklären: Stellt euch vor, ihr hättet gerade in dem Auto vor euch eine Leiche entdeckt. Der Fahrer springt heraus und plötzlich seht ihr eine Schusswaffe. Was tut ihr? Wahrscheinlich kräftig aufs Gas treten, stimmt’s? Aber wenn er dann »Secret Service« oder »CID« oder »Polizei«, »Notarzt im Einsatz« oder irgendwas in der Art sagt, dann zögert ihr vielleicht. Immerhin könnte der Secret Service einen guten Grund für die Leichen in seinem Auto haben, und ihr wollt doch nicht James Bonds Mission oder die nationale Sicherheit gefährden, indem ihr Zeter und Mordio schreit wie irgendein dämlicher Zivilist. Wir stehen schließlich alle auf derselben Seite, richtig?
Falsch. In der Sekunde, die ihr mindestens braucht, um über all dies nachzudenken, habe ich die Kontrolle über die Situation übernommen und ihr seid tot.
»Charles Parnell«, stellte der Mann sich vor, während ich ihn halbherzig abtastete. »Ich bin Buchhalter.«
»Kommen Sie bitte mit, Mr. Parnell.« Ich hielt die Waffe hinter seinem Rücken. »Mein Boss möchte etwas mit Ihnen besprechen. Hier lang.«
Ich führte ihn schnellen Schrittes durch eine Lücke in der Hecke und zog ihm eins über. Als Parnell zusammengesackt war, schnitt ich ihm in der nächsten Sekunde mit meinem Messer die Kehle durch. Ich rannte zurück zu seinem Range Rover, fuhr ihn an den Fahrbahnrand, als ob ihn jemand geparkt hätte, schloss ihn ab und warf die Schlüssel zu Parnell in die Wiese.
In der Zeit, die ich gebraucht hatte, um jemanden zu töten und sein Auto zu parken, war die Ampel wieder auf Rot gesprungen, aber da keine anderen Autos in der Nähe waren, fuhr ich einfach durch. Dass ich den Range Rover geparkt hatte, würde mir ein paar Stunden Zeit verschaffen. Jeder, der vorbeikam, würde wahrscheinlich glauben, das Auto hätte eine Panne – oder überhaupt nicht darüber nachdenken. Parnell selbst wurde möglicherweise erst gefunden, wenn jemand sein Verschwinden bemerkt hatte, und bis dahin war ich meine Ladung Kollateralschäden hoffentlich schon losgeworden.
Ich trat das Gaspedal etwas weiter durch, um so viel Abstand wie möglich zwischen mich und die Kreuzung zu bringen, bis das nächste Auto vorbeikam. Glücklicherweise blieben die Straßen dunkel, während ich Richtung Chatham raste. Ich sah in den Innenspiegel, aber leider hatte ich ihn für die Beobachtung von Mr. Parnell verstellt, und jetzt konnte ich nur einen Teil der Straße hinter mir erkennen. Gerade als ich den Spiegel wieder in Position brachte, gab es einen dumpfen Aufprall an der linken Seite. Etwas Leuchtendgelbes blitzte im Licht meiner Scheinwerfer auf.
Ich stieg auf die Bremse. »Was zum …?«, murmelte ich und legte den Rückwärtsgang ein. Als ich ein paar Meter zurückgesetzt hatte, beleuchteten meine Rücklichter eine verdrehte Gestalt auf der Straße. Ich griff unter meinen Sitz, holte den Radmutternschlüssel hervor und stieg aus, um einen Blick auf das Problem zu werfen.
Es war ein Jogger. Er lag auf dem Asphalt, stöhnte vor sich hin und machte offensichtlich eine echt miese Zeit durch. Ich kniete mich neben ihn. Es ging ihm schlecht, wenn auch zu meinem Bedauern nicht schlecht genug. Da er mitten auf der Straße lag, würde er wesentlich schneller gefunden werden als Mr. Parnell, und ich konnte nicht riskieren, dass vor Sonnenaufgang eine Beschreibung des Autos durchsickerte. Ich holte mit dem Radmutternschlüssel aus und schlug ihm auf den Kopf, um ihm den Rest zu geben. Ein widerliches Knacken bestätigte, dass ich seinen Schädel gebrochen hatte, und der Jogger erschlaffte.
Ich war gerade dabei, ihn in den Graben neben der Straße zu rollen, als hinter mir die Stimme einer alten Dame fragte, ob alles in Ordnung sei. Himmelherrgott, wie viele musste ich denn noch erledigen, bis die Nacht um war?
»Hören Sie, geht es ihm gut? Er hat ganz schön was abbekommen. Braucht er einen Krankenwagen? Ich habe ein Telefon im Haus.«
Ich drehte mich zu der weißhaarigen alten Wichtigtuerin um, die aus ihrem einsamen kleinen Landhaus über die Straße auf mich zugewuselt kam.
»Schon in Ordnung, ich bin Arzt. Da wäre nur eine Kleinigkeit, bei der ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Ist sonst noch jemand im Haus?«
»Nein, nicht seit mein George verstorben ist, tut mir leid. Geht es ihm gut?«
»Ja, ja, alles bestens, kommen Sie bitte hier lang.« Ich schob sie zur hinteren Tür meines Autos und stopfte sie hinein, zuoberst auf den Stapel Leichen.
»Warten Sie. Was soll das? Halt! Was ist das hier?«, plapperte sie. Ich ruckte ihren Hals herum, bis ich es knacken hörte.
»Allmächtiger! Sonst noch irgendjemand?«, fragte ich kopfschüttelnd mit einem Blick zum Himmel. Ich rannte zum Haus der alten Dame, zog die Tür zu, sprang wieder ins Auto und war weg. Beim Fahren deckte ich Miss Marple so gut ich konnte mit der freien Hand zu und krachte auf der dunklen, engen Landstraße fast frontal in einen BMW. Der BMW-Fahrer und ich schleuderten beide seitlich weg und kamen quietschend zum Stehen. Der Fahrer lehnte sich aus dem Fenster und gab mir jeden Schimpfnamen der Straßenverkehrsordnung, bevor er mit aufheulendem Motor weiterraste.
Hatte er irgendetwas gesehen?
Ich bezweifelte es. In der Dunkelheit hatte ich sein Gesicht nicht erkennen können, also war es extrem unwahrscheinlich, dass er meins gesehen hatte. Alles, was er gesehen hatte, war das Auto, aber bei seiner Fahrweise würde er bestimmt noch eine Menge anderer Verkehrsteilnehmer anschreien, bevor der Abend vorüber war. Außerdem saß er in einem BMW und ich in einem Kombi voll mit toten Leuten. Obwohl ich ein Maschinengewehr dabeihatte, war es sinnlos, ihn zu verfolgen, selbst wenn er ein Augenzeuge unterwegs zu den Bullen sein sollte. Ich hatte keine Wahl, als ihn leben zu lassen, damit er auch morgen noch die Straßen unsicher machen konnte.
Plötzlich wünschte ich mir, ich hätte den Jogger hinter der Kurve auf der Straße liegen lassen, damit Mr. BMW ihn zu Mus fahren und auf sein Konto hätte nehmen können. Tja, die besten Ideen hat man immer, wenn es zu spät ist.
Nachdem ich ein paar Meilen zwischen mich und das Häuschen der alten Dame gebracht hatte, fuhr ich an einer ruhigen Stelle an die Seite, um meine Passagiere so zu verstauen, dass sich eine Unannehmlichkeit wie die mit dem verstorbenen Mr. Parnell nicht wiederholte. Einen Moment lang überlegte ich, Miss Marple vorne auf den Beifahrersitz zu packen, denn sie war nicht blutverschmiert und wenn ich sie anschnallte, würde sie aussehen, als ob sie ein Schläfchen machte. Letztendlich entschied ich mich dagegen. Sogar für meine Verhältnisse war das ein bisschen gruselig und außerdem mochte ich alte Damen sowieso nicht besonders.
Als sie alle ordentlich verpackt und abgedeckt waren, setzte ich die Fahrt fort und erreichte den Hafen kurz nach ein Uhr nachts. Ich suchte die Umgebung gründlich nach Nachtanglern oder ähnlichen Schlaflosen ab, bevor ich die Leichen vom Auto zum Boot verfrachtete. Es war harte Arbeit und dauerte fast zehn Minuten, was eine gefährlich lange Zeit ist, doch Wunder über Wunder: Niemand kam vorbei und ich schipperte los in die Dunkelheit.
Während das Boot aus eigener Kraft vorwärtstuckerte, bereitete ich die Leichen für die Entsorgung vor. Wisst ihr, leider kann man nicht einfach ein paar Meilen rausfahren und sie über Bord werfen. Wenn es doch bloß so einfach wäre! Nein, vorher muss man dafür sorgen, dass sie möglichst nicht gefunden werden, oder falls doch, dass sie wenigstens nicht identifiziert werden können. Und an dieser Stelle wird die Sache etwas unangenehm … oder etwas mehr unangenehm, falls man das so sagen kann.
Es gibt zwei Arten, einen Toten zu identifizieren (drei, wenn man DNA mitzählt, aber wir sind wohl noch ein paar Jahre von einer umfassenden Datenbank der Bevölkerung entfernt): Fingerabdrücke und Zahnarztunterlagen. Salzwasser, Fische und Krabben würden sich der Fingerabdrücke annehmen, aber um die Zähne musste ich mich alleine kümmern.
Ich griff nach der Brechstange und machte mich an die Arbeit.
Das tat ich wirklich extrem ungern. Zwar hatte ich mich in den letzten paar Jahren daran gewöhnt, dennoch war es nicht gerade eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Besonders, wenn es an die Backenzähne ging … wie heißen die noch gleich? Molaren. Die muss man richtig ausgraben, und das ist eine grauenhafte, übelriechende Angelegenheit. Ich hatte da allerdings schon eine Idee für eine kleine Bombe, die mir die Arbeit abnehmen könnte. Alles, was man dafür brauchte, wäre ein kleines bisschen Plastiksprengstoff, eine Batterie und ein Timer. Sprengstoff unter die Zunge stecken, Leiche ins Wasser rollen, dann nach zehn Sekunden ein kleines »Plopp« und … tadaa: keine Zähne, kein Kiefer, kein Kopf mehr zum Identifizieren übrig. Schnell, sauber, kein Stress, kein Dreck. Bei dem Gedanken, mir das Ding patentieren zu lassen, hatte ich sogar ein bisschen lachen müssen. Ich könnte es Bridges' Mundbombe oder so nennen. Na ja, es war nur so eine Idee.
Miss Marple machte sich posthum bei mir enorm beliebt, indem sie ein komplettes künstliches Gebiss hatte, das ich einfach herausnehmen und über Bord werfen konnte.
Nachdem ich mich auch um die anderen drei gekümmert hatte, durchsuchte ich noch schnell ihre Taschen und nahm alle persönlichen Sachen heraus. Es hatte schließlich wenig Sinn, einen Zahnabgleich unmöglich zu machen, wenn man dafür die Geldbörse in der Jackentasche stecken ließ. Als ich zu Janets Portemonnaie kam, stellte ich fest, dass sie ohne einen einzigen Penny ausgegangen war, was für heutige Verhältnisse schon ziemlich dreist ist. Frank, auf der anderen Seite, hatte ungefähr fünfzig Pfund in bar dabei. Also lud er Janet und mich nachträglich zum Abendessen ein, was ihm, glaube ich, nicht sonderlich gefallen hätte.
Als ich ungefähr anderthalb Meilen weit draußen war, stellte ich den Motor ab. Noch weiter sollte man nicht rausfahren, sonst sieht einen die Küstenwache auf dem Radar und fragt sich, was man wohl vorhat. Frank durfte das Wasser als Erster kosten. Ich band mit reichlich Seil die Gewichte an ihm fest. Dafür verwende ich immer Plastikgewichte, wie sie im Fitnessstudio benutzt werden. Sie zerbrechen nicht so leicht wie die traditionellen Hohlblocksteine, wenn sie auf dem Grund auf etwas Hartes treffen. Außerdem verrotten sie nicht im Salzwasser. Anschließend punktierte ich seine Lunge sowie seinen Magen, um eingeschlossene Luft entweichen zu lassen, und hievte ihn über Bord. Normalerweise starte ich dann das Boot und fahre ein Stückchen weiter, wenn ich mehr als eine Leiche zu entsorgen habe, aber irgendwie bin ich nun mal ein Romantiker, also versenkte ich Mandy direkt neben Frank. Miss Marple warf ich eine halbe Meile weiter draußen rein.
Die Letzte im Wasser war Janet. Als ich ihr den angespitzten Schraubenzieher tief in beide Lungenflügel und den Bauch stieß, musste ich mir eingestehen, dass unser Date nicht gerade erfolgreich verlaufen war. Das war mal wieder mein sprichwörtliches Pech bei Frauen. Es kam mir fast so vor, als ob irgendjemand dort oben nicht wollte, dass ich ein nettes Mädchen traf. Warum ich? Warum konnte es nicht ein einziges Mal gut für mich ausgehen? War das etwa zu viel verlangt? Andere Männer trafen auch Mädchen und ließen sich nieder, sogar die allermeisten. Warum war es bloß für mich so unmöglich? Ich war schließlich kein übler Kerl, oder? Eine Frau konnte es weitaus schlechter treffen als mit mir. Ein wenig Gesellschaft, mehr wollte ich doch gar nicht. Ich brauchte keinen Popstar oder ein Supermodel oder so was, einfach nur ein nettes, einfaches Mädchen, zu dem ich abends nach Hause kommen konnte. Eins, das mich zum Lachen und zum Weinen brachte. Ich würde sie behandeln wie eine Prinzessin und niemals die Hand gegen sie erheben, wie so manche anderen Männer. Eine Chance, mehr wollte ich gar nicht, nur eine einzige Chance, und ich würde ihr zeigen, dass ich der treueste, liebevollste Mann sein konnte, den eine Frau sich nur wünschen mochte.
Zwangsläufig war ich sehr deprimiert, als ich Janet über Bord schob.
»Na ja«, murmelte ich, bemüht mich selbst aufzumuntern, »es gibt noch mehr Fische im Meer.«