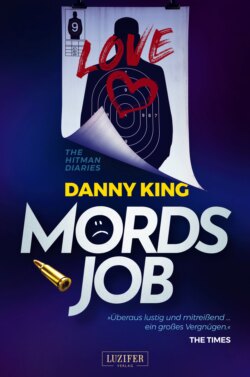Читать книгу MORDSJOB - The Hitman Diaries - Danny King - Страница 8
Mummys kleiner Soldat
Оглавление
Gegen vier Uhr morgens kam ich schließlich nach Hause, erschöpft und niedergeschlagen, den Gestank von Blut und Scheiße und Tod in der Nase. Er würde noch tagelang hängenbleiben. So ist das eben, wenn man mit Leichen zu tun hat: Sie stinken so übel, dass es sich in die Nasennebenhöhlen ätzt und man sie sogar noch riecht, wenn man sich den ganzen Körper mit einer Nagelbürste abgeschrubbt hat. Wahrscheinlich ist es etwas Psychisches, eher die Erinnerung an den Geruch als ein tatsächlicher Geruch. Wie auch immer. Es reicht auf jeden Fall aus, um einem den Appetit auf Würstchen eine ganze Weile zu verderben. Das Einzige, was ich sonst noch an mir riechen konnte, war das Benzin, das ich benutzt hatte, um das Auto auszubrennen, und im Vergleich mit dem anderen Zeug roch es wie Eau de Cologne. Mein Körper schrie förmlich nach einem langen heißen Bad, einem schönen sauberen Bett und ein paar Schlaftabletten, um das Hirn herunterzufahren.
Was ich bekam, war meine verfluchte Mutter.
»Ich bin’s nur!«, rief sie beim Hereinkommen. Es hatte begonnen. Mit »Ich bin’s nur« meinte sie: »Bloß ich, niemand Wichtiges, es tut mir leid, dass ich dir zur Last falle, lass mich einfach liegen, wenn ich umkippe, beachte mein Weinen nicht.« Sie war eine Großmeisterin der psychologischen Kriegsführung. Unglaublich. Drei Wörter und schon ging sie mir unter die Haut.
»Jesus! Bitte! Ich bin müde, mir tut alles weh, es ist mitten in der Nacht. Ich kann diesen Scheiß jetzt nicht brauchen.«
»Oh, dann gehe ich am besten einfach wieder, ja?«, winselte sie erbärmlich. »Du willst mich nicht sehen, oder?«
»Nein, will ich nicht. Jetzt nicht und nie wieder.«
»Oh. Ja, wenn du so über mich denkst, dann werde ich wohl … Ich wollte doch nur sehen, wie es dir geht. Ist das denn so schlimm von einer Mutter?«
»Ja. Ich brauche dich gerade nicht in meinem Kopf.«
»Ach, Ian«, stammelte sie mit schlaff herabhängenden Armen, ihr Gesicht ein Sinnbild menschlichen Elends. Mit zitternder Unterlippe hielt sie ihre Stellung, erkaufte sich ein paar wertvolle Sekunden für ihren Sturmangriff, bis meine Verteidigung zusammenbrach. Ich ließ den Kopf hängen, rieb mir die Augen und stieß ein frustriertes, halbersticktes Grunzen aus.
»Ich kann dich jetzt nicht ertragen. Ich brauche etwas Zeit für mich.«
»Schau mal, ich bin deine Mutter. Wenn es irgendwas gibt, womit ich dir helfen kann, dafür bin ich doch da.« Sie machte einen Riesenschritt auf mein Gesicht zu.
»Nein. Es ist nichts«, sagte ich, aber ich wusste, dass es noch nicht zu Ende war. Noch lange nicht. Wenn es sein musste, würde sie mich festbinden und mir mit glühenden Eisen die Brustwarzen verbrennen, bis ich ihr alles erzählte. Alles, was sie eigentlich gar nichts anging. Alles, was ich für mich behalten wollte. Alles. Punkt.
»Bitte, Ian, was ist denn los, mein Liebling?«
»Nichts«, wiederholte ich im Bemühen, es selber zu glauben, es auszuschalten, doch dafür war es zu spät. Sie hatte ihre Zähne in mein Fleisch geschlagen und ich konnte sie unmöglich abschütteln.
»Weißt du, wenn ich ein Problem habe, finde ich es immer sehr tröstlich, es bei jemandem abladen zu können«, sagte sie.
»Ich weiß, schließlich war das immer ich, verdammt noch mal«, schrie ich sie an. »Ich wollte deine Probleme genauso wenig wie du, aber das hat dich nie davon abgehalten, sie mir stundenlang in den Kopf zu kippen.«
»Ist es Geld?«, riet sie ins Blaue hinein.
»Nein, ich habe Geld genug. Ich habe mehr, als ich ausgeben kann. Ich brauche kein Geld.«
»Denn wenn es das ist, kann ich dir gerne aushelfen. Ich habe ein bisschen was auf die Seite gelegt, für einen kleinen Luxus hier und da. Aber ich kann darauf verzichten. Es ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Ich bin keine reiche Frau, tut mir leid.«
»Es geht nicht um Geld!«, wiederholte ich. So hatte sie das schon immer gemacht. Nachts lag sie wach und betete zu Jesus und allen Engeln im Himmel, dass ich eines Tages eine Durststrecke hatte und sie mit dem Hut in der Hand anbetteln müsste. Oh ja, das würde ihr gefallen. Dann konnte sie ihre Fleischerhaken ein für alle Mal in mich hineinschlagen, sodass ich ihr nie wieder entkommen würde. Und wenn ich es ihr fünfzigfach zurückzahlen konnte, das wäre ganz egal, denn sie würde es nie annehmen. Ein Pfund von meinem Fleisch war ihr mehr wert als sechs Richtige im Lotto.
»Natürlich musste ich meine Rente für Ian ausgeben«, hätte sie dann allen erzählen können. »Ja, die Zeiten sind sehr hart. Aber ich versuche über die Runden zu kommen und Ian nicht merken zu lassen, mit wie wenig ich auskommen muss. Als Mutter bringt man eben Opfer. Das macht nichts, die Hauptsache ist doch, dass es ihm gut geht … Oh, tut mir leid, bitte achten Sie nicht auf meinen knurrenden Magen. Ich habe Ian mein Mittagessen geschickt, er hat nämlich manchmal gerne zwei Portionen, seine und meine … Ja, ich bin hungrig und ein bisschen schwach, aber das ist nicht wichtig, schließlich ist er mein Sohn und er soll alles bekommen, was er will. Ich komme schon zurecht, es ist nicht das erste Mal, dass ich für ihn sorge, und es wird auch nicht das letzte sein. Das macht mir nichts aus, wirklich … Wie bitte? Was? Nein, ich habe seit Monaten nichts von ihm gehört, er besucht mich nicht so oft. Ich glaube, er hat Wichtigeres zu tun … ich habe ihm das Leben geschenkt, wissen Sie?«
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!
»Es geht nicht um Scheiß-Geld!«, brüllte ich, als sie anfing, in ihrer Geldbörse zu kramen.
»Ich will doch nur helfen.« Sie hielt mir einen zerknitterten Fünfer entgegen.
»Du hilfst nicht. Du treibst mich in den verdammten Wahnsinn! Lass mich einfach in Ruhe.«
»Ist es die Arbeit?«, riet sie zum zweiten Mal an diesem Abend – genauer gesagt, in diesen frühen Morgenstunden.
»Nein. Es ist nicht die Arbeit. Es hat nichts mit der Arbeit zu tun.«
»Wie läuft es denn so? Kommst du gut zurecht?«
»Ja, Mum, alles ist verfickt wunderbar.«
»Ist es dein Chef?«, bohrte sie.
»Es hat nichts mit der Arbeit zu tun. Warum muss ich dieselbe Frage auf acht verschiedene Scheiß-Arten beantworten?«
»Was ist es denn dann? Ist es ein Mädchen?«, fragte sie und stolperte damit über meine Achillesferse.
»Nein«, antwortete ich etwas zu schnell.
»Ist es das? Ein Mädchen? Wer ist sie?« Händereibend weidete sie sich an meiner Verlegenheit. »Warum bringst du sie nicht mal mit zum Tee?«
Ich merkte, dass es kein Entrinnen gab. Sie hatte mich. Meine einzige Chance bestand jetzt darin, alles herunterzuspielen und sie von der Fährte abzubringen … von der Witterung … vom Tod.
»Es ist wirklich nichts. Ich hatte heute Abend eine Verabredung. Das ist alles.«
»Mit einem Mädchen?«, fragte sie ganz aufgeregt.
»Nein, mit einem Scheiß-Silberrückengorilla. Was glaubst du denn?«
»Wer ist sie? Wann kann ich sie treffen?«
»Sie ist niemand.«
»So so, niemand. Mein Sohn geht also mit niemandem aus, ja?«, rief sie theatralisch.
»Sie ist nicht niemand, bloß niemand, den du kennst.«
»Aha, und woher weißt du das so genau? Kennst du etwa alle, die ich kenne?«
»Sie wohnt nicht in deiner Nähe. Du kennst sie nicht.«
»Wie heißt sie denn? Vielleicht kenne ich sie ja doch.«
»Tust du nicht.«
»Vielleicht doch. Ich kenne sehr viel mehr Leute, als du glaubst.«
»Du kennst sie verdammt noch mal nicht.«
»Wer ist sie?«
»Niemand.«
»Es ist doch nicht etwa Susan Potter, oder?«
»Du kennst sie nicht.«
»Oh, wie schüchtern er ist, wenn es um seine neue Freundin geht! Ha ha ha!«
»Sie ist nicht meine Freundin!«
»Wie? Du gehst mit jemandem aus, aber sie ist nicht deine Freundin?«
»Ich gehe nicht mit ihr aus.«
»Das hast du doch gerade selbst gesagt.«
»Nein, ich habe gesagt, ich bin mit ihr ausgegangen, nicht, dass ich das immer noch tue.«
»Was ist denn passiert? Habt ihr euch getrennt? Bist du deswegen so traurig? Habt ihr euch gestritten? Was hast du gemacht?«
»Nein, ich bin traurig, weil du hier bist und dich einfach nicht verpissen willst. Warum verpisst du dich nicht?«
»Möchtest du, dass ich mit ihr rede?«
»Ich möchte weder, dass du mit ihr redest, noch, dass du mit mir redest. Ich möchte, dass du stirbst und freundlicherweise aufhörst zu existieren.«
»Vielleicht hilft es, wenn sie es von mir hört. Von Frau zu Frau, weißt du? Ich könnte sie umstimmen. Sie überreden, dass sie dich zurücknimmt.«
»Mich zurücknimmt? Warum gehst du automatisch davon aus, dass sie es war, die Schluss gemacht hat?«
»Ach, Liebling, so habe ich es nicht gemeint. Ich wollte nur sagen, wenn du mich mit ihr reden lässt, könnte ich sie vielleicht für dich zurückgewinnen.«
»Das ist genau das Gleiche! Kannst du dir wirklich nicht vorstellen, dass möglicherweise ich es war, der sie abserviert hat?«
»Wer ist sie, Ian? Wie heißt sie?«
»Weiß ich nicht. Sage ich dir nicht.«
»Oh, Ian, warum nicht? Bitte lass mich dir helfen.«
»Hör auf! Hör auf! Hör auf!«, schrie ich und schlug dabei immer wieder mit der Faust gegen die Wand.
»Sag mir einfach nur, wer sie ist, ja? Bitte, Ian, ich muss es wissen.«
»Jesus! Um Gottes willen, warum muss ich dir alles sagen? Sie hat nichts mit dir zu tun. Warum kannst du mich nicht dieses eine Mal verschonen? Ich bin müde, ich will schlafen. Ich will vergessen.«
»Schau mal, das ist aber doch wichtig. Ich meine, ich will schließlich nicht, dass mein Sohn mit irgendeinem dahergelaufenen Mädchen ausgeht, nicht wahr?« Sie folgte mir von Zimmer zu Zimmer. »Ich möchte wissen, wie sie ist. Ich möchte wissen, ob sie zu dir passt. Ich meine, was wäre ich denn für eine Mutter, wenn ich dich einfach an eine x-Beliebige hergeben würde?«
Mich hergeben?
Ich hörte nur noch ein schrilles, kreischendes Störgeräusch und spürte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. Jedes einzelne Härchen, jede Faser und jedes Molekül in meinem Körper schrien mich an, ihr den Garaus zu machen, doch ich konnte es nicht. Dafür waren die Dinge zu weit fortgeschritten. Alles, was ich noch tun konnte, war durchhalten und versuchen, geistig relativ gesund zu bleiben. Ich musste mich sammeln, aber mein Instinkt ließ mich nicht. Halte dagegen! Lass sie damit nicht davonkommen!
»Mich hergeben? Du übergibst mich niemandem. Ich bin ein Mann, kein kleiner Junge. Ich kann treffen, wen ich will, ausgehen, mit wem ich will, heiraten, wen ich will, und töten, wen ich will. Ich brauche deine Erlaubnis oder deine Zustimmung für keinen einzigen Teil meines Lebens. Mich hergeben?« Lachend schüttelte ich den Kopf.
»Ach, so ist das also. Willst du mir erzählen, dass ich, deine Mutter, überhaupt kein Mitspracherecht habe, wenn es um meinen Jungen geht? Ist es das, was du meinst?«
»Ja!«, rief ich. Mein Gott, sie hatte es verstanden. Endlich. »Du hast kein Mitspracherecht bei irgendetwas, das ich tue – was und wann auch immer. Mein Leben dreht sich nicht mehr um dich. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du bist wie ein Blutegel, den ich nicht loswerde. Dein Körper ist weg, aber dein Kopf ist noch da und saugt mich aus. Nein, du bist schlimmer als ein Blutegel. Wenigstens ist der nur hinter Blut her, aber du willst alles, mitsamt meiner Seele.«
»Nun, wenn das so ist, muss ich mir wirklich ernsthaft Gedanken machen, ob ich dir erlauben kann, dieses Mädchen zu heiraten.«
Es gab einen langen Moment der Stille, während ich in atemloser Verwunderung im Zimmer umherblickte. War das zu viel? Hätte sie das wirklich so gesagt? Aber das hatte sie getan, oder? Ich erinnerte mich richtig, oder etwa nicht?
Wie auch immer. Selbst wenn sie es nicht gesagt hatte, klang es definitiv wie etwas, das sie hätte sagen können.
Ich fing an zu schreien.
»Hör auf! Hör auf! Hör auf!« Ich schlug ein Loch in die Küchentür und mir die Hand blutig.
»Du bist mein Kind, das wirst du immer sein, und Kinder müssen ihren Müttern gehorchen. Wenn du ein Mädchen nach Hause bringst, das gut für dich ist, dann werde ich dich gehen lassen, vorher nicht.«
»Du besitzt mich nicht. Wie kannst du mich gehen lassen, wenn ich dir gar nicht gehöre?«, heulte ich, aber ich konnte es ihr nicht begreiflich machen. Mum fuhr fort, ihr eigenes Gespräch zu führen, ganz egal, was ich sagte oder dachte.
»Tut mir leid, wenn du das ungerecht findest, aber ich weiß am besten, was gut für dich ist. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich meinen kleinen Jungen beschützen möchte.«
»Ich bin kein kleiner Junge!«, rief ich immer und immer wieder und schlug mit dem Kopf gegen den Fußboden, sodass er noch mehr schmerzte.
Tatsache ist, ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter mich jemals beschützt hätte, als ich wirklich noch ein kleiner Junge war. Ich erinnere mich daran, wie ich nächtelang draußen im Dunkeln vor irgendwelchen Pubs auf den Stufen gesessen habe, während sie sich drinnen mit meinem neuesten »Onkel« amüsierte. Meistens bemerkte sie mich nicht einmal. Meistens lief ich bloß hinter ihr her und schaute zu, wie ein Typ nach dem anderen morgens, bevor er ging, mein Sparschwein leerräumte, wenn meine Mutter noch schlief. Ja, genau, mein Sparschwein. Die arme Sau hatte mehr Messer im Rücken als Julius Cäsar.
Ich erzähle das jetzt nicht, um von irgendwelchen barmherzigen Samaritern Mitleid zu erheischen. Was passiert ist, ist passiert, und ich bin froh, dass es vorbei ist. Nein, ich erwähne es nur, um zu verdeutlichen, wie dieser Meinen-kleinen-Jungen-beschützen-Quatsch Salz in die Wunde streute. Nicht, dass es Sinn gehabt hätte, ihr die Vergangenheit unter die Nase zu reiben. Mum konnte die Tatsachen vollkommen verdrängen. Soweit es sie betraf, war sie eine mustergültige Erziehungsberechtigte gewesen. Mama Walton und die Miracoli-Mutter in einem, leider nicht gewürdigt von einer grausamen, mitleidlosen Welt, die ihr den einen Fehltritt nicht verzeihen konnte, den sie als junges Mädchen begangen hatte. Mein Leben lang hatte ich mit Zins und Zinseszins dafür bezahlen müssen.
»Janet!«, sagte Mum plötzlich. »Ist das ihr Name? Janet? Das klingt ja ganz entzückend.«
Woher hatte sie den Namen? Ich hatte ihn nicht gesagt, oder doch? Hatte ich bei all meinem Schimpfen und Toben wieder von Janet angefangen, ohne es zu merken?
»Wann kann ich diese Janet denn einmal sehen? Wann kann ich sie treffen?«, säuselte sie.
»Gar nicht«, zischte ich. »Du wirst sie nie treffen.«
»Du kannst sie doch am Mittwoch mitbringen. Ich werde Torte besorgen und all deine alten Babybilder ausgraben.« Sie sabberte vor Begeisterung. »Dann erzähle ich ihr, wie du dir immer in die Hose gemacht hast, als du klein warst. Wie ich immer wusste, wenn du die Hose voll hattest, weil du dann ganz still wurdest und dich hinter dem Fernseher versteckt hast. Oh ja, ich werde ihr ganz genau erzählen, auf welche Sorte kleinen Jungen sie sich eingelassen hat. Mal sehen, ob sie dich dann immer noch heiraten will.«
Wirklich, so redete sie andauernd. Worin dabei der Anreiz für mich bestehen sollte, ein Mädchen mit nach Hause zu bringen, war mir schleierhaft.
Aber das war sowieso egal, denn sie würde Janet nie treffen. Warum sollte ich mich also überhaupt aufregen? Diesen Gedanken fand ich beinahe tröstlich.
»Du wirst sie nie treffen«, lächelte ich.
»Rede keinen Unsinn, natürlich werde ich das. Allerspätestens bei der Hochzeit.«
Ich grinste. »Niemals.«
»Ach, was du manchmal für einen Quatsch erzählst.«
Ich lächelte bloß noch einmal und wiederholte leise: »Niemals.«
Mum sah mich für einige Sekunden an, dann verdrehte sie angewidert die Augen.
»Ian, du hast sie doch nicht etwa umgebracht?«
»Ich habe ihr den beschissenen Schädel weggepustet. Du hättest es sehen sollen.«
»Oh nein, nicht schon wieder!« Mit einem traurigen Seufzen schüttelte sie den Kopf.
»Was meinst du mit schon wieder? Das hört sich an, als würde ich das andauernd machen. Es war erst das zweite Mal.«
»Ian, sieh mal, du musst aufhören, Leute umzubringen. Du wirst nie ein nettes Mädchen finden und dir ein schönes Heim mit ihr aufbauen, wenn du sie jedes Mal ermordest, sobald nicht alles so läuft, wie du es gerne hättest. Dein Vater hat nie jemanden umgebracht.«
»Wovon redest du? Er war in Korea, er hat jede Menge Leute getötet.«
»Ja, aber das waren nur Chinesen, die zählen nicht. Ich meine echte, richtige Menschen. Das ist nicht nett.«
»Und ich wüsste auch nicht, dass Dad jemals ein nettes Mädchen getroffen hätte«, sagte ich.
»Das kommt alles von den Leuten, mit denen du arbeitest. Das sind keine angenehmen Zeitgenossen. Warum gehst du nicht weg von denen und suchst dir eine normale Arbeit? Du warst doch immer so gut mit Zahlen. Warum wirst du nicht Buchhalter?«
»Oh, bitte! Jetzt fang nicht wieder damit an.«
»Wieso versuchst du es nicht wenigstens mal?«
»Weil ich nicht will. Mir gefällt das, was ich tue.«
»Aber du weißt doch gar nicht, wie es ist, wenn du es nicht versuchst, und ich glaube, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst …«
»Nein! Nein, ich will kein Buchhalter werden. Ich mag den Job, den ich habe. Ich will nichts anderes ausprobieren.«
»Weißt du, was ich gar nicht leiden kann, sind Menschen, die Dinge von vornherein ausschließen und sich nicht einmal anhören, was andere für Ideen und Meinungen haben«, sagte sie ohne ein Fitzelchen Selbstironie. »Versuch es doch wenigstens mal.«
»Nein.«
»Aber warum nicht? Vielleicht würdest du feststellen, dass du eine echte Begabung dafür hast.«
»Nein, würde ich nicht.«
»Natürlich nicht, wenn du es gar nicht erst versuchst.«
»Mum, ich will nicht. Ich mag das, was ich tue.«
»Es könnte doch sein, dass du Buchhaltung auch mögen würdest.«
Ich hörte auf zu diskutieren, doch es machte keinen Unterschied.
»Woher willst du das wissen? Woher willst du das wissen?«, plapperte sie immer weiter. »Erinnerst du dich an Onkel Brian, der mal bei uns gewohnt hat (mietfrei und ständig betrunken) und immer seine eigene Sandwichbar aufmachen wollte, aber er dachte, er würde keinen Kredit bekommen, um …«
»Aufhören!« Jesus Christus, war es denn vollkommen unmöglich, zu ihr durchzudringen? Offensichtlich ja, denn sie laberte immer weiter von dem verschissenen alten Sack, der irgendwann genug Kohle zusammengeschnorrt hatte, um ein rattenverseuchtes Loch unter einem Eisenbahnbogen zu kaufen und zu beweisen, was für einen blendenden Erfolg man im Leben haben kann, wenn man nur will. Falls es euch interessiert, die Tasty Snack Sandwich Bar wurde vom Gesundheitsamt dichtgemacht, nachdem Onkel Brian ein halbes Dutzend Kunden mit seinen selbstgemachten Hühnchenpasteten ins Krankenhaus gebracht hatte. Er machte sich aus dem Staub und soff sich mit dem bisschen Geld, das er noch hatte, in den Alkoholismus, bevor die Kredithaie ihn erwischten. Ein echter Unternehmer, der gute verstorbene Onkel Brian.
»Ich will doch nur das Beste für dich. Ich will nur, dass du glücklich bist«, sagte sie immer wieder und wieder. »Ich liebe dich.«
»Nein«, schluchzte ich. »Niemand liebt mich. Niemand mag mich auch nur.«
»Ich hätte dich lieben können«, mischte sich plötzlich Janet ein. Wasser und Blut troffen auf den Teppichboden. Ihr Gestank brachte mich zum Würgen.
Ich schloss die Augen und schüttelte den Kopf.
»Ich habe dich aber nicht geliebt.«
»Du kanntest mich doch gar nicht«, sagte Janet.
»Ich hätte dich nie lieben können.«
»Weil ich dick war.«
»Nein, nicht, weil du dick warst. Damit hatte es nichts zu tun. Es lag an etwas völlig anderem.«
»Was ist so schlimm am Dicksein?«, redete Mum dazwischen. »Hallo, ich bin übrigens seine Mutter.«
»Hallo, ich bin Janet«, sagte Janet lächelnd und reichte Mum die Hand.
»Ich habe nicht gesagt, dass es schlimm wäre, dick zu sein. Es hatte nichts mit Dicksein zu tun.«
»Warum konntest du mich nicht lieben, Ian?«
»Ich habe es einfach nicht gefühlt.«
»Was hast du nicht gefühlt?«
»Es. Den Funken. Das gewisse Etwas. Ich habe nichts für dich gefühlt. Es tut mir leid.«
»Also, ich finde, sie ist ein ganz reizendes Mädchen«, sagte meine Mutter.
»Ich habe sie nicht geliebt«, beharrte ich.
»Und genau das ist dein Problem, dass du niemanden liebst. Du kannst niemanden lieben. Du bist gar nicht fähig dazu.«
»Das bin ich doch.«
»Nein, bist du nicht. Du weißt ja nicht einmal, was das Wort Liebe bedeutet. Du bist nicht in der Lage, irgendjemanden außer dir selbst zu lieben. Du bist selbstsüchtig.«
»Das stimmt nicht. Ich werde dir beweisen, dass das nicht stimmt.«
»Mich hast du nicht geliebt«, warf Janet ein.
»Das hat nichts zu sagen.«
»Wirklich nicht? Du bist nie geliebt worden und das wirst du auch nie. Und weißt du, warum? Weil du es einfach nicht in dir hast. Es ist ganz egal, mit wie vielen Mädchen du noch ausgehst, du wirst den Rest deines Lebens alleine verbringen.«
»Das werde ich nicht. Ich bin fähig zu lieben, ihr werdet schon sehen. Und wenn ich jede Frau in England umbringen muss, das ist mir egal. Irgendwann finde ich die Richtige.«