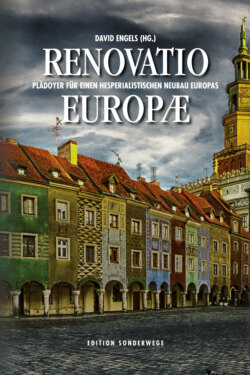Читать книгу Renovatio Europae. - David Engels - Страница 12
3. Das Ende des Nationalstaats?
ОглавлениеHeute freilich gilt das Konzept des Nationalstaats weitgehend als veraltet, während »Europa« (also eigentlich die EU) als die historisch prädeterminierte nächste Stufe im historischen Entwicklungsplan gesehen wird, welche ultimativ in einer globalisierten und multikulturellen Welt gipfeln wird, wenn auch alle Bürger noch nicht »reif« für eine solche Entwicklung sind und daher vorübergehend von der EU »geschützt« werden müssen. So lesen wir bei Macron: »Angesichts der globalen Umwälzungen sagen uns die Bürgerinnen und Bürger nur allzuoft: ›Wo ist Europa? Was unternimmt die EU?‹«
Nun scheint bereits jener angebliche Appell der Bürger an »Europa« (bzw. die EU) Frucht einer gewissen Projektion zu sein, denn zumindest in Polen scheint es eher unwahrscheinlich, daß ausschließlich die EU als fähig betrachtet wird, vor jenen Umwälzungen zu schützen (von denen viele, wie etwa die Migrationskrise und die Islamisierung, das Land ja auch gar nicht betreffen): Hier würde man eher sagen: »Was tut unsere polnische Regierung, diesen Entwicklungen Einhalt zu gebieten?« Freilich sieht die Lage in Deutschland, ja selbst in Frankreich anders aus, würde der Appell an den Nationalstaat hier doch wahrscheinlich sogar als »nationalistisch« ausgelegt werden.
Diese und viele andere ideologische Verschiebungen des politischen Diskurses lassen sich wohl am eindringlichsten am »Haus der europäischen Geschichte« in Brüssel ablesen. Hier erscheint die EU ganz offensichtlich als »telos« der gesamten abendländischen Geschichte, ganz im Einklang mit der in Deutschland entwickelten und überallhin exportierten Interpretation von Geschichte als Objekt der »Vergangenheitsbewältigung« (und gleichzeitig auch Vergangenheitsüberwältigung): Die gesamte europäische Geschichte wird (übrigens sehr summarisch) als eine einzige Folge von Greueltaten betrachtet, in welcher nur hier und da, etwa in Form der Französischen Revolution, das Licht der Vernunft als »Vorbote des Guten« durchscheint; die »richtige« Geschichte Europas aber beginnt eigentlich erst mit dem Zweiten Weltkrieg und beruht nicht nur auf dem üblichen »Nie wieder Krieg«, sondern auch auf der Verpflichtung der Selbstauflösung der Nationen als gerechter Strafe für die Verbrechen der Vergangenheit.
Aus polnischer Perspektive betrachtet, ist eine solche Darstellung der Geschichte kontrovers und zweifelhaft, da sie mit der in Polen und vielen anderen Ländern Mitteleuropas immer noch praktizierten Sicht der Vergangenheit kontrastiert: Geschichte ist hier immer noch eine Lehrmeisterin konservativer Werte- und Moralvorstellungen, ein Aufruf zur Imitation der großen Vorgänger, eine Verpflichtung zur loyalen Fortsetzung vergangener Traditionen und ein Schatz materieller und immaterieller Güter, die es zu bewahren und schützen gilt. Wie ich häufig bei Diskussionen mit meinen Kollegen selbst von der EVP feststellen mußte, mit denen ich das »Haus der europäischen Geschichte« besichtigte, scheint gerade eine solche Sichtweise der Geschichte im Westen Europas kaum noch verständlich: Selbst der Stolz auf den Heroismus des Widerstands gegen den Totalitarismus (etwa durch die polnische Heimatarmee, die sich nicht nur verzweifelt gegen die Nationalsozialisten, sondern auch gegen das kommunistische Regime gewehrt hat, oder die französische Résistance eines Jean Moulin) gilt nunmehr als zu »nationalistisch«.
Doch nicht nur das Christentum und der Nationalstaat werden heute weitgehend als positiv konnotierte, identitätsstiftende Faktoren abgelehnt, wie ich kürzlich erfahren mußte: Als ich in einem Bericht zur Lage der Erziehung davon sprach, daß die europäische Identität nicht nur auf christlichem Glauben, sondern auch griechischer Philosophie und römischem Recht beruhe, war es nicht nur der Hinweis auf das Christentum, der aus dem Text gestrichen werden mußte – das hatte ich erwartet –, sondern auch die Anspielung auf die klassische Antike. Selbst ein Verweis auf den Begriff der »Tugend«, die ich als ein wesentliches Ziel der Erziehung bezeichnete, wurde als »reaktionär« abgelehnt – auch für sie scheint kein Platz zu sein in einem offiziellen Dokument der Europäischen Union. Dabei ist es eigentlich unwesentlich, in welchem Maße jener Begriff des Fortschritts und der »Bewältigung« der Vergangenheit tatsächlich auch »offiziell« als Leitfaden der europäischen Institutionen erscheint: Zentral ist hier vielmehr das, was man mit Michael J. Sundal ihre »öffentliche Philosophie« (»public philosophy«) nennen könnte, welche sich eben nicht (nur) in der Ideologie, sondern auch den institutionellen Praktiken der Institutionen widerspiegelt. Und deren politische Ausrichtung ist mehr als eindeutig.